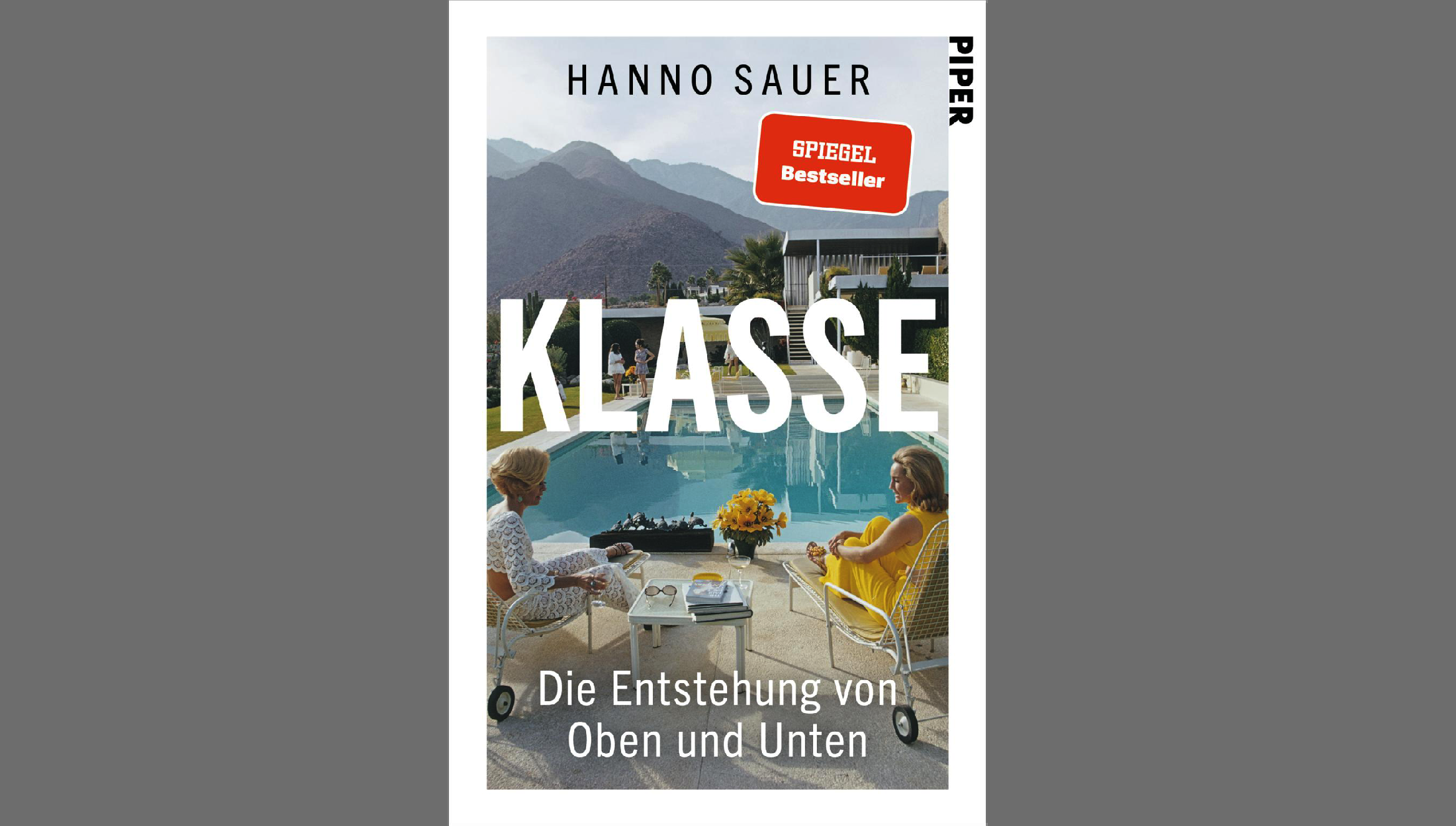
Klassismus- statt Klassenbewusstsein
Hanno Sauer sucht nach einer neuen Theorie der Klasse – und verliert dabei ausgerechnet Karl Marx aus den Augen. In seiner Rezension nimmt Maurice Weller eine ideologiekritische Rückkehr zu den Grundlagen vor.
Beim letzten geplanten Abschnitt des dritten Bands von Marx’ Kapital, welcher Klassen behandeln sollte, bricht das Manuskript ab. Für Hanno Sauer bedeutet dies das Eingeständnis eines Scheiterns: Marx sei es niemals gelungen, das Problem der Klassen zu lösen, und er sei uns eine Antwort auf die Frage, was Klasse ist, bis zuletzt schuldig geblieben. 1 Hanno Sauer, Klasse: Die Entstehung von Oben und Unten (Piper, 2025), 313–14. Diese Darstellung ist poetisch, aber irreführend. In seiner Schrift Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte hat Marx eine anspruchsvolle Theorie von Klassen entwickelt und angewandt. 2 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, hg. von Hauke Brunkhorst, Studienbibliothek Suhrkamp 3 (Suhrkamp, 2016). Es ist eines der bekanntesten Werke von Marx und gehört zu den wichtigsten Texten, die überhaupt jemals über Klassen geschrieben worden sind. Sauer erwähnt oder zitiert diesen Text in seinem Buch über Klasse leider nirgends.
Marx vs. Sauer
Auch an anderen Stellen wird die Theorie von Marx in dem Buch falsch dargestellt. Laut Sauers Darstellung wird den Arbeitern bei Marx, weil sie kein Eigentum an Produktionsmitteln besitzen, der »wahre Wert« ihrer Arbeitskraft ausbeuterisch vorenthalten. 3 Sauer, Klasse, 129. Doch das ist ein verbreitetes Missverständnis. Der Punkt bei Marx ist, dass es notwendig zu Ausbeutung zwecks Mehrwertproduktion kommen muss; an keiner Stelle behauptet er, dass der »wahre Wert« der Arbeit den Arbeitern bloß vorenthalten wird und Ausbeutung eine Frage der Gerechtigkeit sei. Sein Punkt besteht gerade darin, dass es einen mutmaßlichen »wahren Wert« der Arbeitskraft gar nicht gibt und dass die Vorstellung eines »wahren Werts« selbst Ausdruck der historischen Kämpfe zwischen Klassen ist. Auch behauptet Sauer, dass gemäß Marx der Kapitalismus Ausbeutung nicht abschafft, sondern nur versteckt. 4 Sauer, Klasse, 199. Dabei ist gerade das Gegenteil der Fall: Was den Kapitalismus Marx zufolge besonders macht, ist, dass in ihm die Ausbeutung offen zutage tritt und nicht mehr – wie im Feudalismus – ideologisch verschleiert wird.

Maurice Weller
Für Sauer ist Klasse auch kein primär ökonomisches Phänomen, das sich überwinden lässt. Sauer vereinfacht die ökonomischen Aspekte von Klasse stattdessen auf die Frage: »Wie viel Geld hat jemand?«. 5 Sauer, Klasse, 165. Wenn man das tut, ist klar, dass sich keine Theorie von Klasse als primär ökonomisches Phänomen gewinnen lässt und Klassen als unüberwindbar erscheinen. Bei Marx ist Klasse über die Stellung im Produktionsprozess definiert, also darüber, ob man über Kapital verfügt oder gezwungen ist, seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Das ist eine ökonomische Definition von Klasse, die sich nicht auf das jeweilige Vermögen und Einkommen reduzieren lässt, weil die Produktionssphäre vorrangig gegenüber der Zirkulationssphäre ist. Die These, dass sich Klassen nicht durch die Umverteilung von Vermögen überwinden lassen, bewegt sich völlig im Rahmen der marxistischen Orthodoxie.
Aus den Werken von Marx eine Klassentheorie zu rekonstruieren und auf aktuelle Verhältnisse zu übertragen, ist ein lohnendes Unterfangen, an dem Sauer scheitert. Darin besteht jedoch gar nicht sein erklärtes Ziel. Sein Projekt beschreibt er als eine »Aktualisierung« von Rousseaus Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen mittels neuer empirischer Erkenntnisse, so wie er in seinem vorherigen Buch Moral versucht habe, Nietzsches Genealogie der Moral zu updaten. 6 Sauer, Klasse, 14. Doch zu meinen, diese Werke mit neuer Empirie aktualisieren zu können, verfehlt deren Anspruch und Gehalt völlig.
Und was ist mit Ideologie…?
Sauer vertritt die These, dass Klasse unser Denken viel stärker prägt, als wir gemeinhin annehmen und selbst bemerken. Das stimmt und ist keine neue Einsicht. Bei Marx gibt es sogar einen eigenen Begriff dafür, mit dem sich Sauer leider viel zu wenig auseinandersetzt: er lautet »Ideologie«. Ein klassisches Beispiel für Ideologie ist, wenn gesellschaftliche Verhältnisse als natürliche Verhältnisse erscheinen, also wenn etwas, das wir machen, für uns so aussieht, als wäre es von Natur aus so, was auch Fetisch oder Verdinglichung genannt wird. Solange wir in Klassengesellschaften leben, müssen wir uns damit abfinden, dass unser Denken immer bis zu einem gewissen Grad ideologisch bleiben muss. Für die Philosophie ist das ein Problem, denn Ideologie verzerrt das Streben nach Wahrheit. Deswegen kann sich die Philosophie nach Marx nur durch die Aufhebung des Proletariats verwirklichen oder, wie Georg Lukács es formuliert hat, indem sie den Standpunkt des Proletariats einnimmt. 7 Karl Marx und Friedrich Engels, Werke. Bd. 1: 1839 bis 1844, 16., überarb. Aufl. (Dietz, 2006), 1:391; Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, Werke 2 (Aisthesis, 2013). Das ist nicht der Standpunkt von Sauer: Er bekennt sich als bewusstes Mitglied der Oberschicht.
Sauers zentrale Innovation besteht darin, Begriffe aus der Theorie »sozialer Signale«, die aus den Wirtschaftswissenschaften und der Verhaltensbiologie stammt und in der Spieltheorie angewandt wird, auf Klassenverhältnisse zu übertragen: Pfauen senden mit ihren pompösen Schwänzen das teure, fälschungssichere Signal, attraktive Partner zu sein. Wie bereits in seinem letzten Buch behandelt Sauer diese evolutionären Theorien als eine Art Zauberheilmittel zur Lösung klassischer sozialphilosophischer Probleme. Daneben bezieht sich Sauer stark auf die etablierten Klassentheorien von Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu. Diese Klassiker funktionieren noch, wenn man sie mit zeitgenössischen Beispielen anekdotisch illustriert und in die Terminologie sozialer Signale gießt, auch weil das entsprechende Vokabular sehr allgemein und unspezifisch ist. Nahezu jedes Verhalten oder Handeln kann problemlos als »Signal« beschrieben werden. Sobald es etwas schwieriger und aufwändiger ist, wird es dann auch »teurer« und »fälschungssicher«. Ein Resultat dieser begrifflichen Verschiebung ist, dass die Unterscheidung zwischen Verhalten und Handeln beziehungsweise Heteronomie und Autonomie ausradiert wird: Beide senden Signale, und diese Signale funktionieren laut Sauer sogar häufig besser, wenn sie unbewusst sind. 8 Sauer, Klasse, 64–68.
Ein weiteres Problem, wenn man eine schicke Uhr als »teures, fälschungssicheres Signal« im gleichen Sinne wie einen Pfauenschwanz beschreibt und damit Begriffe aus der evolutionären Biologie auf soziale Verhältnisse überträgt, ist, dass man diese von Menschen produzierten Verhältnisse naturalisiert – was ein zentrales Merkmal von Ideologie ist. Eine solche Evokation wird verstärkt, wenn Sauer bestimmte Klassendynamiken »hartverdrahtet« und »gleichsam vorinstalliert« nennt. 9 Sauer, Klasse, 244, 310. Sauer ist sich dieses Problems zumindest ein Stück weit bewusst. In seinem vorherigen Buch hat er zugestanden, dass gerade das Gebiet der evolutionären Psychologie, auf das er sich unter anderem bezieht, ideologieanfällig und »zur Hälfte Bullshit« ist: Ein großer Teil dieser Forschung plausibilisiert sexistische Klischees als evolutionäre Adaptionen, obwohl sie eindeutig das Produkt gewisser historisch entstandener sozialer Verhältnisse sind. 10 Hanno Sauer, Moral: Die Erfindung von Gut und Böse, 2. Aufl. (Piper, 2023), 25. Dennoch hält Sauer es für gerechtfertigt und fruchtbar, biologische Theorien auf gesellschaftliche Verhältnisse zu übertragen. Sein Lieblingsbelegbeispiel, das er für besonders fruchtbar und überzeugend hält, ist Religion: Religiöse Bekenntnisse und Vorschriften sind für ihn als teure Signale zu deuten, indem sie Eintritts- und Austrittskosten in Gemeinschaften erhöhen. Weil der Glaube an die Auferstehung oder jüdische Essensvorschriften offensichtlich absurd seien, verlangten sie einen hohen Preis zum Eintritt in die sie vorschreibende Gemeinschaft, wodurch diese stabiler werde. 11 Sauer, Klasse, 56–59. Diese These ist – wie vieles in Sauers Buch – eingängig, clever, originell und unterhaltsam, hält aber keiner seriösen historischen Forschung stand. Sauer lässt außer Acht, dass, was jemandem wie ihm als »offensichtlich absurd« erscheinen mag, anderen Menschen zu anderen Zeiten keineswegs so vorgekommen sein muss. Vielmehr ist diese Form vulgärer, militant-atheistischer, evolutionstheoretischer Religionskritik selbst ein spezifisches historisches Produkt des inzwischen verwelkten und selten zurückersehnten »Neuen Atheismus« der 2000er und frühen 2010er Jahre. Hier wird Sauers Forschung zum Opfer seines aggressiven Antihistorismus. 12 Hanno Sauer, »The End of History«, Inquiry 68, Nr. 7 (2025): 1739–63, https://doi.org/10.1080/0020174X.2022.2124542.
Klassismuskritik als Statussymbol
Sauer diagnostiziert die Entstehung einer »neuen Aretokratie«, die versucht, Status durch moralische Selbstdarstellung zu erlangen. Diese »neue Aretokratie« hat viel mit dem gemeinsam, was in zeitgenössischen Debatten über Klasse als »PMC« – professional-managerial class – bezeichnet wird. In seinem 1941 erschienenen Buch The Managerial Revolution beschrieb der vom Trotzkismus zum Neokonservatismus übergelaufene James Burnham die Entstehung einer neuen Klasse von Managern, welche die Gesellschaft dominiere. 13 James Burnham, The Managerial Revolution: What Is Happening in the World (Lume Books, 2021). Bei konservativen Intellektuellen in den USA steht Burnham derzeit hoch im Kurs. 14 Zack Beauchamp, »The 80-Year-Old Book That Explains Elon Musk and Tech’s New Right-Wing Tilt«, Vox, 14. Dezember 2022, https://www.vox.com/23505311/elon-musk-twitter-managerial-woke-james-burnham. Für sie ist der »woke« Moralismus der linksliberalen PMC das absolute Feindbild. Unter Linken gibt es eine Debatte, inwieweit die PMC ein verlässlicher Bündnispartner sein kann oder ob man sich stärker von ihr abgrenzen sollte. 15 Gabriel Winant, »Professional-Managerial Chasm«, n+1, 10. Oktober 2019, https://www.nplusonemag.com/online-only/online-only/professional-managerial-chasm/; ders., »You Don’t Want to Know This?«, Dead People Rule, n+1, 2. Dezember 2022, https://www.nplusonemag.com/issue-44/dead-people-rule/you-dont-want-to-know-this/. Diese relevanten zeitgenössischen Debatten über Klasse bleiben in Sauers Buch leider unerwähnt. Die von Sauer vollzogene Klassismuskritik wird zu einem Statussignal der von ihm diagnostizierten »neuen Aretokratie« – als ein Mittel moralischer und intellektueller Überlegenheit.
Bei Sauer geht es um Statuswettbewerbe innerhalb der oberen und mittleren Klassen. Als Insider aus der Oberschicht weiht er die mutmaßlich der Mittelklasse entstammenden Leser in die Geheimnisse subtiler Statussignale ein. Die Klassenerfahrung der unteren Schichten spielt keine große Rolle dabei. Auch das hängt mit der Signaltheorie zusammen: Denn die unteren Schichten senden laut Sauer gar keine bewussten Signale; sie nehmen an Statuswettbewerben gar nicht teil, und es gibt mit der Oberschicht überhaupt keine Verwechslungsgefahr. Sauer meint, dass der heutige Lohn für eine 15‑Stunden‑Woche mühelos für den vollwertigen Lebensstandard der 1930er Jahre ausreiche. 16 Sauer, Klasse, 182. Er behauptet auch, die Prekarität, die von vielen gegenwärtig erlebt wird, gar keine ökonomische Grundlage habe, sondern aufgrund von intensiviertem Statuswettbewerb eingebildet werde. 17 Sauer, Klasse, 103, 187. Was den Bezug zur ökonomischen Lebensrealität unterer Schichten betrifft, ist das ungefähr auf einem Niveau mit dem Marie Antoinette zugeschriebenen Satz: »Dann sollen sie doch Kuchen essen.« Ökonomische Konflikte werden auf Statuswettbewerbe reduziert.
So gut wie nirgends scheint bei Sauer ein Bewusstsein durch, dass es vom Standpunkt der Masse niederer Klassen etwas zu lernen geben könnte. Das, was er als »Einsichtsvorsprung durch Elitentourismus« bezeichnet, hält er für eine Illusion. 18 Sauer, Klasse, 25. Die von ihm benannten Probleme des Versuchs, sich der Realität der Erfahrung anderer Klassen anzunähern, umschifft er, indem er es gar nicht erst versucht. Sauer legt dar, wie schwer es ist, sich die Statussignale oberer Schichten anzueignen. Dass es umgekehrt auch so ist oder dass daran irgendetwas erstrebenswert sein könnte, wird völlig außer Acht gelassen. Dabei gäbe es auch in Sauers Metier popkultureller Illustrationen Beispiele dafür: Eine solche Umkehrung wird in dem bekanntesten Lied, das diese Themen verhandelt, »Common People« von der aus der Arbeiterklasse stammenden britischen Band Pulp thematisiert. Der Text lässt sich auch auf die bürgerliche Philosophie anwenden: »She came from Greece, she had a thirst for knowledge, …, I said ‘pretend you’ve got no money’ …, but she didn’t understand …, but still, you’ll never get it right, …, you will never understand …«. 19 Pulp, »Common People (Full Length Version)«, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=TZOdKdxP8Wk. Womöglich war das für Sauer zu »aufwärtsklassistisch«.
Fallstricke der Analytischen Philosophie
Wieso gelingt es einem Philosophen wie Sauer nicht, den bisherigen Forschungsstand in der Klassentheorie angemessen zu rekonstruieren, geschweige denn über ihn hinauszugehen? Ein vulgärmarxistischer Ansatz kann einen Teil davon erklären: Eine Person aus der Oberschicht schreibt ein Buch über Klassen, in dem er sie für unüberwindbar erklärt, hat damit im akademischen Betrieb Erfolg und wird in Rezensionen in der Presse gelobt. Doch es steckt mehr dahinter: Dass es Sauer nicht gelingt, Marx angemessen zu rekonstruieren, geschweige denn über ihn hinauszugehen, liegt an seiner Prägung durch die analytische Philosophie. Wie Vanessa B. Wills zuletzt aufgezeigt hat, muss Marx von der analytischen Philosophie missverstanden werden. 20 Vanessa Wills, Marx’s Ethical Vision (Oxford University Press, 2024). Die Methode von Marx ist an Hegel geschult, für den Sauer nicht viel übrig hat. 21 Hanno Sauer, »Götterdämmerung«, Philosophie Magazin, 30. März 2023, https://www.philomag.de/artikel/goetterdaemmerung. Sie ist historisch, dialektisch und systematisch. Die Methode von Sauer ist dagegen analytisch, empirizistisch, positivistisch, szientistisch und antihistoristisch. Nicht umsonst hat Herbert Marcuse die analytische Philosophie anhand dieser Eigenschaften als ein verdinglichtes Denken eingestuft. 22 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Beacon Press, 1991), 174–203.
Sauers Buch lässt sich einem »social turn« innerhalb der analytischen Philosophie zuordnen, demzufolge diese sich mit ihren Methoden stärker sozialen und politischen Themen zuwendet. In der vor Kurzem erschienenen Sozialgeschichte der analytischen Philosophie von Christoph Schuringa wird deren Verbreitung im Kontext des McCarthyismus verortet. Den »social turn« der analytischen Philosophie bezeichnet Schuringa als eine »Kolonisierung« anderer Traditionen. Deren kritische Einsichten würden in dieser Aneignung verwässert und entradikalisiert. 23 Christoph Schuringa, A Social History of Analytic Philosophy: How Politics Has Shaped an Apolitical Philosophy (Verso, 2025), 259–86. Schuringas These mag mit einer gewissen Polemik daherkommen, doch ein überzeugenderer Beleg als Sauers Buch über Klasse wird sich schwer finden lassen.
Sauer stellt richtigerweise fest, dass die Philosophie für den größten Teil ihrer Geschichte »die Ideologiemanufaktur der Ausbeuterklasse« war. 24 Sauer, Klasse, 224. Er ist sich bewusst, dass seine These der Unüberwindbarkeit von Klassen dem von Albert O. Hirschman beschriebenen Muster einer »Rhetorik der Reaktion« entspricht. 25 Sauer, Klasse, 24; Albert O. Hirschman, The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy (Belknap Press, 1991). Damit hat Sauer den Gehalt seines Buches selbst bereits präzise erfasst: Die Rhetorik der Reaktion als die Ideologie der herrschenden Klassen ist dort am effektivsten, wo sie sich einen progressiven, egalitären Anstrich gibt. »Da mag dein Anstreicher streichen, den Riss streicht er uns nicht zu.« 26 Ernst Busch, »Das Lied vom Klassenfeind«, o. J., Zugriff 8. Oktober 2025, https://www.youtube.com/watch?v=61B2oN5tV3M.
 Lesezeit 12 Minuten
Lesezeit 12 Minuten









