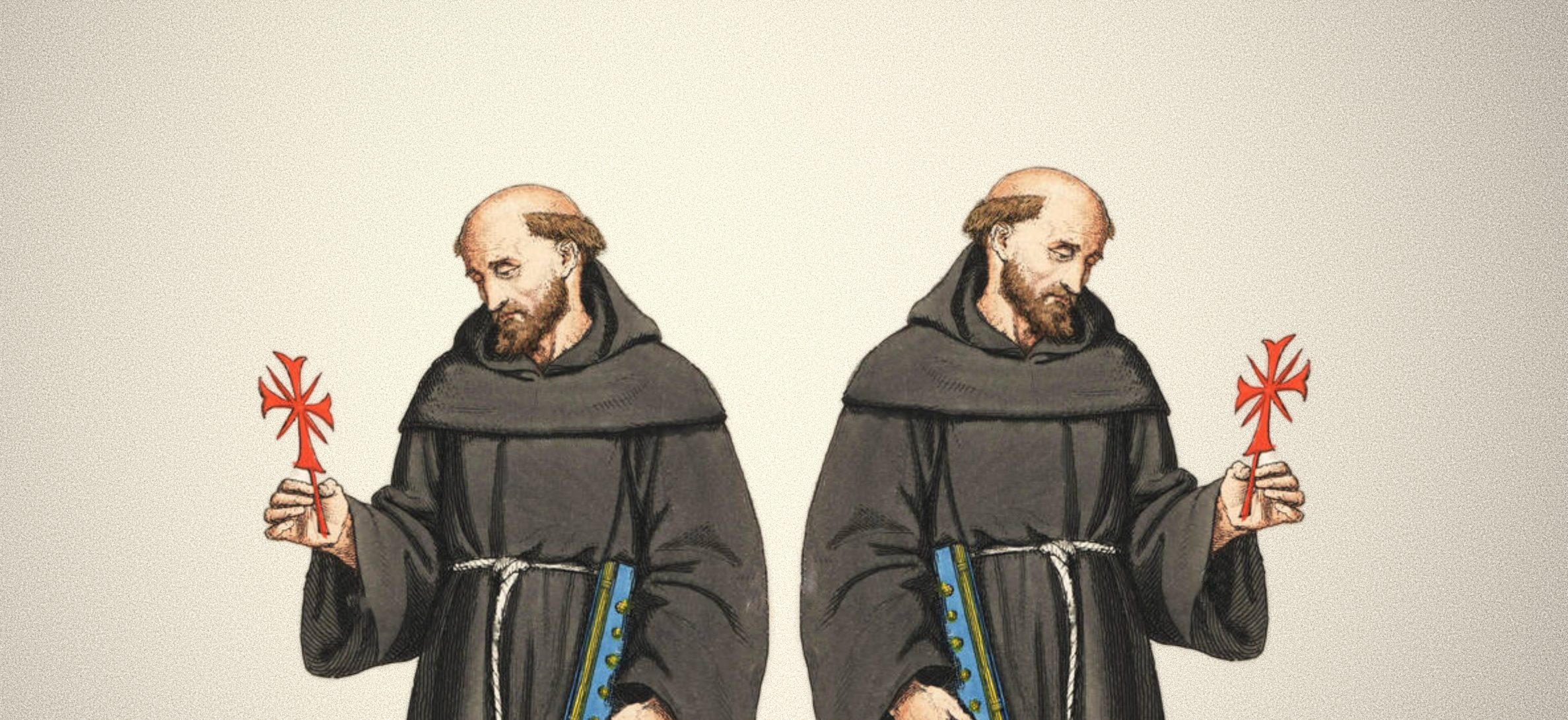Postliberale Naturrechtsrenaissance
Adrian Vermeules »Common Good Constitutionalism« treibt den US-Konservatismus zu einer naturrechtlichen Wende. In der Nachkriegs-BRD kritisierte Joachim Ritter eine ähnliche Naturrechtsrenaissance: Sie verkenne die Entzweiung von Recht und Tradition als Verfall statt als Bedingung moderner Freiheit. Hinter diese Erkenntnis kann Vermeule nicht schadlos zurückfallen, erklärt Jannik Oestmann.
»He who saves his Country does not violate any Law«, twitterte Donald Trump am 15. Februar 2025. 1 https://x.com/realDonaldTrump/status/1890831570535055759. Anlass war eine Reihe von Gerichtsentscheidungen: In der andauernden Zerschlagung des US-amerikanischen Verwaltungsstaates steht Trumps Administration aktuell weniger die parlamentarische Opposition, als vielmehr die Judikative im Weg. Die Erweiterung präsidentieller Machtfülle ist dabei allerdings nicht erst seit Trump II ein verfassungsrechtliches Problem. So wird insbesondere seit der Administration George W. Bush zur juristischen Rechtfertigung der Ausweitung präsidentieller Befugnisse auf die sog. »Unitary Executive«-Theorie abgestellt 2 Vgl. Rozell, Mark/Sollenberger, Mitchel: The Unitary Executive Theory and the Bush Legacy. In: Kelley, Donald/Shields, Todd: Taking the measure. The Presidency of George W. Bush, Texas A & M University Press 2013, S. 36 – 54. : Einer Verfassungsauslegung, in der die exekutive Staatsgewalt allein dem direkt gewählten Präsidenten unterstellt ist – der Präsident also besonders in Fragen der personellen Organisation des Staates weder Kongress noch Gerichten Rechenschaft schuldig sein soll.
Doch wo sich vergangene Administrationen noch auf eine zumindest an der Verfassung entlang argumentierende Ansicht stützten, scheint die Trump-Regierung die Grenzen der Legalität inzwischen ganz prinzipiell in Frage stellen zu wollen. Eine entsprechende Theorie einer nicht mehr nur »unitary«, sondern »unbound« executive hat bereits 2011 der in Harvard lehrende Verfassungs- und Verwaltungsrechtler Adrian Vermeule vorgelegt 3 Vgl. Vermeule, Adrian/Posner, Eric: The Executive Unbound. After the Madisonian Republic. Oxford University Press 2011. : Gegen einen liberalen Legalismus, der die Macht des Präsidenten rechtlich begründen und beschränken will, gilt hier als einzige Einschränkung der Präsidentialmacht ihre faktische Legitimität. Innerhalb der US-amerikanischen Rechten ist Vermeule inzwischen zu einem relevanten Bezugspunkt geworden, keineswegs nur unter Fachvertretern: So verbreitete Vizepräsident JD Vance etwa einen Beitrag Vermeules, in dem dieser das gerichtliche Einschreiten gegen Trumps Administration als unzulässige Einmischung in »legitimate acts of the state« rügte. 4 Vgl. Schwartz, Matthias: The Radical Legal Theories That Could Fuel a Constitutional Crisis. In: New York Times, 15. 2. 2025, online verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2025/02/15/us/constitution-crisis-trump-judges-legal.html; Vermeule relativierte diese spezifische Gerichtskritik als Forderung nach judicial restraint innerhalb der Gewaltenteilung, vgl. Vermeule, Adrian: Confusion About the Separation Of Powers. No, There is No »Constitutional Crisis«, The New Digest, 10. 2. 2025, online verfügbar unter: https://thenewdigest.substack.com/p/confusion-about-the-separation-of.

Jannik Oestmann
Das Recht des Postliberalismus
Vermeule und Vance, beide katholische Konvertiten, werden innerhalb der US-amerikanischen Rechten der wachsenden Strömung des »Postliberalismus« zugerechnet. 5 Vgl. Voß, Carlotta: Für Gott und gegen das Böse. Die postliberale Ideologie oder: JD Vance verstehen. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4/2025, S. 73 – 83. Einen wesentlichen intellektuellen Bezugspunkt 6 Vgl. Borg, Stefan: In search of the common good: The postliberal project Left and Right. In: European Journal of Social Theory, Vol. 27 (2024) (1), S. 3–21, S. 7f. dieser Strömung bildet der 2018 in Reaktion auf die erste Trump-Wahl veröffentlichte Essay »Why Liberalism failed« des Politikwissenschaftlers Patrick Deneen. Die titelgebende Frage, woher die Legitimationskrise der liberalen Demokratie rühre, beantwortet Deneen dort provokativ mit dem Liberalismus selbst: »Liberalism has failed – not because it fell short, but because it was true to itself. It has failed because it has suceeded.« 7 Deneen, Patrick: Why Liberlism failed. Yale University Press 2018, S. 3. Das abstrakte, negative und individualistische Freiheitsverständnis des Liberalismus erodiere die liberale Gesellschaft notwendig, weil es gewachsene Identitäten und Autoritäten, historische Wurzeln, sinnhafte Beziehungen, Gemeinsinn und Tugenden der Mäßigung zerstöre. 8 Vgl. ebd., S. 16. Deneens Argumentation wiederholt damit Topoi, die aus der Ideengeschichte des Konservatismus seit dem 18. Jahrhundert wohl bekannt sind: Die klassische konservative Kulturkritik hat ihr Zentrum in der Klage über die Destabilisierung der vermeintlich normativ natürlichen, historisch erwachsenen Gesellschaftsstrukturen durch allgemeine Freiheit und Gleichheit.
Adrian Vermeule überführte den Sound dieser Liberalismuskritik unlängst in eine eigene Rechts- und Verfassungstheorie des »Common Good Constitutionalism« 9 Vermeule, Adrian: Common Good Constitutionalism. Recovering the Classical Legal Tradition. Polity Press 2022. . Wie Deneen zielt er mit seiner Kritik zum einen in Richtung der Progressiven, deren rechtswissenschaftliche Vertreter die amerikanische Verfassung im Sinne individueller Selbstbefreiung transformativ ausdeuteten. 10 Vgl. ebd., S. 117ff. Andererseits richtet er sich aber auch gegen die (neo-)konservativen »Originalisten«, die die Verfassung aus ihrer ursprünglich historisch gemeinten Bedeutung heraus auslegen. 11 Vgl. ebd., S. 91ff. Für Vermeule hat sich auch diese Position inzwischen als eine »Illusion« erwiesen. Sie verschleiere, dass auch scheinbar am ursprünglich gemeinten Wortsinn operierende Entscheidungen eigentlich nur unter Zuhilfenahme von übergreifenden Rechtsprinzipien zu Stande kämen.
Gegen die Illusion des Originalismus und die Instrumentalisierung der Verfassung durch die Progressiven setzt Vermeule eine Perspektive, in der das Prinzip eines überindividuellen »Common Good« das Primat bilden soll. Vermeule beruft sich für dieses Argument neben zahlreichen Referenzautoren durchweg auf eine »klassische«, kontinentale Rechtstradition, die er vom mittelalterlichen ius commune bis zum ius civile der römischen Antike, genauer gesagt deren ius honorarium, zurückverfolgen will: Entscheidungen, so die Konstruktion, sind hier weniger durch Gesetzesrecht vorherbestimmt gewesen, sondern entsprachen vielmehr den Gerechtigkeitswertungen der römischen Gerichtsmagistrate, den Prätoren, die so zur lebendigen Stimme des Rechts wurden. 12 Vgl. ebd., S. 135f. Programmatisch will Vermeule mit der neuen Rezeption dieser »klassischen« Tradition zurück zur Vorstellung eines »natural law«, in dem die subjektiven Rechte der Einzelnen lediglich partikulare Verteilungsmasse innerhalb einer unteilbaren und übergeordneten Gerechtigkeitsordnung sind. 13 Vgl. ebd., S. 4. Abstrakte Freiheit und Gleichheit müssen in der Konsequenz hinter den materialisierten Prinzipien »justice, peace, and abundance« 14 Ebd., S. 31. zurückstecken: »The claim (…) that each individual may ‚define one´s own concept of existence, of meaning (…)‛ should not only be rejected but stamped as abominable, beyond the realm of the acceptable forever after.« 15 Ebd., S. 42.
Dass sich die juristische Strategie der Trump-Administration als Umsetzung dieses Programms einordnen lässt, lässt sich trotzdem mit guten Gründen anzweifeln. Das Ziel eines ungebundenen Verwaltungsstaats, der die gesellschaftliche Solidarität und die natürlichen Lebensgrundlagen schützen soll, steht im Widerspruch zu den Teilen der Regierung, die eine libertäre »Disruption« durchsetzen wollen. Außerdem kreisen, wie Victor Loxen darstellt, die bisherigen Rechtsstreitigkeiten der Trump-Regierung weniger um katholische Gemeinwohlkonzeptionen, Unitary oder Unbound Executive Theory, als um sehr viel profanere Fragen des Verwaltungsprozessrechts, insbesondere die Bindungswirkung der einstweiligen Verfügungen der Gerichte. 16 Vgl. Loxen, Victor: Die Judikative in der Herrschaft des Bullshits: Können sich die US-Gerichte dem Ansturm auf die Institutionen entgegenstellen?, VerfBlog, 2025/3/13, https://verfassungsblog.de/die-judikative-in-der-herrschaft-des-bullshits/. So sagt die postliberale Naturrechtsreaktivierung wohl weniger etwas über die juristischen Strategien der Trump-Administration aus, als über das ideenpolitische Arsenal des US-amerikanischen Konservatismus.
Naturrechtsrenaissance in der Bonner Republik
Wie könnte man die »katholische Verschärfung« des US-amerikanischen Konservatismus einem deutschen Publikum erklären? Der Rechtswissenschaftler Jannis Lennartz hat genau dies jüngst mit dem Schlagwort der »Christdemokratie« versucht. 17 Vgl. Lennartz, Jannis: Das sind wir, aber von vorgestern. In: FAZ vom 17. 3. 2025, S. 12. Lennartz will damit die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten an die deutsche Ideengeschichte heranrücken, namentlich an die von Wert- und Sittenvorstellungen überformte politische Programmatik des bundesrepublikanischen Nachkriegskonservatismus, der sich etwa im Würdebegriff an der Spitze des Grundgesetzes sein juristisches Erbe bewahrt habe: »Das, was die redende Klasse der Bundesrepublik in den Vereinigten Staaten mit Schrecken schaut: Das sind wir, früher. Sogar ein Früher, das noch heute bände, würde die gängige juristische Methode ein Veto der Quellen dulden.« 18 Ebd.
Die von Lennartz diagnostizierte Parallele lässt sich auch auf Ebene der Rechtstheorie nachverfolgen: Auch in der Bundesrepublik der 50er Jahre gab es eine »Naturrechtsrenaissance«, die insbesondere Lena Foljanty rechtsgeschichtlich aufgearbeitet hat. 19 Foljanty, Lena: Recht oder Gesetz? Juristische Identität und Autorität in den Naturrechtsdebatten der Nachkriegszeit. Mohr Siebeck 2013. Den Autoren dieser Debatte ging es darum, durch überzeitliche Wertvorstellungen zu einem nicht durch willkürliche (bzw. demokratische) Gesetzgebung kontaminierten, apolitischen Rechtsdenken zurückzufinden. Politisch imprägniert waren diese Programme allerdings durchaus: »Es waren«, wie Foljanty zusammenfasst, »die Wert- und Ordnungsvorstellungen des traditionellen, sozial ausgerichteten Konservativismus (…). Werte wie soziale Solidarität, Gemeinschaftsbindung und Gemeinwohlorientierung dominierten die Naturrechtskonzeptionen«. 20 Ebd., S. 339.
Der intellektuelle Nachkriegskonservatismus ist allerdings nicht bei dieser Naturrechtsprogrammatik stehen geblieben. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem »Problem einer Erneuerung des Naturrechts« suchte so etwa der Philosoph Joachim Ritter durch seinen Beitrag auf dem Ebracher Ferienseminar 1963, einem zentralen Diskussionsort konservativer Intellektueller in der frühen Bundesrepublik. 21 Ritter, Joachim: »Naturrecht« bei Aristoteles. Zum Problem einer Erneuerung des Naturrechts. In: Ders.: Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel. Suhrkamp 1977, S. 133 – 179. Ritter meldete hier Zweifel an, ob es sich bei dem, was unter dem Etikett »Naturrechtsrenaissance« verhandelt wurde, überhaupt um die Reaktivierung einer historischen Tradition handelt – und wenn ja, dann welcher? Ritter verglich hierzu zunächst die Naturrechtskonzeptionen seiner Gegenwart mit jener der antiken Philosophie Aristoteles: Hier bestünde tatsächlich noch eine Vorstellung von Recht, welche ihren Inhalt aus in der menschlichen »Natur« vorgegebenen Zwecken gewinnt. Um welche Zwecke es sich dabei handelt, sei ihr allerdings nicht von außen vorgegeben, sondern erweise sich erst in ihrer praktischen Verwirklichung in der Polis. 22 Vgl. ebd., S. 147f. Für Ritter ergibt sich damit eine Perspektive, die keine Trennung von Sollen und Sein, Normativität und Faktizität zulässt. Das politische Leben muss sich als Ausdruck der Vernunftnatur des Menschen rechtfertigen lassen – und das Naturrecht erhält seine Bestimmung erst in und durch die Polis, kann ihr also nicht einfach abstrakt gegenübergestellt werden. Gemünzt auf die Verfassung der politischen Gemeinschaft bedeute das: »‚Recht‛ ist für Aristoteles immer in der Vielfältigkeit dessen gegeben, was in der Polis wie im ‚Haus‛, Sitte, Brauch und Gewohnheit ist.« 23 Ebd., S. 159.
Mit den politischen Revolutionen der Moderne bricht diese Einheit zwischen Sein und Sollen für Ritter allerdings auf: Es komme zu einer »Entzweiung« zwischen der geschichtlichen menschlichen Praxis, die Ritter mit den Begriff »Herkunft« assoziiert, und dem nunmehr abstrakten, positiven Recht. 24 Ebd., S. 174ff. Ritter betrauert diese Entwicklung nicht. Denn in ihr realisiert sich ein Universalismus, durch den »zum ersten Male in der Weltgeschichte der Mensch als Mensch (…) zum Subjekt des Rechts wie des Staates« wird. 25 Ebd., S. 175. Mit seiner Reflexion des antiken Naturrechts will Ritter insofern nicht Anlass für Verfallsdiagnosen geben. Wendet man die aristotelische Perspektive für die Moderne an, dann zeige sich vielmehr, dass gerade die Entzweiung von abstraktem, positiven Recht und den fortexistierenden, der Herkunft zugehörigen natürlichen Rechten und Sitten bejahenswert ist: Erst wenn beide Seiten als unterschiedlich gesetzt werden, können sie sich zu einem humanen, bewahrenswerten Leben in Freiheit ergänzen.
Die Naturrechtsrenaissance in Ritters Gegenwart greift in seinen Augen gerade nicht die antike Tradition wieder auf. Vielmehr schließe sie ungewollt an das Naturrechtsdenken des späten 18. Jahrhunderts an, als die naturrechtliche Tradition bereits, wie Ritter es formuliert, in ihrer »Endschaft« begriffen war. 26 Ebd., S. 179. Zu diesem Zeitpunkt haben sich Sollen und Sein bereits vollständig voneinander entfernt: Das moderne Naturrechtsdenken geht von einem strikten Gegensatz von idealen Werten einerseits und staatlich gesetztem Recht andererseits aus. Der eigentliche Sinn der aristotelischen Tradition, so Ritter, wird damit verpasst: »In der Wirklichkeit, in der der Mensch als Mensch actu besteht und ist, liegt die Vernunft und die Wahrheit des gegenwärtigen Rechts, die daher den antithetisch fixierten Theorien verschlossen bleibt, die die geschichtliche und die gesellschaftliche Natur des Menschen gegeneinander ausspielen.« 27 Ebd., S. 178. Ritters Philosophie besteht dagegen darin, die moderne, subjektive Freiheit als Ausdruck des alteuropäischen Naturrechts zu deuten, nicht als dessen Ende – eine Pointe, die die konservativen Verfallstheoretiker übersehen, wenn sie ewiges Sollen gegen aktuelles Sein setzen.
Prätor gegen Polis
Ritters Dekonstruktion der Naturrechtsrenaissance seiner Gegenwart scheint auf den ersten Blick auch unmittelbar Vermeules Reaktivierung einer angeblich »klassischen« Tradition zu treffen – bemüht doch auch er mit dem »Common Good« eine überzeitliche naturrechtliche Tradition, die in Opposition zum gesellschaftlichen Sein gestellt wird. Gegenüber der Parallelisierung von bundesrepublikanischen Nachkriegskonservatismus und US-amerikanischen Postliberalismus lässt allerdings ein starker Einwand erheben: Denn aus der bloßen Tatsache gleich gelagerter Ideen lässt sich nicht automatisch eine historische Ähnlichkeit schlussfolgern, um die die gegenwärtige Wende des US-amerikanischen Konservatismus erklären – der unterschiedliche historische Kontext ist entscheidend.
So bildete die Naturrechtsrenaissance des deutschen Nachkriegskonservatismus im Wesentlichen eine Reaktion auf den deutschen Faschismus. Ausgangspunkt ihrer Kritik des positiven Rechts war die – inzwischen als haltlos erwiesene – »Positivismuslegende«: Die These, dass die juristischen Eliten der Weimarer Republik den Nationalsozialismus nicht etwa aus eigener ideologischer Überzeugung oder Opportunismus, sondern aufgrund des blinden Glaubens an das positive Gesetzesrecht mitgetragen hätten. 28 Vgl. hierzu Foljanty, Lena: Recht oder Gesetz. Juristische Identität und Autorität in den Naturrechtsdebatten der Nachkriegszeit, Mohr Siebeck 2013, S. 19 – 36; als wesentlicher Ausgangspunkt s. Radbruch, Gustav: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche Juristen-Zeitung Jg. 1 (1946) Nr. 5, S. 105 – 108. Damit stand im Hintergrund von Naturrechtsrenaissance und Christdemokratie eine Liberalismuskritik, für die das formalistische und relativistische Rechtsdenken der Moderne konsequenterweise im Nationalsozialismus mündete. Diese Kritik unterschied sich aber schon insoweit von jener der Postliberalen, als sie den Zusammenbruch liberaler Ordnung als Katastrophe rezipiert, nach der es eine wertorientierte Rückbesinnung braucht.
Vermeule hingegen bringt sein Programm gegen eine spezifische US-amerikanische Geschichte gesellschaftlicher Liberalisierung in Stellung, die sich nach der zivilgesellschaftlichen Bürgerrechtsbewegung erfolgreich in die Gerichte verlagert hat. 29
Vgl. Vermeule, Adrian: Common Good Constitutionalism. Recovering the Classical Legal Tradition, Polity Press 2022, S. 92f.
Haben sich die konservativen »Originalists« im Kampf gegen diese Entwicklung noch auf eine ursprüngliche Bedeutung eines Gesetzestextes bezogen, so geht Vermeule nun einen Schritt weiter und behauptet, diese Perspektive hätte sich auch im Zuge progressiver Aneignungen als unzuverlässig erwiesen. Der Common-Good-Constitutionalism ist explizit als Gegenvorschlag formuliert: Die Arbeit mit übergeordneten Prinzipien des »Gemeinwohls« biete nicht nur die plausiblere, methodenehrlichere Antwort – sondern auch eine, die die Liberalisierungen nicht mehr nur gerichtlich aufhalten, sondern auch durch eine ungebundene Exekutive umkehren kann.
Dieses Programm wird insbesondere in Vermeules eigenwilliger Rezeption des eigentlich in der kontinentalen Privatrechtsgeschichte verorteten Prätorenrechts der römischen Antike deutlich; wenn es darum geht, wem die Festlegung über das Gemeinwohl eigentlich obliegen soll. Diese Frage ist entscheidend: Denn in der Rolle der Prätoren sieht Vermeule hier eben gerade nicht die Gerichte, sondern die von ihm angemahnte »ungebundene Exekutive« des Verwaltungsstaates 30
Vgl. Ebd., S. 136ff.
: »Instead, it [Common Good Constitutionalism] reads constitutional provisions to afford public authorities latitude to promote the flourishing of political communities (…).« 31
Ebd., S. 36.
Damit ist es schließlich doch die reale Macht im Weißen Haus, die entscheidet, was Recht ist. Transzendenz und Positivität werden bei Vermeule insoweit nicht, wie in der bundesrepublikanischen Naturrechtsrenaissance, bloß einander entgegengesetzt, sondern identifiziert. Es handelt sich also um eine Steigerung des Problems: Der inhaltlich plausiblere Referenzpunkt für die postliberale Radikalisierung des Konservatismus scheint entsprechend auch weniger in der Bundesrepublik der 50 und 60er zu liegen, als in der Weimarer Zeit der 20er und 30er Jahre. Aus seinen eigenen Anleihen bei Carl Schmitt macht Vermeule jedenfalls keinen Hehl. 32
Vgl. nur Vermeule, Adrian (2009): Our Schmittian Administrative Law. In: Harvard Law Review 122, S. 1095-1149. Bereits Schmitt identifizierte sein Denken in konkreten Ordnungen mit einer vormodernen Tradition, für die das »mittelalterliche, aristotelisch-thomistische Naturrecht (…) eine in Wesens- und Seinsstufen, in Über- und Unterordnungen, Einordnungen und Ausgliederungen aufgebaute, lebendige Ordnungseinheit« darstellte, die in der Moderne durch das abstrakte Normendenken verdrängt worden sei; s. Schmitt, Carl: Über drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens. Berlin: Duncker & Humblot 2006 [1934], S. 34.
Der Prätor in Vermeules Theorie soll das Sein der subjektiven Rechte und rechtsstaatlichen Ordnung also nicht bloß durch das Sollen des »Common Good« ergänzen, sondern ihren Gegensatz in einer objektiven »Gemeinwohlordnung« überwinden. Doch genau diese Überwindungshoffnung sorgt dafür, dass auch diese konservative Revolution gegen die Moderne von Ritters Kritik genauso getroffen wird wie die bundesrepublikanische Naturrechtsrenaissance: Auch sie versteht die Entzweiung von natürlichem und positivem Recht nur als Verfall und nicht in Kontinuität der »klassischen Tradition«. Ironischerweise erweist sich Vermeules postliberale Agenda damit auch gerade nicht als Reaktivierung dieser klassischen Tradition, sondern im Gegenteil als das Produkt ebenjener ungeliebten Rechtsmoderne, gegen die sie aufbegehren will. Ritters Lesart der klassischen Tradition konnte sich dagegen mit dieser Rechtsmoderne versöhnen. Aus ihrer Perspektive erscheint der Common Good Constitutionalism insgesamt als Versuch, eine als »Naturrecht« ausgegebene Ordnung des Gemeinwesens gegen die tatsächlich gegebene, positive und abstrakte Natur der Rechte durchzusetzen: Der »Prätor« Vermeules, hinter dem man wohl den Präsidenten selbst und die Institutionen seines Verwaltungsstaates vermuten darf, erlässt seine Edikte im Zweifelsfall im direkten Gegensatz zur realen »Vielfältigkeit« dessen, was tatsächlich »in der Polis (…) Sitte, Brauch und Gewohnheit ist«. Hinter dem so gesetzten »Common Good« liegt dagegen kaum mehr als der Abgrund der faktischen Macht des Verwaltungsstaates: Die postliberale Reaktivierung des Naturrechts entpuppt sich – ganz profan – als legitimatorische Begleitmusik zur exekutiven Selbstermächtigung.
 Lesezeit 15 Minuten
Lesezeit 15 Minuten