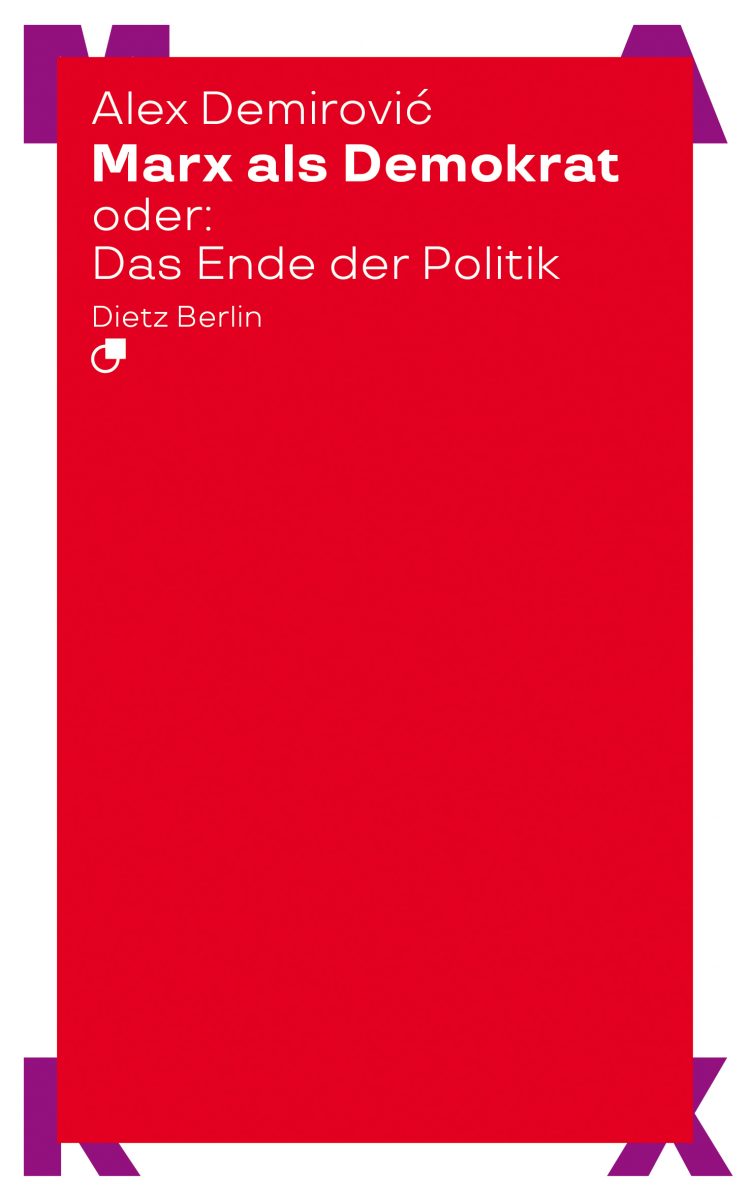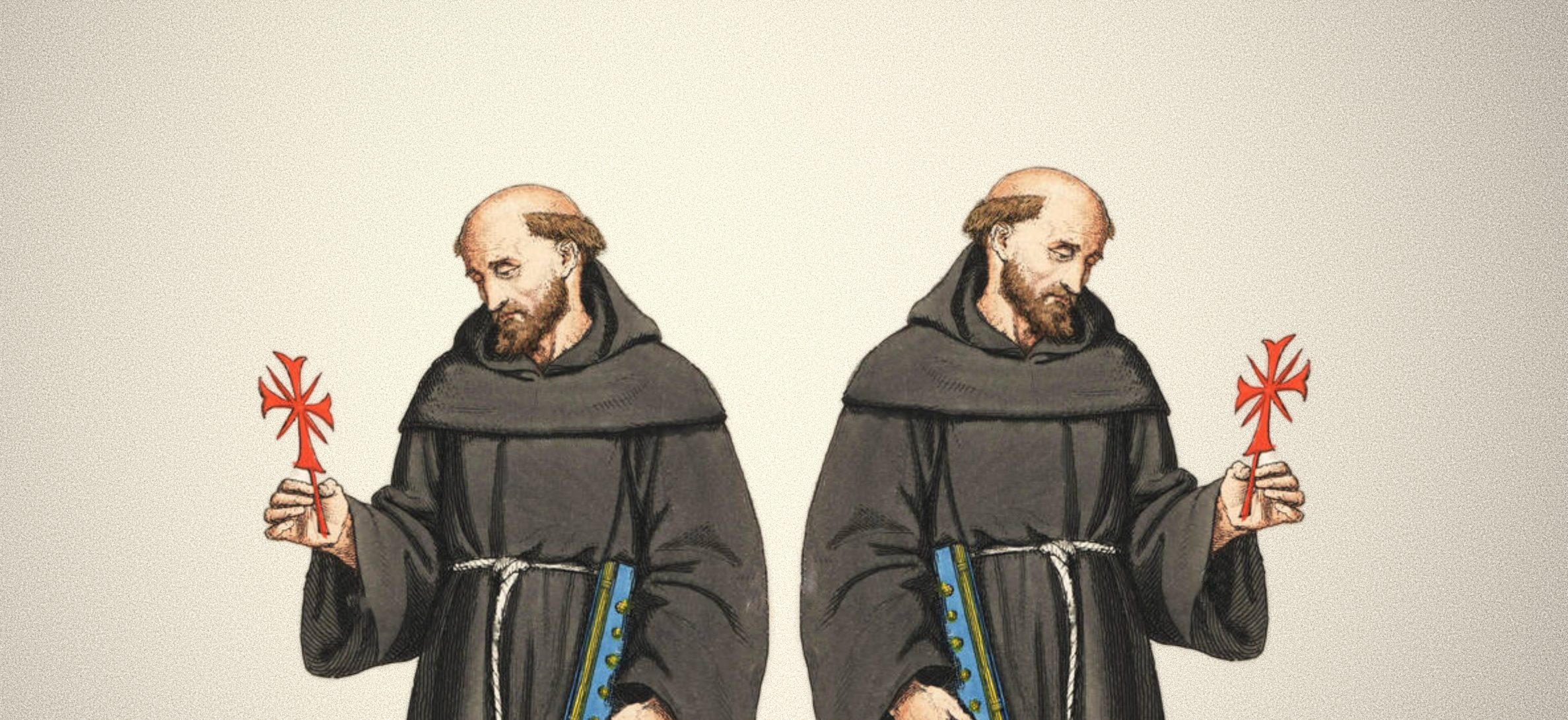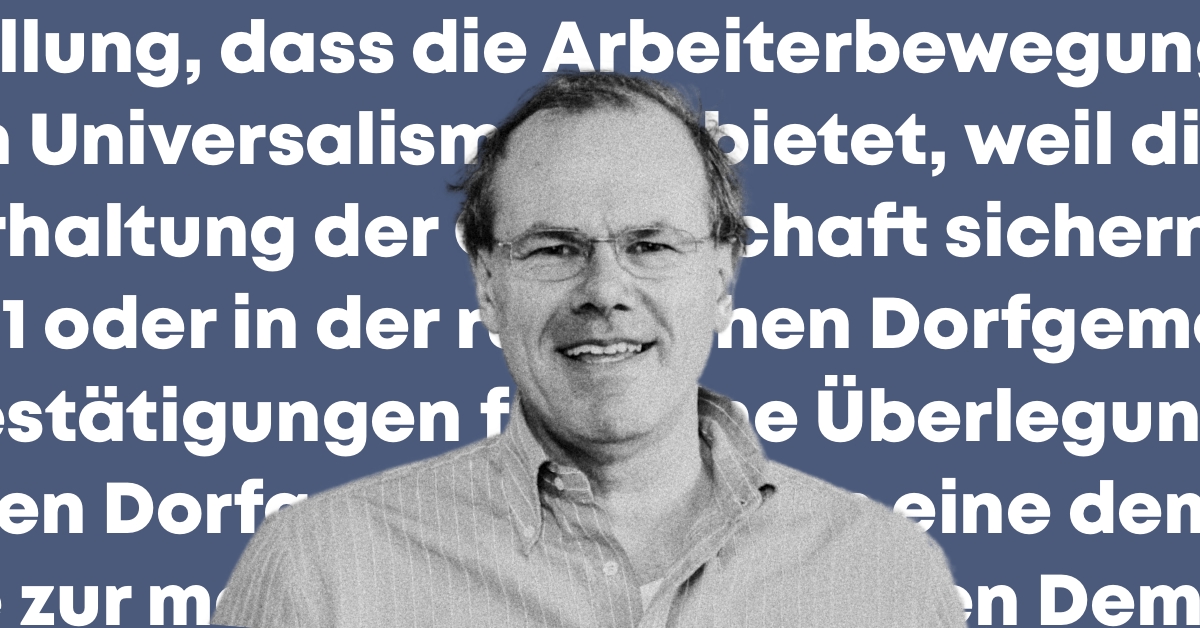
Alex Demirović: „Marx war ein radikaler Demokrat.“
Alex Demirović spricht mit Julia Werthmann über sein neues Buch »Marx als Demokrat« und erklärt, wie Marx von der radikalen Demokratie zur Kritik der Politik gelangte – und warum seine Überlegungen bis heute helfen, den autoritären Rechtsdrift zu verstehen.
Herr Demirović, war Karl Marx ein Demokrat?
Ja.
Und was für ein Demokrat war er?
Marx war kein liberaler Demokrat. Seine Konzeption entwickelte sich. Der junge Marx war radikaler Demokrat. Er argumentierte, dass die demokratische Verfassung der Kern aller Verfassungen sei. Monarchie und Aristokratie stellen nur usurpatorische Varianten der demokratischen Verfassung dar, in denen nicht das Volk, sondern einer seiner Teile über den anderen herrscht.
Dem späten Marx kamen jedoch zunehmend Zweifeln an der Idee, dass die Demokratie der Kern aller Verfassungen sei. Welche waren das?
Mit der Zeit verstand er diese Idee als zu eng, weil sie sich auf den Bereich der Politik begrenzt. Er zeigt kritisch, dass die liberale Sichtweise die Abspaltung der kapitalistischen Ökonomie von der demokratischen Politik mitmacht. Marx sieht seine Skepsis dann in der Feigheit der deutschen Liberaldemokraten in der Revolution 1848 bestätigt. Sie trauten sich nicht, die Prinzipien der Demokratie gegen die Monarchie zur Geltung zu bringen. Letztlich verrieten sie die demokratische Republik. Darin sah Marx allerdings keinen historischen Einzelfall, sondern eine Offenbarung des taktisch-instrumentellen Verhältnisses der bürgerlichen Klasse zur Demokratie. Im weiteren Verlauf seines Schaffens begab sich Marx auf die Suche nach einem Verständnis der Demokratie, das gesamtgesellschaftlich und menschheitlich orientiert ist.

Julia Werthmann
Und wird er fündig?
Er hat die Vorstellung, dass die Arbeiterbewegung einen neuen demokratischen Universalismus anbietet, weil die Arbeiter mit ihrer Arbeit die Erhaltung der Gesellschaft sichern. In der Pariser Kommune von 1871 oder in der russischen Dorfgemeinschaft sieht er Bestätigungen für seine Überlegung.
Inwiefern bieten Dorfgemeinschaften eine demokratische Alternative zur modernen bürgerlichen Demokratie?
Konfrontiert mit der Frage, ob Russland dem Rest Europas auf dem tragischen Weg kapitalistischer Vergesellschaftung, der Landvertreibung und ursprünglichen Akkumulation, folgen muss, um modern zu werden, antwortet Marx negativ. In Russland gäbe es Formen der Gemeindedemokratie und lokalen Selbstbestimmung, die direkt den Übergang in demokratischere Formen der Vergesellschaftung ermöglichen.
Max kritisiert nicht nur die Demokratie, sondern auch die Politik. Was ist das Problem mit der Politik?
Mit Politik meint Marx einen Prozess, den rezente Theorien wie etwa die radikale Demokratietheorien von Ernesto Laclau, Chantal Mouffe oder Jacques Rancière bejahen. Eine gesellschaftliche Gruppe erringt Hegemonie, indem sie beansprucht, für die Allgemeinheit zu sprechen – und dabei andere Gruppen ausschließt. So wird der Kampf um Hegemonie auf Dauer gestellt. Genau diese Herrschaftsbewegung lehnt Marx ab. Denn sie bedeutet, dass immer neue Gruppen, die männlichen Arbeiter, die Frauen und so weiter ihre Berücksichtigung im Allgemeinen einklagen. Aber die Illusion eines Allgemeininteresses wird aufrechterhalten und, das ist ihm besonders wichtig, die Trennung zwischen Politik und Gesellschaft wird nicht angefochten. Marx fragt sich, wie wir Dynamik von Herrschaft und Ausschluss überflüssig machen können.
Wo ließe sich diese politische Dynamik konkret beobachten, haben Sie ein Beispiel?
Marx veranschaulicht es am Beispiel der Französischen Revolution. Der dritte Stand zettelt die Revolution an und verspricht politische Gleichheit. Konkret bedeutet dies die Gleichheit vor dem Gesetz ungeachtet der Unterschiede der Individuen. Doch für einen Fabrikbesitzer bedeutet das etwas ganz anderes als für einen mittellosen Arbeiter. Deshalb bildet sich der vierte Stand, er protestiert gegen die falsche Einheit, in der die soziale Ungleichheit, die Armut, die Ausbeutung nicht vorkommt. So geht es immer weiter, immer von Neuem müssen sich Gruppen gegen eine illusionäre Allgemeinheit mobilisieren. Das kritisiert Marx. Er fragt sich, was die Versprechen der Französischen Revolution überhaupt bedeuten. Für ihn sind sie ideologische Allgemeinheiten, die ermöglichen, im Namen von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit Menschen vertraglich gesichert auszubeuten.
Würde ein Ende der Politik, das der Untertitel von Ihrem neuen Buch in Aussicht stellt, auch ein Ende des politischen Konflikts bedeuten? Und liefe eine politikbefreite Gesellschaft nicht Gefahr, in eine autoritäre Eindeutigkeit abzurutschen, die sich gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen verschließt?
Meiner Einschätzung nach geht Marx davon aus, dass es auch jenseits der Politik Konflikte gibt. Es müssen Entscheidungen getroffen werden: Wo wird wofür in welchem Umfang und welcher Form investiert? Wie groß muss eine Produktionseinheit sein? Wie viele Schwimmbäder, Maschinenfabriken, Chemiewerke brauchen wir? Heute wird das vor allem am Markt in der Konkurrenz zwischen Unternehmen um den Profit entschieden. Es kann dazu kommen, dass Güter fehlen und notwendige Betriebe geschlossen werden. Die Möglichkeiten der Politik, dies zu steuern, sind begrenzt, und es gibt erhebliche politische Interessenkonflikte. Genau hier will Marx demokratisieren. Der Dissens soll nicht in einer eigenen Sphäre der Politik von besonderen politischen Akteuren im Namen der Allgemeinheit ausgetragen werden. Marx greift die Differenzierung der Gesellschaft in Politik hier und Ökonomie dort an. Wenn es keine Klassen, keine heteronormative Geschlechterordnung mehr gibt, wird es zwar individuelle Streitigkeiten darüber geben, wie man miteinander lebt, arbeitet und liebt, aber es gibt keine sozialen Antagonismen. Veränderungen nach Prinzipien des Bedarfs und der Erkenntnis werden leichter möglich, weil keine Gewinninteressen von Kapitaleigentümern berücksichtigt werden müssen; weil Männlichkeitsmuster, die heute schon überholt sind, gar nicht mehr für die Selbsterhaltung der Individuen notwendig sind.
Marx kritisiert, dass die Menschen einander in der bürgerlichen Demokratie nur vermittelt begegnen. Was ist damit gemeint?
Die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse bilden vermittelnde Instanzen wie Staat, Recht oder Geld. Wir begegnen uns ja häufig nicht als Individuen, sondern als Angehörige eines Staates, ziehen dementsprechende Grenzen, weisen Menschen mit dem falschen Pass ab oder nehmen sie auf. Ähnliches passiert am Markt und durch Geld. Wir können am Konsum nicht als Individuen teilnehmen, sondern müssen über Geld als ein Mittel der Allgemeinheit verfügen. Das erlaubt uns, etwas zu kaufen. Wir begegnen uns oder begegnen uns vielmehr nicht als Angehörige von sozialen Klassen. Das bestimmt unsere Kommunikationen, Liebesverhältnisse oder Freundschaften. Dass unsere sozialen Beziehungen über eine dritte Instanz hergestellt werden, ist Marx zufolge ein Hinweis darauf, dass wir immer noch tief in einer religiösen Welt verhaftet sind.
Und warum ist das ein Problem?
Ein Problem ist es deswegen, weil es nicht um unsere Bedürfnisse geht; weil die Vermittlungsinstanzen Eigenmacht entwickeln. Recht kann aufgrund seiner Formalität gewaltsam auf unsere soziale Beziehungen gelegt werden; Geld kann durch Entwicklungen an Geld- und Kapitalmärkten entwertet werden; aufgrund von Kapitalmacht werden wichtige Güter nicht erzeugt. Die Erzeugung von Reichtum führt bei vielen zu Armut und ökologischer Zerstörung. Die Eigendynamik der dritten Instanzen verhindert, dass die Menschen die Kontrolle über die Verhältnisse erlangen, auch wenn sie sich, wie Kapitaleigentümer oder Politiker, mächtig fühlen mögen.
Bedeutet diese Vermittlung Entfremdung?
Ich denke, das Konzept der Entfremdung trifft nicht, was Marx im Sinne hat. Entfremdung geht von einem Wesen aus, das wir als Menschen verlieren. Marx begreift im Laufe seiner Forschung, dass es nicht um Anthropologie geht, sondern um konkrete historische soziale Verhältnisse, in denen es zu Verkehrungen kommt, zu religiösen Intermediären. Aber es geht widersprüchlich zu. Denn im kapitalistischen Prozess erzeugen wir auch Reichtum, entfalten wir, wenn auch auf sehr ungleiche Weise, individuelle Freiheitsmöglichkeiten. Die Kulturkritik der Kategorie »Entfremdung« verdunkelt zentrale Aspekte des Kapitalismus.
Wie können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die diese Vermittlung überwindet?
Ob und wie das möglich ist, ist eine große Frage. Gerade sind wir Zeugen, wie aus liberalen Gesellschaften das autoritäre Versprechen der Unmittelbarkeit hervorgeht. Trump redet wie seinerzeit Hitler: Ich bin eure Stimme, wir brauchen keine politischen Prozesse mehr. Letztlich lehnt er Wahlen ab. Allerdings ist das kein Ende der Vermittlung, sondern eine maximale Trennung der Entscheidungsprozesse von der Gesellschaft. Marx hat demgegenüber die Ausdehnung von Wahlen auf alle Gebiete gefordert. Das wäre für ihn ein Schritt zur Rücknahme der Politik in die Gesellschaft. Demnach soll niemand die Möglichkeit einer solchen Machtusurpation erhalten, direkt und unmittelbar das Allgemeine zu verkörpern. Wie die konkrete Koordination aussieht, wenn die politische Vermittlung wegfällt, ist eine andere Frage.
Wie könnte man auf diese Frage antworten?
Marx sah etwa die Pariser Kommune von 1871 als Positivbeispiel an: Entscheidungen auf kommunaler Ebene durch gewählte Vertreter, die jederzeit kontrolliert und absetzbar wären. Ich selbst habe mich viel mit Fragen der Basis-, Räte-, Wirtschaftsdemokratie befasst und denke, die Rücknahme der Politik in die Gesellschaft bedeutet, einen anderen Modus der Entscheidungen über unsere Lebensgrundlagen zu finden. Dabei geht es um Fragen wie: Welches Verhältnis zur Natur wollen wir eingehen? Wie organisieren wir Wohnen, Arbeiten und Mobilität? Heute passiert all das nach Gesichtspunkten des Gewinns, koordiniert von einer kleinen Zahl an Managern, die von der Komplexität der Prozesse völlig überfordert sind. Wir könnten all das besser kollektiv und zu unserem Wohle koordinieren. Dazu würde gehören, neue Formen sozialer Differenzierung zu entwickeln, die übergreifendes Entscheiden ermöglichen.

Alex Demirović
Die liberalen Demokratien des Westens werden zunehmend autoritärer. Hilft uns Marx dabei, diesen Rechtsdrall zu verstehen?
Mit Marx kann man die Grundprozesse verstehen, die dem zugrunde liegen. Er selbst hat die Erfahrung des Bonapartismus gemacht, einer gewählten Regierungsperson, die ihre Macht dazu nutzt, den Staat zu usurpieren. Marx betont, dass solch ein Staatsstreich kein beliebiger Zufall, sondern eine »Strukturgesetzlichkeit« ist. Seit der Französischen Revolution treten solche autoritären, konterrevolutionären Praktiken des Bürgertums zyklisch immer wieder auf. In Anschluss an Marx hat es viele Versuche gegeben, die Phänomene der Militärdiktaturen, Faschismen oder autoritärer Populismen zu erklären. Um zu verstehen, welche autoritären Muster, welche Gewalt in der Politik, in der Ökonomie und im Alltag der bürgerlichen Gesellschaften latent angelegt sind – und dann politisch immer wieder manifest werden. Marx selbst liefert wichtige Einsichten, aber keine Theorie für das Problem, mit dem wir seit Jahrzehnten konfrontiert sind.
Und doch sucht die Leserin Antworten in Ihrem Buch, weil sich gegenwärtig wieder die drängende Frage stellt: Wie sollten es Linke mit der liberalen Demokratie halten, verteidigen sie diese gegen reaktionäre Angriffe oder hüten sie sich davor, weil sie in ihr eine Form bürgerlicher Herrschaft entdecken?
Diese schwierige Frage hat auch Marx und Engels immer wieder umgetrieben. Schließlich haben Adel und Teile des Bürgertums auch zu ihrer Zeit die Demokratie angegriffen. Die beiden würden argumentieren: »Wir verteidigen die Republik und ihre Institutionen; das Recht, die Stimme zu erheben und auf die Straße zu gehen, um die Verhältnisse zu verändern.« Liberale würden dann entrüstet entgegnen: »Ihr habt nur ein instrumentelles Verhältnis zur Demokratie.« Allerdings haben sie selbst ein zutiefst instrumentelles Verhältnis zur Demokratie und geben die Institutionen der repräsentativen Demokratie schnell auf, wenn sie nicht mehr marktkonform oder opportun sind. Die Bürgerlichen treten vor der Revolution von 1848 viele Jahre lang für Demokratie ein. Doch bei der erstbesten Möglichkeit, sie zu verwirklichen, geben sie sie wieder auf und unterwerfen sich dem König von Preußen und dem Kaiser in Wien. Aus Angst vor Eigentumsverlusten kuschen sie. Das ist auch heute wieder beobachtbar, wenn man die Spitzen der US-Wirtschaft bei der Inauguration von Trump klatschen sieht.
Müssen wir also das instrumentelle Verhältnis zu den demokratischen Institutionen überkommen?
Klar wollen wir demokratisch leben. Aber demokratische Institutionen sind kein Selbstzweck, sondern dazu da, unser Leben besser, freier zu organisieren. Und deshalb ist die Frage immer, inwieweit sie uns dabei helfen, das zu erreichen – oder nicht. Die in den demokratischen Institutionen heute vorhandenen Qualitäten und Freiheiten müssen wir auf jeden Fall verteidigen, aber nicht jede demokratische Institution muss aus Prinzip verteidigt werden. Vielmehr geht es um eine freie und offene Weiterentwicklung von Demokratie – was einschließt, dass wir über die Art, wie und was wir produzieren, welche Ressourcen wir wofür in welchem Umfang verwenden, gemeinsam entscheiden. Demokratische Verfahren sollen uns dies ermöglichen.
Ist der Sozialismus eine verwirklichte Demokratie?
Das haben manche argumentiert. Etwa Oskar Negt, der meinte: »Keine Demokratie ohne Sozialismus, kein Sozialismus ohne Demokratie«. Und ich hege gewisse Sympathien mit diesem Standpunkt. Aber Marx war wichtig, dass der Sozialismus nicht einfach die Verwirklichung von Demokratie ist. Demokratie ist nicht der normative Maßstab, sondern ein Moment einer sich selbst bestimmenden Gesellschaft. Das ist nicht Transparenz, ständiges Entscheiden, Gesellschaft als Wille. Marx spricht davon, dass wir neue spontane Gesetzmäßigkeiten in unseren Gesellschaften auf der Basis der gesellschaftlichen Arbeit brauchen. Gegenwärtig verlassen wir uns auf die spontane Gesetzmäßigkeit der Märkte und des Gewinns.
Worin bestünden spontane Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus?
Alle könnten darauf Einfluss nehmen, diese spontanen Gesetzmäßigkeiten zu ändern. Demgegenüber wird uns heute gesagt, dass diese Gesetze nicht veränderbar sind. Das zieht sich vom Liberalismus bis in die radikale Demokratietheorietheorie. Aber mit Marx würde man fragen: Warum sollten wir sie nicht ändern können?
Wenn sich Sozialistinnen nicht als Demokratinnen behaupten, sich nicht die Ideen der Freiheit und Gleichheit aneignen, überlassen Sie diese Ideale dann nicht kampflos den Liberalen?
Kritik, bestimmte Negation dieser Begriffe bedeutet ja gerade nicht, sie im Niemandsland stehen zu lassen, sondern sie als kollektive Praktiken zu erschließen. Gleichheit hat so viel ideologische Evidenz. Sie bedeutet, alle Individuen an einem gleichen Maß zu messen und sie gegebenenfalls daran anzupassen. Dieser Normalismus kann extrem gefährlich sein. Denn Menschen sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich, und das ist auch bewahrenswert. Es geht, um mit Theodor W. Adorno zu sprechen, darum, ohne Angst, anders sein zu können. So verstehe ich auch Marx: Er versteht unter Kommunismus nicht, dass alle als Gleiche leben sollen, sondern alle nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten. Es ist kein fauler Trick, sondern Dialektik: Ja, wir sollten um Freiheit, Gleichheit und Demokratie kämpfen. Alles andere wäre idiotisch. Aber dabei möchte Marx nicht stehenbleiben, sondern weiterdenken. Es geht um die Frage, warum wir auch heute, nach so viel Fortschritt, Aufklärung, Reichtum, immer noch unsere Freiheit und Gleichheit bedroht sehen, und um die Antwort: dass wir darum einmal nicht mehr kämpfen müssen.
 Lesezeit 12 Minuten
Lesezeit 12 Minuten