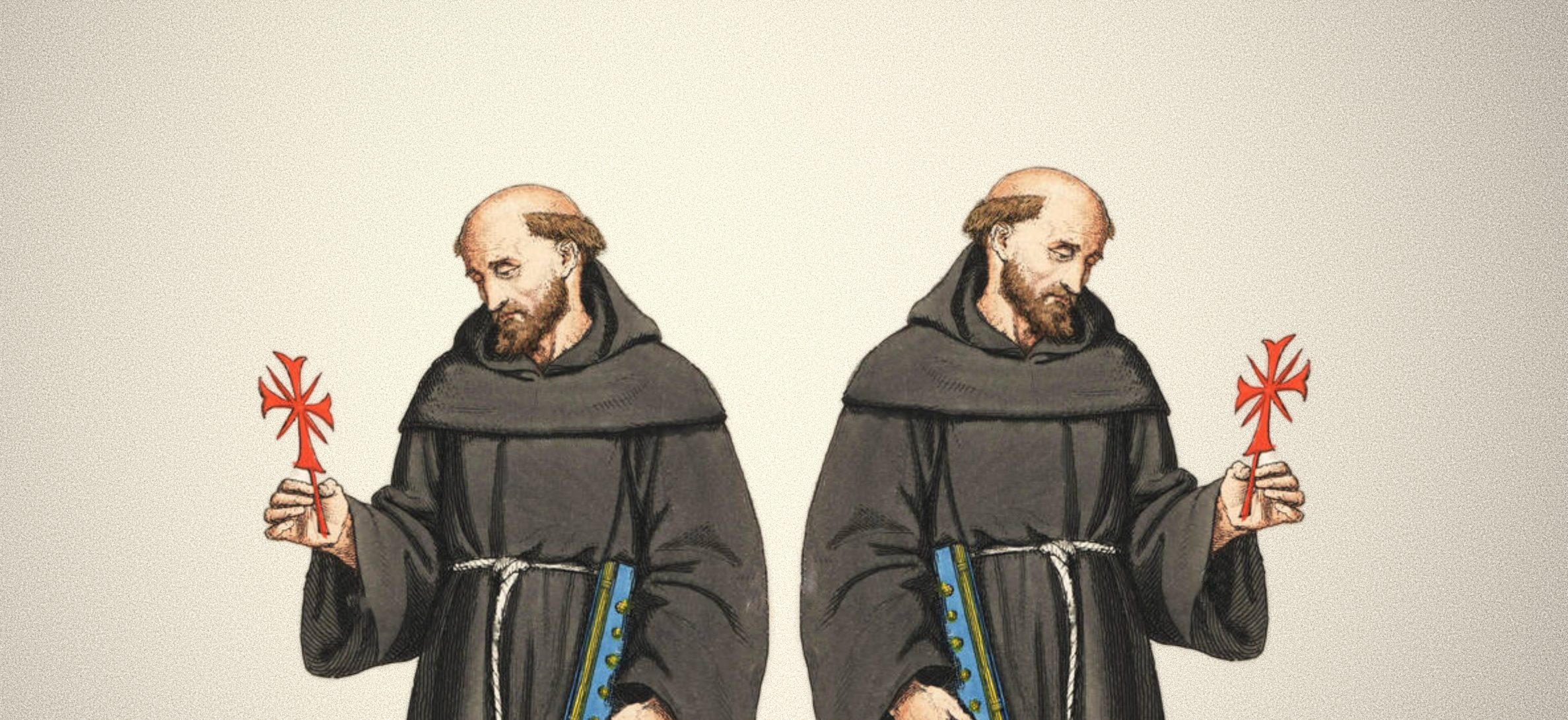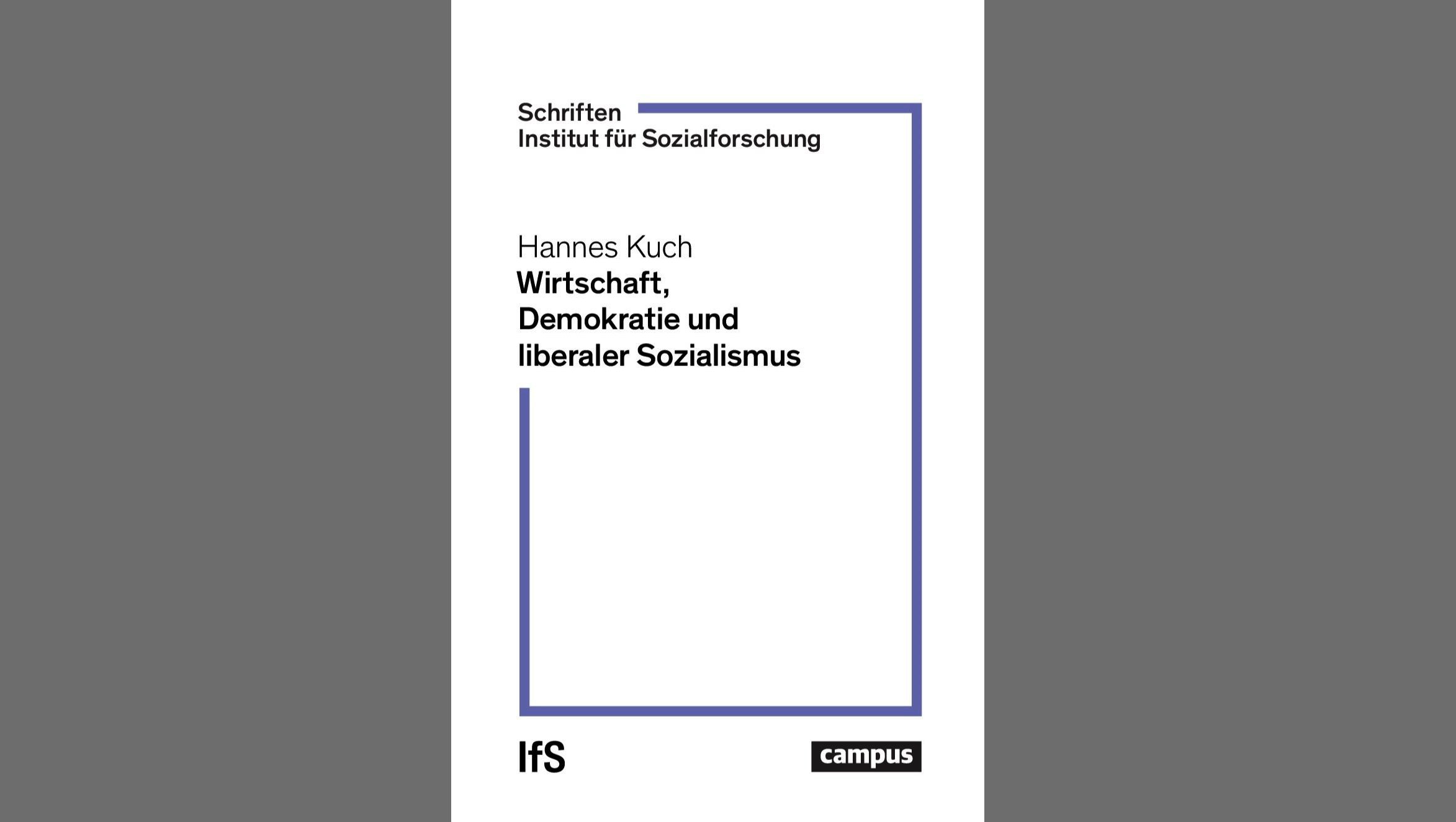
Die Sittlichkeit der Genossenschaft
Hannes Kuch hat eine politisch-ökonomische Theorie des liberalen Sozialismus vorgelegt. Seine Studie ist beeindruckend und zeigt worüber die Linke heute nachdenken muss, schreibt Matthias Ubl.
Der Kapitalismus befindet sich im Zeitalter seiner ökologischen Selbstzerstörung – und gleichzeitig wird fast nirgendwo öffentlich und systematisch über wirtschaftliche Alternativen nachgedacht. Der Engel der Geschichte blickt Walter Benjamin zufolge in die Vergangenheit – und sieht dort »eine einzige Katastrophe«. Wir schauen heute in die Zukunft und sehen dort nur »Trümmer auf Trümmer«. »Es gibt keine Alternative«: Das ist die wahrscheinlich wirkmächtigste Ideologie unserer Zeit.
Der Philosoph Hannes Kuch hat in dieser Situation ein bedeutendes Buch geschrieben – Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus. Dieses Werk ist ein Durchbruch und sollte zu einer zentralen Referenz für die sozialistische Linke werden. Kuch nimmt eine längst überfällige Neujustierung der Kritischen Theorie vor, indem er die grundlegenden Parameter einer sozialistischen Wirtschaftsdemokratie neu vermisst. Das Buch ist befreiend, weil es zeigt, dass man auf Höhe der politischen und ökonomischen Probleme über eine demokratische Wirtschaftsform nachdenken kann – ohne in ideologische Reflexe zu verfallen. Kuch gelingt dabei nicht weniger, als sozialistische und liberale Theoriebildung in einen versöhnlichen Dialog zu bringen.

Matthias Ubl
Hegels Rechtsphilosophie als Ausgangspunkt
Ein zentraler Referenzpunkt ist für Hannes Kuch Hegels Rechtsphilosophie. Kuch zufolge bietet Hegel – entgegen der in den letzten Jahrzehnten dominanten systemtheoretischen Soziologie – ein philosophisches Modell dafür, wie die Systemlogiken von Politik und Ökonomie ineinandergreifen können. Es geht darum, wie demokratische Politik die Wirtschaft so gestalten kann, dass sie nicht – wie im real existierenden Kapitalismus – ökologische Zerstörung, extreme Ungleichheit und faschistische Tendenzen hervorbringt.
In präziser und sprachlich klarer Lektüre zeigt Kuch, dass Hegel nicht für eine Trennung von Staat und Wirtschaft eintritt, sondern für deren Ineinandergreifen – bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen Logiken und Potenziale. Darin liegt das unabgegoltene Potenzial von Hegels Rechtsphilosophie. Denn in einer alternativen Wirtschaftsform müssen sich demokratische Politik und demokratische Wirtschaft gegenseitig stabilisieren. Bei Hegel sind es Institutionen wie die Kooperation, in der die berechtigt egoistischen Marktteilnehmer Gemeinsinn einüben sollen. Kuch untersucht im zweiten Teil des Buches, welche Institutionen das heute sein können – etwa Genossenschaften.
Die zentrale Erkenntnis Hegels besteht für Kuch darin, dass die ökonomische Welt als Bildungsinstitution verstanden werden muss. Arbeit prägt und formt uns ideologisch. Unsere Tätigkeit findet im Kontext einer umfassenden Vermarktlichung statt, die bestimmte Spielregeln setzt und spezifische Verhaltensweisen belohnt oder sanktioniert. Auf Grundlage zahlreicher sozialpsychologischer Studien zeigt Kuch, dass »marktförmige Praktiken« Fairnessnormen und solidarische Potenziale tendenziell zurückdrängen.
Am Arbeitsplatz bewegen wir uns daher zumeist in einem Umfeld, in dem unkooperatives Verhalten belohnt und Ausbeutung normalisiert wird. Kuch verweist auf Experimente mit »Öffentliche-Güter-Spielen«, die zeigen: Menschen passen ihr Verhalten nach unten an, wenn die Spielregeln unfaires Verhalten nahelegen. Weiterarbeiten trotz Krankheit wie in der Pflege? Demütigungsrituale wie bei Amazon?
Kuch zufolge erzeugen Marktgesellschaften nicht selten »Machtstreben oder Rücksichtslosigkeit«. Diese Eigenschaften werden sogar zu »Tugenden« umgedeutet – etwa als »Führungsstärke« oder »disruptive Kreativität«. Demokratische Politik soll eigentlich in deliberativen Prozessen und kooperativer Gestaltung die Spannungen der von Ausbeutung und Egoismus geprägten Marktgesellschaft regulieren. Doch die Realität blamiert seit Jahrzehnten dieses Ideal.
Im Neoliberalismus wurden die potenziellen Verwerfungen der Marktgesellschaft nicht korrigiert und eingehegt, sondern verschärft. Der Markt bildet vor allem in seiner neoliberalen Radikalisierung den »Keimboden autoritärer Deutungsmuster: Den Akteuren wird Ehrfurcht gegenüber Stärkeren und Verachtung gegenüber Schwächeren gelehrt.« Der Aufstieg des neuen Faschismus in Gestalt der »Tech-Broligarchie« aus dem Silicon Valley und des Rechtspopulismus führt das heute klar vor Augen.
Der Zwang zur Konkurrenz, der auf kapitalistischen Märkten herrscht, schafft Anreize, Arbeitsverhältnisse zu deregulieren, staatliche Vorgaben zu umgehen und unfaires Verhalten zu priorisieren. Der Markt ist – das lässt sich schon bei Hegel lernen – immer auch ein gesellschaftlicher Naturzustand. Dass die dazugehörigen Subjekte im Zweifel nicht für die Demokratie einstehen, sondern sie verachten, liegt auf der Hand. Unter Rückgriff auf Studien von Thomas Piketty macht Kuch deutlich, dass das »Zeitalter der Sozialdemokratie«, also die Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1975, in der Ungleichheit stark eingedämmt und wirtschaftsdemokratische Prinzipien durchgesetzt wurden, tatsächlich eine historische Anomalie in der Geschichte des Kapitalismus darstellt. Sie war ganz wesentlich ein Effekt der Verheerungen und Kollektiverfahrungen der Weltkriege. Doch die Zeit des gezähmten Kapitalismus ist längst vorbei. Wir erleben das gerade in voller Brutalität.
Nun haben Märkte sicher nicht nur negative Effekte, vor allem nicht, wenn man ihre historische Genese betrachtet. Sie können durchaus dazu beitragen, die Individualität zu fördern und persönliche Unabhängigkeit zu ermöglichen – etwa von traditionellen Bindungen und Zwängen. An diesem Potenzial gilt es nach Kuch festzuhalten, ohne zu übersehen, dass die sittlichen Pathologien von Marktgesellschaften heute überwiegen.
Sittlichkeit als zentrale Kategorie
Sittlichkeit ist dann auch die zentrale Kategorie, die Kuchs Studie immer wieder umkreist – und von der seine Bewertung alternativer Wirtschaftsformen abhängt. Hier liegt die eigentliche Originalität des Buches. Kuch fragt nicht einfach nur, wie Ausbeutung und Ungleichheit eingedämmt werden können, sondern wie eine Ökonomie ein demokratisches Ethos hervorbringen kann, das demokratische Verhältnisse dauerhaft stabilisiert.
Sittlichkeit meint dabei nicht bloß ein Set kognitiver Überzeugungen – etwa, dass Demokratie schützenswert oder moralisch überlegen sei –, sondern zielt tiefer auf die verkörperten Eigenschaften der Einzelnen ab, die wiederum durch gesellschaftliche Institutionen und deren Logiken hervorgebracht werden. Sittlichkeit wird durch Fähigkeiten realisiert, die erlernt werden müssen. Ein Beispiel wäre die Fähigkeit, sich reflektiert und selbständig mit den Positionen verschiedener Parteien auseinanderzusetzen und auf dieser Grundlage eine Wahlentscheidung zu treffen. Das zeigt, dass solche Fähigkeiten institutionell gestützt werden müssen, etwa durch eine funktionierende Medienlandschaft, die politische Positionen aufbereitet.
Sittlichkeit ist also Produkt von Sozialisation und dem Erlernen bestimmter Praktiken innerhalb gesellschaftlicher und ökonomischer Institutionen. Sie wird alltäglich neu eingeübt und »von unten her gelebt«, wie Kuch schreibt. Gleichzeitig eröffnet sie Freiheit.
Die zentrale Frage ist für Kuch also, wie eine Wirtschaft aussieht, die demokratische Tugenden hervorbringt? Im letzten Teil seines Buches untersucht er zwei Formen der Wirtschaftsdemokratie, die das Potenzial haben, die kapitalistische Trennung von Arbeit und Kapital zu überwinden – und dabei eine demokratische Sittlichkeit zu fördern. Er diskutiert »ökonomische Institutionen wie Genossenschaften, Kollektivbetriebe, öffentliche Eigentumsformen oder wirtschaftsdemokratische Prozeduren«. Dabei stellt er zwei konkurrierende Modelle gegenüber: die von John Rawls favorisierte Eigentümerdemokratie und der liberale Sozialismus, der vor allem in der Tradition des analytischen Marxismus entwickelt wurde.
Liberalismus und Sozialismus zusammendenken
Die von Rawls konzipierte Eigentümerdemokratie soll einerseits die Freiheitsvorteile von Marktgesellschaften bewahren, andererseits die Trennung von Kapital und Arbeit aufheben. Eine staatliche Investmentagentur würde im Namen der Bürgerinnen und Bürger ein breit diversifiziertes Aktienportfolio halten, wie es der Ökonom Alan Thomas vorgeschlagen hat. Jedes Gesellschaftsmitglied wäre Anteilseigner – eine Gesellschaft demokratischer Aktionäre. Kuch kritisiert allerdings, dass innerhalb der Unternehmen der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital fortbestehen würde. Aus sittlichkeitstheoretischer Perspektive bleibt hier ein Defizit, da dieses Modell kaum deliberative Kompetenzen der Beschäftigten fördert – und somit keine wirklich demokratische Subjektivität hervorbringt.
Demgegenüber entwickelt Kuch den liberalen Sozialismus, der auf der Verallgemeinerung real existierender Genossenschaftsmodelle basiert. Arbeitende halten hier Betriebseigentum, sind an den Profiten beteiligt und haben demokratische Mitspracherechte. Dieses Prinzip, das längst Realität ist – etwa bei Spaniens siebtgrößtem Unternehmen, der Genossenschaft Mondragón Corporación Cooperativa – soll durch einen »sozialistischen Finanzmarkt« ergänzt werden. Dieser würde das dezentrale Sammeln von Informationen über die Leistungsfähigkeit von Unternehmen ermöglichen und so Zentralismus, Bürokratie und Ineffizienz verhindern.
Aus sittlichkeitstheoretischer Perspektive ist der liberale Sozialismus als »reale Utopie« gegenüber der Eigentümerdemokratie im Vorteil, da er demokratische Sittlichkeit am Arbeitsplatz in den Unternehmen fördert und zugleich für eine gerechte Eigentumsverteilung sorgt. Die Stärke von Kuchs Diskussion beider Konzepte liegt zudem darin, dass er ökonomische Kriterien wie Effizienz und unternehmerische Innovation im Blick behält. Denn eine sozialistische Wirtschaft, die nicht funktioniert, ist keine Alternative. Kuch schafft es daher mit seinem Buch, die Frage nach einer alternativen Wirtschaftsform endlich auf der Höhe des Problems im deutschen Diskurs zu diskutieren. Sowohl Ökonominnen, Soziologinnen als auch Philosophen dürften von seiner Arbeit profitieren. Es ist Kuchs Werk zu wünschen, dass es als Ausgangspunkt für die ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem zentralen Problem unserer Zeit dient: der wirtschaftlichen Alternative zum neoliberalen Kapitalismus.
Kuchs Buch ist tatsächlich befreiend, weil es das emanzipatorische Potenzial des Liberalismus als auch des Sozialismus gleichermaßen ernst nimmt und zeigt, dass es Emanzipation nur dann gibt, wenn beide zusammenfinden. Sowohl ernstmeinenden Liberalen als auch kämpferischen Sozialistinnen sollten Kuch dringend lesen, um ihre jeweiligen blinden Flecken zu erhellen. Wer den Rechtsstaat und liberale Freiheitsrechte erhalten will, muss für die Demokratisierung der Wirtschaft eintreten. Und umgekehrt darf, wer ein Ende von Ausbeutung und Ungleichheit will, liberale Freiheitsrechte nicht als ideologisches Beiwerk betrachten, sondern als unhintergehbare Bedingung von Freiheit. Kuchs Buch lehrt uns, beide Perspektiven zu vereinen.
 Lesezeit 8 Minuten
Lesezeit 8 Minuten