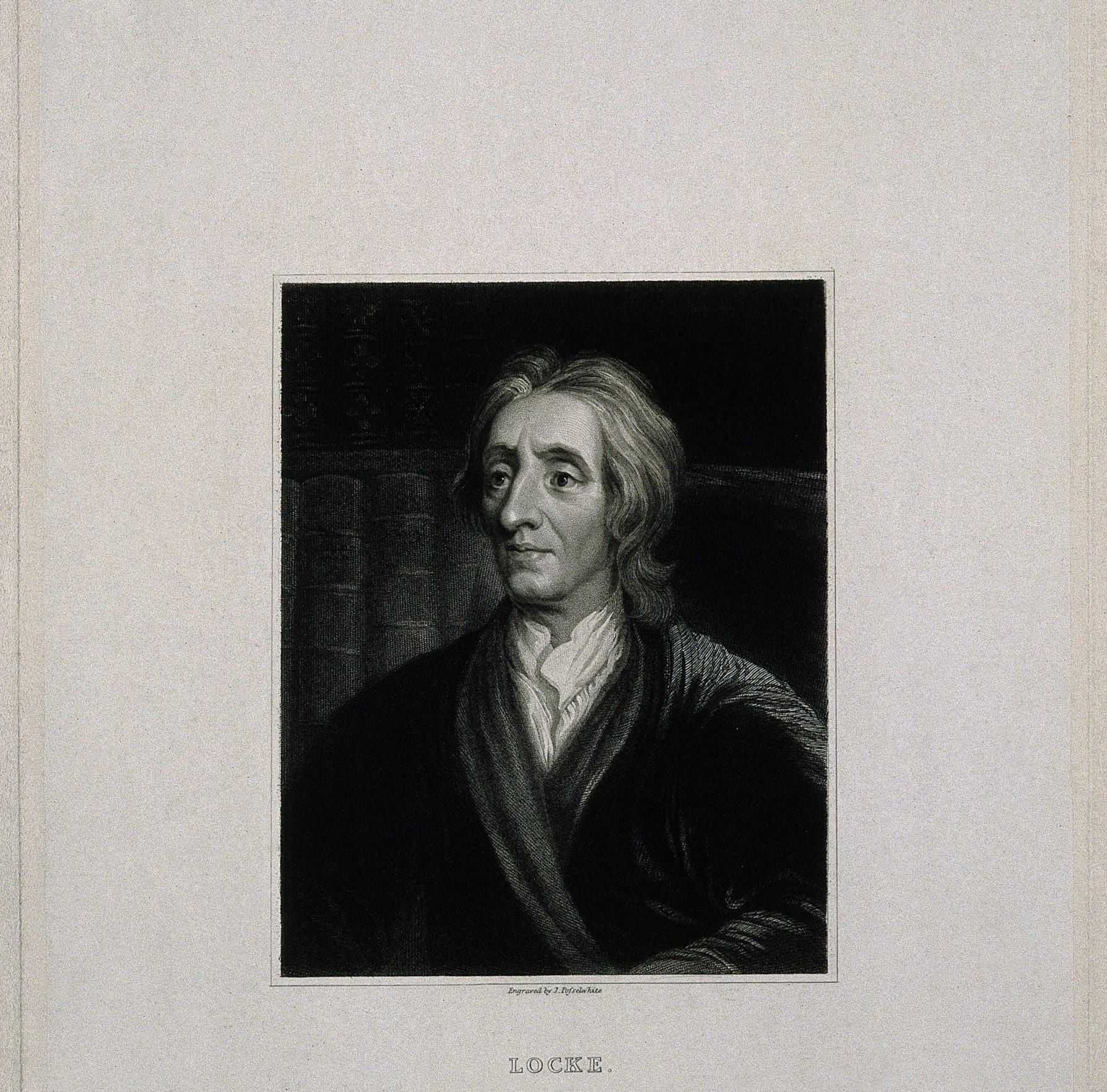
John Locke, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Wer nicht produktiv ist, gehört nicht dazu
Leistung gilt als moralischer Maßstab unserer Gesellschaft. Wer arbeitet, gehört dazu – wer nicht arbeitet, steht unter Verdacht. Diese Logik prägt nicht nur die aktuelle Bürgergelddebatte, sondern reicht bis zu den liberalen Grundannahmen eines John Locke zurück, schreibt Otmar Tibes.
Wenn in Deutschland über das Bürgergeld oder die jüngst vom Bundeskabinett beschlossene Grundsicherung diskutiert wird, fällt ein Wort mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit: Leistung. Wer arbeitet, so lautet die gängige Erzählung, trägt zur Gesellschaft bei. Wer nicht arbeitet, leistet auch nichts und muss vom Staat motiviert, kontrolliert oder eben auch sanktioniert werden. Hilfe darf es geben – aber nur, wenn sie »Anreize« setzt. Andernfalls, so die Warnung, drohen Trägheit und sozialer Missbrauch.
Diese Sichtweise wirkt wie eine zeitgenössische. Tatsächlich aber ist sie älter, als man denkt. Ihre theoretischen Wurzeln reichen bis in die Frühzeit des Liberalismus – zu John Locke, einem der einflussreichsten politischen Denker des Liberalismus. Wer verstehen will, warum Armut bis heute so leicht zu Abwertung führt, muss den Liberalismus und das liberale Menschenbild kennen. Denn diese Abwertung ist kein Missverständnis oder Zufall, sondern geht aus den zentralen Annahmen des Liberalismus hervor. Leistung, Eigenverantwortung und Produktivität gelten hier nicht nur als ökonomische, sondern auch als moralische Maßstäbe.
Lockes Menschenbild und Eigentumstheorie
Locke gilt als liberaler Vordenker individueller Freiheit. Er begründete das moderne Recht auf Eigentum, auf Selbstbestimmung, auf Schutz vor staatlicher Willkür. Doch diese Freiheit ist bei ihm nicht voraussetzungslos. Sie ist an eine Bedingung geknüpft: an Produktivität. Freiheit ist bei Locke also nicht einfach die Abwesenheit von Zwang, sondern Ausdruck einer bestimmten Lebensführung – aktiv, rational, zweckorientiert. Wer diese Form der Lebensführung nicht verwirklicht, fällt aus dem moralischen Ideal heraus, das dem liberalen Freiheitsversprechen zugrunde liegt.
Lockes berühmte Eigentumstheorie besagt, dass Eigentum dort entsteht, wo Menschen Land bearbeiten, nutzen und dadurch zu ihrem Eigentum machen. Arbeit ist bei Locke mehr als bloß eine ökonomische Tätigkeit. Sie ist ein moralischer Akt. Sie verwandelt rohe Natur in Wert – und den Menschen in ein verantwortliches Subjekt. Freiheit, Eigentum und Anerkennung entstehen nicht aus der bloßen menschlichen Existenz, sondern aus aktiver, produktiver Tätigkeit.
Brachliegendes Land hingegen gilt als Verschwendung. Es widerspricht, so Locke, dem göttlichen Auftrag, die Erde sinnvoll zu nutzen. Genau hier wird seine Theorie politisch folgenreich. Locke verweist ausdrücklich auf Nordamerika: Die indigenen Völker nutzten große Flächen für die Jagd und das Sammeln von Nahrung, betrieben aber keinen Ackerbau und ließen das Land weitgehend unberührt. Für Locke war das kein vollwertiger Besitz. Englische Kolonisten, die dasselbe Land intensiv bewirtschafteten, schufen mehr Ertrag – und durften es daher moralisch legitim übernehmen.

Otmar Tibes
Enteignung erschien so nicht als Unrecht, sondern als Fortschritt. Gewalt wurde in Produktivität übersetzt, Aneignung in moralische Verbesserung. Entscheidend an dieser Argumentation ist aber nicht ihr historischer Kontext, sondern ihre Verallgemeinerungsfähigkeit. Die Unterscheidung zwischen sinnvoller und sinnloser Nutzung, zwischen produktiven und unproduktiven Lebensweisen lässt sich jederzeit auf andere Gruppen, andere Lebensweisen und andere gesellschaftliche Konstellationen übertragen. Sie bildet den normativen Kern eines Liberalismus, der Freiheit an Leistung knüpft.
Locke behauptet zwar nirgendwo offen, dass indigene Völker weniger wert seien. Doch seine Theorie führt genau zu diesem Ergebnis. Wer produktiv ist, gilt als vernünftig, verantwortungsvoll, zivilisiert. Wer nicht produktiv ist, erscheint als rückständig, verschwenderisch, unzivilisiert. Produktivität wird also zum Maßstab gesellschaftlicher Anerkennung. Der Liberalismus unterscheidet nicht explizit zwischen wertvollen und wertlosen Menschen. Er unterscheidet jedoch zwischen produktiven und unproduktiven Lebensweisen – und zieht daraus normative Konsequenzen.
Wer nicht produktiv ist, verliert zum Beispiel Ansprüche. Bei Locke betraf das Land: Wer es nicht produktiv nutzte, sollte es abgeben oder verlieren dürfen. Später verlagerte sich dieser Ausschluss auf die politische Ebene. Das Wahlrecht war in bürgerlichen Republiken lange an Eigentum und wirtschaftlicher Unabhängigkeit geknüpft. Wer arm oder abhängig war, galt nicht als vollwertiges Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft. Heute zeigt sich dieselbe Logik in gewandelter Form: Wer auf Hilfe vom Staat angewiesen ist, verliert zwar nicht sein Wahlrecht, steht aber unter dauerhaften Misstrauen. Formal bleiben seine Rechte bestehen, soziale Unterstützung steht jedoch unter Vorbehalt.
Die historische Weiterentwicklung
Warum der Maßstab der Produktivität nicht auf Lockes Zeit beschränkt geblieben ist, sondern sich bis in unsere Zeit durchgehalten hat, kann man mit der Industrialisierung und dem Aufstieg der politischen Ökonomie erklären. Diese hat den Maßstab der Produktivität nicht nur ökonomisch begründet, sondern auch moralisch abgesichert. Bereits Adam Smith betont im Wohlstand der Nationen, dass Arbeit die zentrale Quelle des gesellschaftlichen Reichtums ist und dass die Produktivität darüber entscheidet, wie wohlhabend eine Gesellschaft wird. Smith unterscheidet dabei ausdrücklich zwischen produktiver Arbeit, die Wert schafft, und unproduktiver Arbeit, die keinen zusätzlichen Wert erzeugt.
John Stuart Mill führt diese klassische politische Ökonomie fort: In seinen Principles of Political Economy knüpft er explizit an Smith an und behandelt Arbeit als zentrale Voraussetzungen von Produktion, Einkommen und gesellschaftlichem Fortschritt. Disziplin, Fleiß und Leistungsbereitschaft werden so zu bürgerlichen Tugenden erhoben. Der Markt erscheint wiederum als moralische Instanz, die Leistung belohnt und Unproduktivität sanktioniert – scheinbar neutral, tatsächlich normativ hoch aufgeladen.
Max Weber hat danach gezeigt, wie Produktivität im Zuge der protestantischen Ethik moralisch aufgeladen wurde. Arbeit dient nicht nur dem Broterwerb, sondern wird zum Maßstab sittlicher Lebensführung. Wer nicht arbeitet, gerät nicht bloß ökonomisch unter Druck, sondern moralisch auch unter Verdacht. Hannah Arendt wird später kritisieren, dass die moderne Gesellschaft den Menschen auf seine Arbeitsfähigkeit reduziert. Was gesellschaftlich zählt, ist nicht politisches Handeln oder gemeinsame Weltgestaltung, sondern Nützlichkeit. Der Mensch verdient Anerkennung, wenn er funktioniert.
Michel Foucault wird in seinem Spätwerk schließlich zeigen, wie der Neoliberalismus den Menschen als Unternehmer seiner selbst begreift. Sowohl sein Erfolg als auch sein Scheitern werden als persönliche Leistung oder als persönliches Versagen verstanden. So wird soziale Unsicherheit schließlich individualisiert und auch moralisiert. Die gesellschaftlichen Bedingungen des Kapitalismus verschwinden und werden politisch ausgeblendet.
Mit der Industrialisierung, kann man also sagen, verlagerte sich der Maßstab der Produktivität. In den USA blieb Freiheit lange an Landbesitz gebunden, weil Boden verfügbar war. In Europa war das aber nicht möglich: Land war knapp und Produktivität wurde an Arbeit und Gewerbe geknüpft. Was bei Locke das Land war, wurde im 19. Jahrhundert so die Arbeitskraft. Eigentum, Einkommen und Anerkennung richteten sich an der Teilnahme am Produktionsprozess. So verlagerte sich die moralische Aufladung der Produktivität und fand ihr neues Objekt in der Arbeit.
Mit dem Übergang von der klassischen Industriegesellschaft zur heutigen Dienstleistungs- und Wissensökonomie wird dieser Prozess weiter zugespitzt. Während früher Arbeitsplätze, Fabriken und Produktionsprozesse im Zentrum standen, richtet sich der moralische Blick heute auf das Individuum selbst. Produktivität bemisst sich nicht allein an körperlicher Arbeit, sondern an Qualifikation, Verfügbarkeit, Flexibilität und Selbstoptimierung. Der Mensch wird selbst zur zentralen Ressource: sein Verhalten, seine Motivation, seine Erwerbsbiografie.
Bürgergelddebatte
In der heutigen Bürgergelddebatte begegnet uns die alte Denkfigur von Locke in neuer Form. Der Bürgergeldempfänger erscheint als jemand, der eine wichtige Ressource ungenutzt lässt: seine Arbeitskraft. Diese »brachliegende Arbeitskraft« gilt als Problem – ökonomisch, aber auch moralisch. Wer nicht arbeitet, will angeblich nicht arbeiten. Wer hingegen Unterstützung erhält, ohne Leistung zu erbringen, steht unter Generalverdacht. Armut wird so nicht als gesellschaftliche Realität verstanden, sondern als individuelles Fehlverhalten.
An diesem Punkt zeigt sich ein grundlegender Widerspruch. Ein Sozialstaat, der dazu da ist, Menschen sozial abzusichern, richtet seine Hilfe zunehmend an jenen aus, die am wenigsten Hilfe benötigen. Als unterstützungswürdig gelten nämlich vor allem diejenigen, die nur kurzzeitig arbeitslos sind, als gut vermittelbar erscheinen und ihre Bedürftigkeit als Ausnahme erklären können. Wer dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist, scheint hingegen bloß faul und unproduktiv zu sein. Je größer die Bedürftigkeit, desto stärker das moralische Misstrauen. Logisch betrachtet ist das paradox: Ein Sicherungssystem, das denjenigen am meisten vertraut, die am wenigsten bedürftig sind, und wiederum denjenigen am meisten misstraut, die am meisten bedürftig sind, verfehlt seinen Zweck.
Das zugrunde liegende Menschenbild jedoch ist klar: Der Mensch ist vor allem Träger von Leistung. Seine Anerkennung hängt davon ab, ob er verwertbar ist und er sein ihm zugeschriebenes Leistungsversprechen einlöst. Hilfe ist dann kein Recht, sondern ein moralischer Vorschuss, der sich nur lohnt, wenn er in Produktivität zurückgezahlt wird. Deshalb wird über Bürgergeld selten in Kategorien von Würde oder Existenzsicherung gesprochen. Stattdessen dominieren Begriffe wie Anreiz, Sanktionen oder Fehlanreiz. Nicht die Frage, ob Menschen genug zum Leben haben, steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob sie sich »lohnen«.
Vieles wird in dieser Perspektive ausgeblendet: Krankheit, psychische Belastungen, Care-Arbeit, strukturelle Arbeitslosigkeit, fehlende Kinderbetreuung, regionale Ungleichheit, Diskriminierung. Sie tut so, als sei der Arbeitsmarkt ein neutraler Ort, an dem allein der individuelle Wille entscheidet. Vor allem aber verkennt sie eine grundlegende Wahrheit: Der Wert eines Menschen lässt sich nicht an seiner Produktivität messen.
Die geplanten Verschärfungen im Zuge der geplanten Bürgergeldreform folgen der beschriebenen Logik. Man gestaltet den Sozialstaat nicht fürsorglich aus, sondern abschreckend. Mit sozialen Konsequenzen: Wer den Maßstab der Produktivität nicht erfüllt, gilt nicht als Person in schwieriger Lage, sondern als Problem. Wer dann wirklich bedürftig ist, gerät unter Verdacht, bloß faul zu sein und wird stigmatisiert und sanktioniert.
Eine demokratische Gesellschaft sollte sich angesichts zunehmender sozialer Ungleichheit und Armut fragen, ob sie dieses Menschenbild weitertragen will. Ob sie Menschen also nach ihrem Nutzen bewerten will oder nach ihrer Würde, ob Existenzsicherung als Gnade gilt oder als Recht.
Vielleicht ist es an der Zeit, mit Locke und der liberalen Vorstellung zu brechen, dass Freiheit und Anerkennung erst verdient werden müssen. Denn ein Sozialstaat, der nur den Produktiven vertraut, hat bereits aufgehört, sozial zu sein.
 Lesezeit 9 Minuten
Lesezeit 9 Minuten




