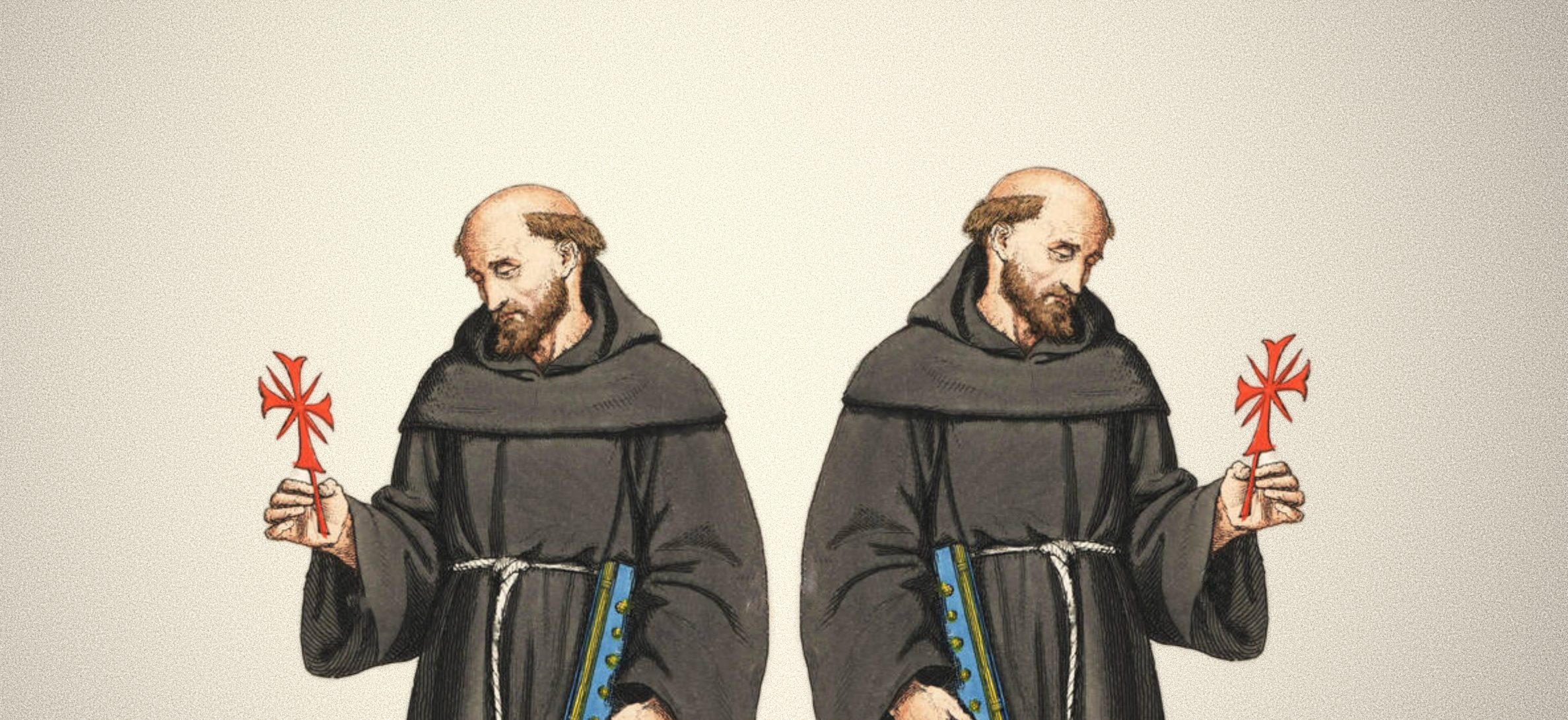Revolution ohne Theorie: Neoliberale Träume und das Problem des Übergangs
Was ist Neoliberalismus? In seinem Beitrag argumentiert Thomas Biebricher, dass der gemeinsame Nenner neoliberalen Denkens nicht in positiven Überzeugungen zu finden ist, sondern in einer geteilten Problematik, was die politischen Vorbedingungen für funktionierende Märkte sind. Laut neoliberalen Denkern ist eines der drängendsten Probleme für funktionierende Märkte die Demokratie.
Es scheint heute kaum einen kontroverseren Begriff zu geben als »Neoliberalismus«. Sogar jene, die sich den Neoliberalismus selbst auf die Fahne geschrieben haben, sehen den Begriff kritisch. Wie »Neoliberalismus« zu verstehen sei und was der Begriff bezeichnet, ist deshalb hoch umstritten. Bezeichnet er vielleicht eine Form von Gouvernementalität 1 Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Lectures at the Collège de France 1978–79. Palgrave. oder steht der Begriff für eine Strategie des globalen Kapitals zur Wiederherstellung und Sicherung von Profitraten? Überhaupt ist umstritten, wie der Neoliberalismus wissenschaftlich untersucht werden soll. Soll er auf der Ebene von Theorien und Argumenten untersucht werden oder besser auf der Ebene eines »real existierenden Neoliberalismus«? 2 Brenner, N., & Theodore, N. (2002). Cities and geographies of ‘actually existing neoliberalism’. Antipode, 34(3), 349–379; Cahill, D. (2014). The end of laissez-faire? On the durability of embedded neoliberalism. Edward Elgar. Oder gehören diese beiden Ebenen nicht zusammen und müssen deshalb in Verbindung miteinander untersucht werden? Inzwischen wird auch darüber gestritten, ob der Neoliberalismusbegriff sich überhaupt noch dafür eignet, die heutige Welt konzeptionell zu begreifen und zu beschreiben. Müsste man nicht vielleicht eher von einem aufkommenden »Post-Neoliberalismus« 3 Davies, W., & Gane, N. (2021). Post-neoliberalism? An introduction. Theory, Culture, Society, 38(6), 3–28. ausgehen, wie ihn manche Theoretiker bereits diagnostizierten haben?
Ich möchte in diesem Beitrag mit einem eigenen Ansatz auf diese Fragen antworten. Dabei werde ich auf eine normative Kritik der neoliberalen Ideen bewusst verzichten und mich stattdessen vor allem deskriptiv-analytisch mit ihnen auseinandersetzen. Mein Gegenstand ist die neoliberale Theorie, so wie sie in den Schriften von Friedrich Hayek, Milton Friedman, den deutschen Ordoliberalen und insbesondere von James Buchanan entwickelt wird. Mein Ziel ist es, den Neoliberalismus an seinen eigenen Standards und Normen zu messen und zu zeigen, dass er diesen entweder nicht gerecht wird oder sich gezwungen sieht, im Versuch, es dennoch zu tun, äußerst problematische Positionen einnehmen muss. Meine Argumentation geht wie folgt: Zunächst möchte ich den kontroversen Begriff des Neoliberalismus theoretisch-historisch situieren. Hierbei nehme ich den Kontext der Entstehung des Begriffs um die Mitte des 20. Jahrhunderts in den Blick. Aus dieser Rekonstruktion folgt, dass wir gut beraten sind, den Neoliberalismus als Begriff nicht allzu eng zu fassen und seine interne Heterogenität nicht herunterzuspielen. Anstatt also zu versuchen, ein Reihe von Doktrinen und Standpunkten als charakteristisch neoliberal herauszuarbeiten oder sie sogar zum »Wesenskern« des Neoliberalismus zu erklären, argumentiere ich, dass der gemeinsame Nenner des neoliberalen Denkens nicht in positiven Überzeugungen zu finden ist, – obgleich auch hier in bestimmten Bereichen signifikante Überschneidungen zu beobachten sind –, sondern vielmehr in einer geteilten Problematik, was die Vorbedingungen für funktionierende Märkte betrifft. Innerhalb dieses Problemfeldes ist die Demokratie laut neoliberalen Denkern eines der drängendsten Probleme.

Thomas Biebricher
Fast alle Neoliberale stimmen darin überein, dass die Demokratie die Aufgabe, funktionierende Märkte zu schaffen und zu sichern, erheblich erschwert. Ausgehend von diesem grundlegenden Konsens gibt es jedoch erhebliche Unterschiede in der spezifischen Diagnose der Dysfunktionen der Demokratie und ihrer Ursachen. Im zweiten Teil meines Arguments werde ich daher einige ausgewählte demokratiekritische Positionen führender Neoliberaler vorstellen. Diese Übersicht wird nicht nur die Heterogenität neoliberalen Denkens zeigen, sondern auch die tiefgreifenden Vorbehalte, die Neoliberale gegenüber der Demokratie hegen, verdeutlichen. Und genauso unterschiedlich wie die konkreten Kritikpunkte an der Demokratie sind, sind es auch die vorgeschlagenen Reformen und Gegenmaßnahmen. In einem weiteren Schritt werden einige dieser Reformvorschläge – vom vagen Ruf nach einem »starken Staat« über Hayeks »Modellverfassung« bis zum konkreten Vorschlag der Einführung einer in der Verfassung verankerten Schuldenbremse (balanced-budget amendment), wie sie insbesondere Buchanan fordert – genauer unter die Lupe genommen. Dieser Überblick macht nicht zuletzt die Radikalität der neoliberalen Reformvorschläge deutlich.
Noch eines vorweg: Trotz der hoch umstrittenen Implikationen dieser Reformvorschläge werde ich bewusst darauf verzichten, diese direkt auf normativer Basis zu hinterfragen. Vielmehr konzentriert sich meine Kritik auf das fehlende analytische Bindeglied zwischen neoliberaler Diagnose und den entsprechenden Heilmitteln. Um dieses fehlende Bindeglied offenzulegen, werde ich im vierten und letzten Teil die Aufmerksamkeit auf die Politik der neoliberalen Transformation lenken – also darauf, ob und wie diese Art von Politik in neoliberalen Theorien konzipiert wird. Hier bestehen wieder entscheidende Unterschiede zwischen Hayek, Eucken und Buchanan. Doch ein gemeinsamer Nenner bleibt: die Unfähigkeit, eine solche Politik theoriebildend zu erfassen, ohne die eigenen Annahmen zu verletzen oder über die Grenzen der liberalen Demokratie hinauszugehen. Meine zentrale These ist daher, dass das neoliberale Denken keine plausible Lösung für das sogenannte Übergangsproblem bietet – sofern es dieses überhaupt reflektiert. 4 Es sollte gleich zu Beginn angemerkt werden, dass das »Übergangsproblem« in einigen Diskussionen unter heutigen Hayekianern thematisiert wird. Für sie ist das Problem jedoch typischerweise ein Wissensproblem, also die Frage, wie ein Sozialtheoretiker wie Hayek überhaupt Reformentwürfe entwickeln kann, wenn man die Einschränkungen durch grundlegende Ignoranz berücksichtigt. Wie im Folgenden klar wird, ist das Übergangsproblem, auf das ich mich beziehe, von etwas anderer Art. Siehe hierzu insbesondere Scheall (2020).
Diese Erkenntnisse führen zu verschiedenen Interpretationen mit mehr oder weniger weitreichenden Implikationen, die im abschließenden Abschnitt diskutiert werden.
Die neoliberale Problematik
Es ist inzwischen zum Gemeinplatz geworden, auf die Inhaltsleere des Neoliberalismusbegriffs mit einer Arbeitsdefinition zu reagieren. Man will sich nicht dem Verdacht aussetzen, mit einem leeren Signifikanten oder mit einem rein politischen (statt analytischen) Begriff zu operieren. Typischerweise wird dann eine Reihe von Politiken – meist im Zusammenhang mit der Agenda des Washington Consensus – als typisch neoliberal identifiziert. Bestimmte Ideen oder Prinzipien werden so als Kern des Neoliberalismus angesehen oder aber, der Neoliberalismus wird einfach als das definiert, was Mitglieder der Mont Pèlerin Society propagieren. Das sind zwar elegante Methoden, um das eigentliche Problem zu umgehen, analytisch überzeugend sind sie aber nicht. 5 Chomsky, N. (1999). Profit over people: Neoliberalism and global order. Seven Stories Press; Crouch, C. (2011). The strange non-death of neoliberalism. Oxford University Press; Mirowski, P., & Plehwe, D. (Eds.). (2009). The road from Mont Pèlerin: The making of the neoliberal thought collective. Harvard University Press. Gleichzeitig wird von wissenschaftlicher Seite regelmäßig darauf hingewiesen, dass der Neoliberalismus enorm variabel und anpassungsfähig ist. Besonders die Möglichkeit, mit anderen politisch-intellektuellen Projekten fruchtbare Verbindungen einzugehen, lässt es unmöglich oder zumindest intellektuell unredlich erscheinen, eine echte Definition anzustreben, die den Neoliberalismus und seine Bedeutung(en) festschreiben würde. Wie Peck es formuliert: »Klare, unzweideutige und auf das Wesentliche reduzierte Definitionen von Neoliberalismus haben sich als trügerisch erwiesen.« 6 Peck, J. (2010). Constructions of neoliberal reason. Oxford University Press. S. 8.
Ich schlage in diesem Beitrag einen Mittelweg ein. Mit diesem vermeide ich einerseits reduktionistische Definitionen, andererseits gehe ich auch nicht von einem Neoliberalismusbegriff aus, der sich aus einer Vielzahl verschiedener Neoliberalismen zusammensetzt, und der bestenfalls von dem Wittgenstein’schen Konzept der Familienähnlichkeit zusammengehalten wird. Stattdessen ist mein Ausgangspunkt die Beobachtung, dass der Begriff »Neoliberalismus« heutzutage oft negativ besetzt oder gar politisch toxisch ist. Deshalb ist es sinnvoll, genauer zu betrachten, wie diejenigen, die sich selbst – sei es auch nur kurzzeitig oder widerwillig – als »neoliberal« bezeichnet haben, diesen Begriff verwendet haben. Von hier aus können wir das intellektuelle und politische Programm des Neoliberalismus nachzuvollziehen. Mit anderen Worten: Um den Neoliberalismus zu verstehen, ist es notwendig, den ideengeschichtlichen und politischen Kontext der Entstehung des Neoliberalismus zu rekonstruieren.
Obwohl Begriffe im Allgemeinen häufig keinen einheitlichen Ursprung haben und ihre Entstehungsgeschichte komplex ist, kann das Colloque Walter Lippmann als die »Geburtsstätte« des Neoliberalismus im Sinne eines ersten Kulminationspunktes seiner Geschichte bezeichnet werden. Auf diesem Kolloquium, das vom 26. bis 30. August 1938 in Paris stattfand, ist der Begriff zum ersten Mal offiziell verwendet worden – als eine von praktisch allen Anwesenden geteilte Agenda. Zu diesen Teilnehmern gehörten nicht nur Hayek, Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow, sondern auch Jacques Rueff, Louis Rougier (der das Treffen einberufen hatte) und natürlich Walter Lippmann selbst. Es existieren inzwischen mehrere eindrucksvolle Arbeiten zu diesem Kolloquium, deshalb sparen wir uns hier ein näheres Eingehen auf seinen Ablauf. 7 Siehe stattdessen Burgin, A. (2012). The great persuasion: Reinventing free markets since the depression. Harvard University Press; Dardot, P., & Laval, C. (2013). The way of the world: On neoliberal society. Verso; Innset, O. (2020). Reinventing liberalism. The politics, philosophy and economics of early neoliberalism (1920–1947). Springer; Reinhoudt, J., & Audier, S. (Eds.). (2018). The Walter Lippmann Colloquium: The birth of neo-liberalism. Palgrave. Was sich im Rahmen des Kolloquiums abzeichnete, war das Bild eines Liberalismus, der in die Defensive geraten, zugleich aber bestrebt war, seinen alten Rang gegen theoretische Konkurrenten wie dem Keynesianismus – damals noch in geringerem Maße –, und vor allem dem Kollektivismus zu verteidigen. In den Augen fast aller Teilnehmer außer Ludwig von Mises setzte dieses Vorhaben eine kritische Revision der klassischen liberalen Agenda voraus, vor allem die Aufgabe einfacher Formeln wie »Laissez-faire« oder das, was manche als »Manchesterismus« bezeichneten. 8 Selbst Hayek, den viele als eine Art Libertären sehen, schrieb in »Der Weg zur Knechtschaft«, veröffentlicht 1944: »Wahrscheinlich hat nichts der liberalen Sache so sehr geschadet wie das starre Bestehen einiger Liberaler auf bestimmten groben Daumenregeln, insbesondere dem Prinzip des Laissez-faire« (Hayek, 2001, S. 18). Der sich hier formierende neoliberale Diskurs war also weit entfernt vom Glauben an »selbstregulierende Märkte«. Stattdessen war der entscheidende Punkt vielmehr die Verteidigung des Marktes und seinen Vorzügen gegen Kollektivisten und Keynesianer. Gleichzeitig gestand man sich aber ein, dass Märkte bei weitem nicht so robust und selbsterhaltend waren, wie große Teile der liberalen Tradition bis dato zu glauben pflegten. Pointierter ausgedrückt: Der Markt an sich war nicht die Lösung aller Probleme; vielmehr wurde der Markt selbst für das neoliberale Denken zu einem Problem, da dieser ständiger Pflege bedurfte und von einer Reihe von Vorbedingungen abhing. Hieraus ergibt sich das, was ich die neoliberale Problematik nennen möchte: die Vorbedingungen funktionierender Märkte – also von Märkten, in denen der Preismechanismus so ungestört regieren kann, wie nur möglich. 9 Diese Darstellung ist klar von Foucaults Vorlesungen zur Gouvernementalität und seiner Betonung der Neuartigkeit der neoliberalen Theorie des Marktes als Ort des Wettbewerbs, und nicht des Austauschs, beeinflusst. Foucault verstand Neoliberalismus konsequent als eine Gouvernementalität, also als eine reflektierte Regierungspraktik (siehe Foucault, 2008). Während er argumentierte, dass Regierungsrationalitäten oft als Reaktion auf Phänomene wie die Bevölkerung entstehen, die zu einem »Problem« werden, wird nach meinem Wissen in diesen Vorlesungen der Neoliberalismus nicht als problematisch bezeichnet. Der Begriff »Problematisch« wird hier in Anlehnung an Karl Mannheim verwendet, der in seiner grundlegenden Studie zum Konservatismus von einem gemeinsamen Problematischen sprach, das diese Tradition über verschiedene räumliche und zeitliche Kontexte hinweg durchzieht und belebt. Siehe Mannheim (1997).
Die unübersehbaren Unterschiede und Widersprüche im neoliberalen Diskurs rühren nicht zuletzt von den vielen, manchmal widersprüchlichen Ansätzen her, wie dieses Thema aufgegriffen und behandelt wird. Was jedoch klar wird, ist, dass neoliberales Denken zwar um Märkte kreist, aber die intellektuellen Anstrengungen derjenigen, die sich damit beschäftigen, wie Buchanan, Hayek oder die deutschen Ordoliberalen, sich unweigerlich auf deren Infrastruktur konzentrierten, die eingerichtet und gegen wechselnde Gegner verteidigt werden muss, damit diese Märkte funktionieren können. Dies betrifft sowohl den sozialen als auch den politischen Bereich und deshalb ist es für Neoliberale nur logisch, so viel Zeit damit zu verbringen, den Staat – und die Demokratie – zu durchdenken und zu gestalten.
Demokratie und ihre neoliberalen Kritiker
Wenn Neoliberale über Demokratie sprechen, meinen sie meistens die Demokratie in ihrer aktuellen Ausgestaltung. Das bedeutet, sie gehen selten auf prinzipielle Fragen zur Theorie der Demokratie ein. Stattdessen konzentriert sich ihre Kritik meist auf die bestehenden Gestalten der repräsentativen Demokratie. Die verschiedenen Kontexte, in denen diese Kritiken geäußert werden, hinterlassen ihre Spuren. Anstatt hier jedoch die Details herauszuarbeiten, will ich drei Hauptarten der neoliberalen Kritik an der Demokratie hervorheben, die sich analytisch voneinander unterscheiden lassen. 10 Für aufschlussreiche Darstellungen der schwierigen Beziehung des Neoliberalismus zur Demokratie siehe Biebricher (2015), Brown (2018) und Slobodian (2018a).
Die erste Kritik an der Demokratie kommt besonders im ordoliberalen Diskurs vor, ist aber nicht auf diesen beschränkt. 11 Siehe zum Beispiel: »‚Demokratie‘, breit genug definiert, um ihre vielen institutionellen Varianten einzuschließen, wird die Präferenzen der Bürger widerspiegeln, die weitgehend immun gegenüber den Ergebnissen der Wissenschaft bleiben, und die zunehmende Korruption, die zwangsläufig mit einer Erweiterung des kollektiven politischen Einflusses einhergeht, wird einfach toleriert und ignoriert« (Buchanan, 2005, S. 20). Für ordoliberale wie Wilhelm Röpke und Walter Eucken ist der Hauptfeind wirklicher Demokratie in einem neuen Phänomen auf der politischen Bühne auszumachen – den Massen. Mit dem Aufstieg der Massendemokratie haben diese eine bislang unbekannte Macht über politische Entscheidungen gewonnen, oder zumindest gehen die ordoliberalen Denker von dieser Annahme aus. Das Problem liegt also nicht in der Existenz der Massen an sich, sondern in ihrer Integration in den politischen Prozess durch massendemokratische Institutionen, die sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts zunehmend etablierten. Doch obwohl die Abneigung gegenüber den Massen wie eine weitere Variante des klassischen liberal-konservativen Arguments gegen die Tyrannei der Mehrheit erscheinen mag, steckt noch etwas mehr dahinter. Die Massen sind mehr als nur eine Mehrheit. Beeinflusst von Werken wie Gustave Le Bons Die Psychologie der Massen (1895), Sigmund Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) und Jose Ortega y Gassetts Der Aufstand der Massen (1930) (der zum Kolloquium eingeladen war, aber nicht teilnahm), wird das Konzept der Massen psychologisch (und manchmal rassistisch) aufgeladen. Den Massen werden Unmündigkeit und allgemeine Irrationalität zugeschrieben. Das ist es, was sie zu idealen Opfern für Demagogen macht, die ihre unkritische Aufnahmebereitschaft und Formbarkeit ausnutzen, um sie für politische Projekte zu mobilisieren – typischerweise solche Projekte, die aus der Sicht der Ordoliberalen Planung und Kollektivierung durch den Staat umfassen. Es gibt zahlreiche Textbeispiele, die diese Haltung belegen. Zum Beispiel schreibt Eucken: »Während die Menschen nur in bestimmten Ordnungen leben können, neigt die Masse dazu, gerade diese Ordnungen zu zerstören«. 12 Eucken, W. (1960 [1952]). Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Mohr Siebeck. S. 14 Und in einem seiner klassischen Texte von 1932 bedauert er: »Der gleichzeitige Demokratisierungsprozess verlieh den Parteien und den Massen und Interessengruppen, die sie organisierten, viel größeren Einfluss auf die Staatsführung und damit auf die Wirtschaftspolitik«. 13 Eucken, W. (2017 [1932]). Structural transformations of the state and the crisis of capitalism. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 51–72). Rowman and Littlefield International. S. 59 Röpke ergänzt diese Sichtweise 14 Röpke, W. (1950 [1942]). The social crisis of our time. University of Chicago Press. S. 92 :
In allen Ländern, in manchen weniger, in anderen mehr, wurde die Gesellschaft zu einer Masse von Individuen, die noch nie so dicht gedrängt und voneinander abhängig waren und dennoch gleichzeitig wurzellos, isoliert und wie Körner im Sand existieren … Alles Elend, alle Probleme unserer Zeit haben hierin ihre Wurzeln.
An anderer Stelle bezieht er sich auf die sozialpsychologische Rahmung des Diskures über die Massen:
Als Teil der ‚Masse‘ sind wir anders als das, was wir normalerweise wären; wir sind unmenschlich, herdengleich, und der Zustand der Gesellschaft korrespondiert auf gefährliche Weise mit unserem eigenen.
Und selbst wenn die extremen Ausprägungen des »Massen-Syndroms« nur in dem auftreten, was Röpke den »akuten Zustand« der Masse nennt, ist die Massenbildung als dauerhafter Zustand kaum weniger alarmierend, da sie die Herrschaft mittelmäßiger Rohlinge auf Kosten der »unveränderlichen Aristokratie der Natur« ankündigt, die Röpke verteidigen möchte. 15 Ebd. S. 55. Zusammenfassen lässt sich die erste Kritiklinie an der Demokratie wie folgt: Die Wirtschaftspolitik ist einfach zu wichtig und zu komplex, um sie den abgründigen Massen zu überlassen, die zwar nicht in Parlamenten sitzen und Regierungen führen, aber dennoch unter den Bedingungen der Massendemokratie zu einflussreich sind – auch wenn sie nur das Objekt demagogischer Agitation und Mobilisierung ist. Kommt es zu einer Allianz politischer Agitatoren mit den Massen, so würde die Demokratie zwangsläufig in Kollektivismus übergehen, das Hauptfeindbild der neoliberalen Gedankenwelt: »Es lässt sich nicht leugnen: Der kollektivistische Staat ist in den Massen verwurzelt.« 16 Röpke, 1950, S. 86
Die zweite Kritiklinie stammt ebenfalls von einem Ordoliberalen, nämlich Alexander Rüstow. Neben der Wirkung der zeitgenössischen Massendemokratie richtet sich seine Kritik gegen deren angebliches Übermaß an »Pluralismus«. Rüstow bringt das Hauptanliegen prägnant auf den Punkt 18 Rüstow, A. (2017a [1942]). General sociological cause of the economic disintegration and possibilities of reconstruction. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 151–162). Rowman and Littlefield International. S. 159. :
Die demokratische, parlamentarische Struktur einiger wirtschaftlich führender Staaten führte dazu, dass wirtschaftliche Korruption auch in die Innenpolitik des Staates, in die politischen Parteien und in den (sic!) Parlamentarismus selbst eindrang. Die politischen Parteien wurden allmählich in parlamentarische Agenturen von Wirtschaftsinteressen verwandelt und von ihnen finanziert… Die pathologische Form der Regierung, die sich auf diese Weise entwickelte, war der Pluralismus…
Unter Bedingungen der Massendemokratie gewinnen wirtschaftliche Interessengruppen so viel Einfluss, dass sie den politischen Parteien ihren Willen fast diktieren können. Das Ergebnis ist eine Marginalisierung des vage definierten Gemeinwohls, das sich in dem auflöst, was Eucken als »Gruppenanarchie« bezeichnet. 19 Eucken, 1960, S. 171. Der Staat, der eigentlich dieses Gemeinwohl wahren sollte, wird durch diese wirtschaftlich-politische Klientelwirtschaft untergraben. Rüstow wiederholt die scharfe Kritik von Carl Schmitt am Pluralismus mit seiner Schlussfolgerung: »Was hier geschieht, entspricht dem Motto: ‚Der Staat als Beute’«. 20 Rüstow, A. (2017b [1932]). State policy and the necessary conditions for economic liberalism. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 143–150). Rowman and Littlefield International. S. 147. Unter Bedingungen des ungezügelten Pluralismus wird der Staat kontinuierlich geschwächt. Die dadurch entstehenden Fliehkräfte werden schließlich unkontrollierbar – die politische Gemeinschaft fällt durch das Wirken partikularistischer Akteure aus allen Ecken der Gesellschaft auseinander.
Drittens gibt es eine zeitgenössische Kritik, die große Ähnlichkeit mit der eben aufgeführten Kritik am Pluralismus von Rüstow aufweist. Das zugrundeliegende Konzept dieser Kritik ist das »Rent-Seeking«. Dies beschreibt ein Verhalten, das versucht, Vorteile gegenüber anderen nicht durch produktives Handeln und Wettbewerb zu erlangen, sondern durch Lobbyarbeit für besondere Anliegen, meist eine Ausnahme von bestimmten Regeln. Diese Idee basiert auf Erkenntnissen der Spieltheorie und Rational-Choice-Ansätzen: Hiernach maximiert sich der individuelle Nutzen, wenn (allgemein nützliche) Regeln für alle gelten, außer für die betreffende Person. Ein großer Teil der Public-Choice Kritik an der Demokratie dreht sich genau um diese Grundidee: Unter Demokratiebedingungen wird die ständige Nachfrage nach besonderer Behandlung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren von politischen Akteuren befriedigt, die sich dadurch bessere Chancen auf ihre Wiederwahl erhoffen. Als Mitbegründer der Public-Choice-Theorie stellt Buchanan das Rent-Seeking-Theorem in den Mittelpunkt seiner Kritik an der repräsentativen Demokratie. Und hiermit ist er nicht der einzige Neoliberale, der dies tut: Milton Friedman und später auch Hayek griffen gelegentlich, wenn auch nicht systematisch, auf die Grundlogik des Rent-Seeking zurück. 21 Siehe Friedman, M., & Friedman, R. (1984). Tyranny of the status quo. Harcourt Brace Jovanovich. Das grundlegende Problem, das scheinbar aus Rent-Seeking entsteht, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wenn alle anderen Rent-Seeking betreiben, diktiert die individuelle Vernunft, dass man dies ebenfalls tut, weil man sonst indirekt benachteiligt wird, da andere von Regeln befreit werden, die für einen selbst weiterhin gelten. Das bedeutet, dass Rent-Seeking eine grundsätzlich expansive Dynamik hat und somit als allgemeine Praxis gegen die Absichten seiner Akteure zurückschlägt. Auch wenn individuelles Rent-Seeking erfolgreich sein mag und einen Vorteil verschafft, wird dieser Vorteil durch die vielen Nachteile, die durch andere erfolgreiche Rent-Seeking-Aktivitäten entstehen, weit übertroffen. So benachteiligen sich die Akteure einer individuell nutzenmaximierenden Gesellschaft letztlich selbst – genau wie im pluralistischen Szenario herrscht hier der Partikularismus mit einer tragischen Wendung. Und nicht nur ihren aktuellen Mitgliedern schadet die »Rent-Seeking-Gesellschaft«. 22 Buchanan, J., Tullock, G., & Tollison, R. (1980). Toward a theory of the rent-seeking society. Texas A&M University Press. Ausnahmen und Sonderbehandlungen haben natürlich einen Preis. Da jedoch für deren Finanzierung Steuererhöhungen unter den Annahmen der Public-Choice-Theorie nicht realistisch sind und die Gesetzgeber sowie die Regierung immer weniger Kontrolle über die Geldpolitik und damit die Inflationsrate haben, ist die Hauptstrategie zur Finanzierung von »Renten« die Anhäufung von Staatsschulden und Defiziten. Hiermit belastet die Rent-Seeking-Gesellschaft die »zukünftigen Generationen« mit finanziellen Verpflichtungen, über die sie keinen Einfluss hatten – was möglicherweise eine klare Verletzung des demokratischen Prinzips der Autonomie darstellt.
Die letzte Kritik bezieht sich auf den Niedergang des Rechtsstaats im Zusammenhang mit der Demokratie und stellt die angebliche Ungezügeltheit der Demokratie in Frage. Ein führender Vertreter dieser Argumentation ist Friedrich August Hayek, der diese Themen in vielen seiner Schriften beleuchtete. Hayek erkannte zwar an, dass Demokratie grundsätzlich ihre Vorteile hat: »[S]ie ist die einzige Konvention, die wir bisher entdeckt haben, um friedlichen Wandel zu ermöglichen«. 23 Hayek, F. A. (2003 [1982]). Law, legislation and liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Volume III. Routledge. S. 137. Doch das Ideal der Demokratie und ihr ursprüngliches Ziel, Macht zu begrenzen, wurden im Laufe der Zeit entstellt. In The Constitution of Liberty bringt Hayek den Kern seiner Kritik auf den Punkt 24 Hayek, F. A. (2006 [1960]). The constitution of liberty. Routledge. S. 93. :
Das entscheidende Konzept des dogmatischen Demokraten ist das der Volkssouveränität. Für ihn bedeutet dies, dass die Herrschaft der Mehrheit unbegrenzt und unbegrenzbar sein muss. Das Ideal der Demokratie, das ursprünglich dazu gedacht war, willkürliche Macht zu verhindern, wird so zur Rechtfertigung einer neuen willkürlichen Macht.
Der tiefere Grund dafür, so Hayek, liegt im Niedergang des Rechtsstaatsprinzips und im Verlust der formalen Kriterien dafür, was ein echtes Gesetz ausmacht. Während in der Blütezeit des Liberalismus nur jene Regeln als Gesetze galten, die abstrakt, allgemein und auf zukünftiges Verhalten ausgerichtet waren, behauptet Hayek, dass heute alles, was ein Parlament beschließt, die Macht eines Gesetzes hat. Dadurch werden Parlamente ermächtigt, diskretionäre Planungsmaßnahmen durchzuführen, die Hayek auf vielen Ebenen als schädlich betrachtet. Und da es keine formalen Einschränkungen mehr für diese ungebändigte Demokratie gibt, haben Politiker keine Mittel, um den Forderungen von Interessengruppen aus der Gesellschaft zu widerstehen.
Hayek resümiert hier wie folgt, und spiegelt darin die zweite und dritte oben beschriebene Kritiklinie 25 Hayek, 2003, III, S. 139 :
Das eigentliche Problem ist natürlich, zusammengefasst, dass in einer unbegrenzten Demokratie die Inhaber von Ermessensspielräumen gezwungen sind, diese zu nutzen, ob sie wollen oder nicht, um bestimmte Gruppen zu begünstigen, von deren Stimmen ihre Macht abhängt.
Der Hauptaspekt von Hayeks Argumentation ist jedoch eine Kombination aus der Kritik an der Demokratie als Mehrheitsregel – am deutlichsten formuliert in The Constitution of Liberty – 26 Siehe Hayek, 2006, S. 90-102. und der Behauptung, dass diese Mehrheitsregel nicht mehr in irgendeiner sinnvollen Weise eingeschränkt ist. Dies führt zu einer fast dystopischen »unbegrenzten Demokratie«, die laut Hayek letztlich zum Totalitarismus führen würde 27 Hayek, F. A. (2003 [1982]). Law, legislation and liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Volume I. Routledge. S. xx. :
[D]as ganze Werk [Recht, Gesetzgebung und Freiheit] wurde inspiriert durch eine wachsende Besorgnis über die Richtung, in die sich die politische Ordnung der ehemals als fortschrittlich angesehenen Länder entwickelt. Die wachsende Überzeugung … dass diese bedrohliche Entwicklung hin zu einem totalitären Staat aufgrund tief verwurzelter Konstruktionsmängel des allgemein akzeptierten Typs ‚demokratischer‘ Regierung unvermeidlich ist, hat mich gezwungen, verschiedene alternative Ordnungen zu durchdenken.
Diesen alternativen Ordnungen in den verschiedenen Werken der hier besprochenen neoliberalen Theoretiker wenden wir uns nun genauer zu.
Visionen neoliberaler Demokratie
Es würde den Rahmen dieses Textes sprengen, jede einzelne Reformidee führender Neoliberaler zu besprechen. Daher konzentriere ich mich nur auf drei relativ konkrete Reformvorschläge von Buchanan, Hayek und den Ordoliberalen Rüstow und Eucken. Mit diesen sollen die verschiedenen Schwächen oder Probleme der Demokratie angegangen werden, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurden.
Beginnen wir mit dem vielleicht spezifischsten Vorschlag aus dem neoliberalen Reformkatalog, der vor allem von James Buchanan vertreten wurde – eine etwas abgewandelte Version dieses Vorschlags propagierte auch Milton Friedman. Der Vorschlag zielt darauf ab, das Rent-Seeking-Verhalten zu bekämpfen, und vor allem, dass im Namen von Politiker*innen bestimmten Interessensgruppen Vorteile verschafft werden, um die Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen. Buchanan wurde im Laufe der Jahre immer pessimistischer, was die amerikanische Demokratie angeht, und behauptete schließlich, dass »die historische Erfahrung und nicht zuletzt die jüngsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten nahelegen, dass die Regierung in ihrem aktuellen institutionellen Rahmen nicht mehr unter der Kontrolle der Wählerschaft steht.« 28 Brennan, G., & Buchanan, J. (1985). The reason of rules: Constitutional political economy. Cambridge University Press. S. 25. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, schlug Buchanan vor, die Ausgabenpolitik des Staates strenger zu regeln und so demokratische Exzesse einzudämmen. Seiner Meinung nach braucht die Demokratie ein Gesetz, das verbietet, staatliche Ausgaben durch Schulden zu finanzieren. Am besten sollte dies auf der höchsten rechtlichen Ebene erfolgen: durch einen Verfassungszusatz, der einen ausgeglichenen Haushalt festschreibt. 29 Buchanan, J. (1997). The balanced budget amendment: Clarifying the arguments. Public Choice, 90, 117–138. So ein Gesetz würde vorschreiben, dass alle Ausgaben des Staates durch tatsächliche Einnahmen gedeckt sein müssen, also durch Steuern oder andere Quellen. Schuldenmachen, um Ausgaben zu finanzieren, wäre dann verfassungswidrig. Unter solchen Bedingungen müssten Politiker exzessive Ausgaben kontrollieren und Kürzungen vornehmen, anstatt sich durch niedrige Steuern bei Wahlen beliebt zu machen. Ob dies wirklich ein realistischer Ausgang der Vorschläge Buchanans ist, ließe sich hier sehr spannend diskutieren, genau wie die dahinter liegenden normativen Annahmen. Aber um bei dem von mir angestrebten Ansatz der immanenten Kritik zu bleiben, belassen wir es an dieser Stelle dabei und kommen zum nächsten Vorschlag, nämlich Hayeks »Modellverfassung«. 30 Hayek, 2003, S. 105-127.
Das Hauptanliegen von Hayeks Vorschlag ist die Wiederherstellung einer strikten Gewaltenteilung zwischen Regierung und Gesetzgebung. Hayeks Diagnose kritisiert die Vermischung beider und fordert daher die Wiedereinführung eines echten Zweikammersystems, in dem die Legislative nur wirkliche Gesetze verabschiedet, die dementsprechend den Handlungsspielraum der Regierung einschränken. Von den vielen bemerkenswerten Aspekten dieses institutionellen Entwurfs möchte ich einen besonders interessanten und viel kritisierten Aspekt hervorheben: In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich die von Hayek vorgeschlagene Regierungsversammlung kaum von empirisch existierenden Regierungen, obwohl Hayek ernsthaft in Erwägung zieht, allen Personen, die Transfers oder Gehälter vom Staat erhalten, das Wahlrecht zu entziehen. 31 Ebd. S. 120 Doch der Hauptkritikpunkt in Hayeks Vorschlag betrifft die Wahlregeln für die Legislative, die das eigentliche Machtzentrum in dieser neuen institutionellen Struktur darstellt, da die Regierungsversammlung strikt »an die von der gesetzgebenden Versammlung festgelegten Regeln des gerechten Verhaltens gebunden« wäre. 32 Ebd. S. 119. Die Abgeordneten der Legislative sollen wie folgt gewählt werden: Jedes Jahr wählen alle Bürger, die 45 Jahre alt sind, ihre Vertreter aus ihrer Altersgruppe, um die scheidenden Abgeordneten nach Ablauf ihrer 15-jährigen Amtszeit zu ersetzen. Hayek hat dabei 33 Ebd. S. 113.
eine Versammlung von Männern und Frauen im Sinn, die in einem relativ reifen Alter für ziemlich lange Zeiträume, etwa fünfzehn Jahre, gewählt werden, sodass sie weder wiederwählbar wären noch gezwungen wären, in den Markt zurückzukehren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Stattdessen wird ihnen eine fortlaufende öffentliche Beschäftigung in ehrenamtlichen, aber neutralen Positionen wie Laienrichtern zugesichert, damit sie während ihrer Amtszeit als Gesetzgeber weder von Parteiunterstützung abhängig sind noch sich um ihre persönliche Zukunft sorgen.
Die Logik hinter diesem Entwurf ist klar: Die lange Amtszeit, die fehlende Wiederwahlmöglichkeit und die garantierte zukünftige Beschäftigung sollen verhindern, dass die Abgeordneten sich zu sehr nach Interessengruppen richten. Außerdem sollen, so Hayek, durch die Altersgruppenbildung Parteizusammenschlüsse innerhalb der Legislative verhindert werden. Und selbst wenn diese sich bilden würden, »würden diejenigen, die zu verschiedenen Parteien neigen, dazu gebracht, die Themen gemeinsam zu diskutieren, und sie würden sich bewusst, dass sie die gemeinsame Aufgabe haben, die Ansichten ihrer Generation zu vertreten…« 34 Ebd. S. 118. Natürlich ist dieser radikale Vorschlag aus der Perspektive der Demokratietheorie angreifbar, aber lassen wir das beiseite und wenden uns stattdessen dem letzten und am wenig spezifischsten Vorschlag zu, der eine Transformation des Staates zu einem »starken Staat« fordert, wie ihn Alexander Rüstow und Walter Eucken propagieren.
Diese Lösung ist das konsequente Ergebnis der kritischen Diagnose des übermäßigen Pluralismus, die bei den meisten Ordoliberalen vorherrscht. Selbst Röpke, der sich weniger lautstark zu diesem Thema äußert, erinnert seine Leser daran, dass »die immense Gefahr dieses ungesunden Pluralismus darin besteht, dass Interessengruppen den Staat gierig bedrängen« und dass »jede verantwortungsbewusste Regierung sorgfältig alle möglichen Mittel prüfen muss, um dem pluralistischen Zerfall des Staates entgegenzuwirken«. 35 Röpke, 1960, S. 144, 143. Dennoch kommen die vehementesten Forderungen nach einem starken Staat von seinen ordoliberalen Mitstreitern Rüstow und Eucken. Ersterer schließt seinen später unter dem Titel Freie Wirtschaft, Starker Staat veröffentlichten Vortrag aus dem Jahr 1932 mit folgenden Worten 36 Rüstow, 2017b, S. 149. :
Der neue Liberalismus, den ich und meine Freunde vertreten, verlangt einen starken Staat, einen Staat, der über der Wirtschaft, über den Interessengruppen steht, an dem Platz, wo er hingehört. Und mit dieser Bekenntnis zum starken Staat, der liberale Wirtschaftspolitik fördert, und – weil sich die beiden gegenseitig bedingen – zu einer liberalen Wirtschaftspolitik, die einen starken Staat fördert, möchte ich enden.
Der Staat soll sich also vom pluralistischen Lärm der politischen Parteien und Interessengruppen lösen und eine Position einnehmen, die es ihm ermöglicht, die Forderungen dieser Akteure abzuwehren. Im selben Jahr veröffentlichte Eucken den später als Gründungstext der ordoliberalen Tradition wahrgenommen Aufsatz: Staatliche Strukurwandlungen und die Krisis des Kapitalismus. In diesem weitreichenden Artikel legt Eucken seine eigene Version der Geschichte des liberalen Niedergangs dar, welche sich seiner Ansicht mit dem der von Carl Schmitt deckt und in der »Transformation des liberalen Staates in einen Wirtschaftsstaat« 37 Eucken, 2017, S. 59 zum Ausdruck kommt. Für Eucken ist die Verschmelzung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft im Wirtschaftsstaat von größter Tragweite, da sie 38 Ebd. S. 59-60.
die unabhängige Entscheidungsfindung des Staates untergräbt, von der sein eigentliches Wesen abhängt… Alle jüngsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen zeigen deutlich diesen zersetzenden Prozess: Es handelt sich um eine Vielzahl von Maßnahmen, von denen jede auf die Wünsche verschiedener mächtiger Wirtschaftsgruppen zurückzuführen ist, die jedoch zusammen keine Kohärenz aufweisen und vollständig ohne System sind.
Kurz gesagt, dem Staat »fehlt die wirkliche unabhängige Macht, eigene Entscheidungen zu treffen.« 39 Ebd. S. 60.
Ähnlich wie Rüstow fordert Eucken also, dass der Staat sich aus dem Griff partikularer Akteure befreit, um wieder eine eigene, unabhängige Willensbildung zu ermöglichen und der wahre »Hüter der Wettbewerbsordnung« zu werden, 40 Eucken, 1960, S. 327. der diese Ordnung auch gegen mächtige wirtschaftliche Interessen durchsetzt. Wie sich das auf das System der pluralistischen Demokratie auswirken würde, und inwieweit es als Kollateralschaden dieses Vorgehens zurückgehen würde, wenn nicht sogar das eigentliche Ziel wäre, lässt Eucken offen – aber dieses Auslassen an sich lässt sich schon als aussagekräftig sehen.
Alle drei Vorschläge enthalten einige kontroverse Ideen, aber wie gesagt, habe ich sie hier nicht vorgestellt, um sie kritisch zu beleuchten, sondern um zu zeigen, dass Neoliberale immer mit ehrgeizigen Reformideen auf die diagnostizierten Probleme der Demokratie reagiert haben. Ohne Ausnahme gingen sie davon aus, dass die Zeit für pragmatisches Herumwursteln vorbei war und dass entschlossenes, grundlegendes Handeln notwendig sei. Was sich hier vorgestellt wird, sogar in der spezifischsten und weniger weitreichenden Forderung nach einer Verfassungsänderung für einen ausgeglichenen Haushalt, ist mehr als eine marginale Anpassung der Politik, sondern kommt dem nahe, was Peter Hall in seiner klassischen Diskussion als Veränderung zweiter oder gar dritter Ordnung bzw. Paradigmenwechsel bezeichnet – wobei die umfassenderen Vorschläge von Hayek und den Ordoliberalen sicherlich unter Letzteren fallen. 41 Siehe Hall, P. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275–296. Angesichts dieser weitreichenden und drastischen Transformationsvisionen ist es umso wichtiger, darüber nachzudenken, wie diese umgesetzt werden könnten und wer die Akteure sind, die plausiblerweise solche Strategien verfolgen könnten – kurz gesagt, es geht um das Problem der Transformation. Aber genau das stellt sich für die hier besprochenen Neoliberalen als große Herausforderung heraus.
Neoliberale Transformation – oder, wie man (nicht) von A zu B kommt
In diesem Abschnitt werde ich zeigen, dass Neoliberale es regelmäßig nicht schaffen, eine überzeugende Politik der neoliberalen Transformation zu formulieren – auch wenn sie dabei unterschiedliche Ansätze verfolgen, die durchaus aufschlussreich sind. Wie im vorigen Abschnitt zu sehen war, sind neoliberale Reformen nicht als schrittweise Anpassungen gedacht, sondern als radikale Brüche mit dem Status quo – was angesichts der düsteren Diagnosen der modernen Demokratien nur logisch erschient. Aber wie soll diese Transformation umgesetzt werden, und wer soll diesen epochalen Wandel einleiten?
Blicken wir zunächst auf Eucken, der in dieser Hinsicht wohl die schwächste Position unter den hier betrachteten Neoliberalen hat. In einigen seiner Schriften nach dem Krieg und besonders in den posthum veröffentlichten Grundsätzen der Wirtschaftspolitik benennt er zwar potenzielle Akteure, die eine wettbewerbsfähige Ordnung durchsetzen sollen, doch bleibt seine Darstellung dieser Akteure größtenteils vage und unkonkret. Der Staat, die Kirchen und die Wissenschaft werden von ihm als »Ordnungsmächte« 42 Eucken, 1960, S. 325. beschrieben, doch deren Potenzial bleibt ungenutzt. Mit anderen Worten, Eucken weiß nicht, wie der Staat sich von dem Einfluss der Interessengruppen und politischen Parteien befreien soll, oder wie Kirchen und Wissenschaft ihre frühere Autorität und ihren Einfluss zurückgewinnen können. Besonders in Bezug auf den Staat steht Eucken vor einem Dilemma: »Ohne wettbewerbsfähige Ordnung kann kein handlungsfähiger Staat entstehen und umgekehrt, ohne einen handlungsfähigen Staat kann keine wettbewerbsfähige Ordnung entstehen.« 43 Ebd. S. 338.
Während Eucken das Thema der neoliberalen Strategie nicht weiterverfolgt, geht Röpke gezielt auf die Frage ein, welche Akteure seine Vision einer dezentralisierten und demassifizierten Gesellschaft umsetzen könnten. 44 Röpke, 1960, S. 130.
Es gewinnt zunehmend an Bedeutung, dass jede Gesellschaft eine kleine, aber einflussreiche Gruppe von Führungspersönlichkeiten haben sollte, die sich als Hüter der unverletzlichen Normen und Werte der ganzen Gemeinschaft sehen und sich streng an dieses Amt halten. Was wir brauchen, ist wahre nobilitas naturalis.
Wie müssen hier nicht auf die Einzelheiten von Röpkes Lobpreisung einer tugendhaften Kaste von clerks eingehen, die die politische Gemeinschaft wohlwollend bewachen. Stattdessen können wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, mit welcher sehr pessimistischen Haltung Röpke der Einführung einer nobilitas naturalis begegnet. 45 Ebd. S. 131.
Offensichtlich müssen viele und manchmal schwierige Bedingungen erfüllt und bestehen bleiben, wenn eine solche natürliche Aristokratie sich entwickeln und ihre Aufgaben erfüllen soll. Sie muss wachsen und reifen, und die Langsamkeit ihrer Reifung steht im Gegensatz zur Schnelligkeit ihrer möglichen Zerstörung.
Die Akteure, die von Röpkes Reformagenda eingeführt werden, verschwinden also fast sofort wieder, da sich herausstellt, dass ihre Existenz von einer eher unwahrscheinlichen Konstellation abhängt, die leicht zerfällt – und damit auch die geschätzten »Aristokraten des öffentlichen Geistes«. 46 Ebd. S. 131. Dass das kein Zufall ist, können wir an Röpkes detaillierter Beschreibung dieser clerks sehen: Was erforderlich ist, um als einer der Hüter der Gesellschaft zu gelten, umfasst unter anderem ein 47 Ebd. S. 130-131.
Leben des engagierten Strebens zum Wohle aller, unerschütterliche Integrität, ständige Zurückhaltung unserer gemeinsamen Gier, nachgewiesene Klugheit, ein makelloses Privatleben, unerschütterlicher Mut, für Wahrheit und Gesetz einzutreten, und allgemein ein höchst vorbildhaftes Leben.
Angesichts dieses anspruchsvollen Profils ist es keine Überraschung, dass das Entstehen und die Aufrechterhaltung einer solchen Hüter-Klasse als äußerst unwahrscheinlich beschrieben werden. Schließlich scheint es, als bräuchte es Akteure von fast überirdischer Natur, um Röpkes Standards zu erfüllen. Daher ist es nur konsequent, dass er sie als »säkularisierte Heilige« bezeichnet. Angesichts der religiösen Idiomatik, in die diese Angelegenheiten in Röpkes Darstellung übertragen werden, scheint es angemessen, dies als ein typisches »deus-ex-machina«-Motiv zu bezeichnen, das die Lücken in dessen Denken offenbart.
Bei Rüstow wissen wir bereits, dass seine Lösung die Transformation des aktuellen, schwachen Staates in einen starken ist. Wie aber lassen sich die eingefahrenen Netzwerke interessierter Parteien umgehen, die in der Lage sind, die Massen gegen jede Art von Reformbemühungen aufzuwiegeln, die ihre Zugänge zu den Trögen von Geld und Macht bedrohen? In einem frühen Beitrag in Form eines Vortrags aus dem Jahr 1929 entwirft Rüstow einen Weg zur Überwindung des Pluralismus, der durchaus als kommissarische Diktatur bezeichnet werden kann. Schließlich trägt der Vortrag den Titel Diktatur in den Schranken der Demokratie. 48 Rüstow, A. (1959). [1929] Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie. Dokumentation des Vortrags und der Diskussion von 1929 and der Deutschen Hochschule für Politik. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 7(1), 85–111. Seinem Vorschlag zufolge würde die von einem Kanzler geführte Regierung für eine bestimmte Zeit das Recht erhalten, zu regieren, auch wenn sie keine parlamentarische Mehrheit hat. Die Aussetzung der Möglichkeit, zum Rücktritt gezwungen zu werden oder dass Gesetze und Maßnahmen in parlamentarischen Abstimmungen scheitern, soll der Regierung den Spielraum geben, das zu tun, was Rüstow sich zweifellos als die Art von Politik vorstellte, die Röpkes Aristokraten des öffentlichen Geistes betrieben hätten. Sobald der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, endet die Aussetzung der parlamentarischen Macht und Kontrolle, und die Regierung muss sich erneut der entsprechenden Prüfung sowie der Möglichkeit, abgewählt zu werden, stellen. »Das bedeutet die Bewahrung der Demokratie, weil es sich um eine zeitlich begrenzte Diktatur handelt, nicht im strengen Sinne des Wortes, sondern sozusagen um eine Diktatur auf Probe«. 49 Ebd. S. 99.
Im Fall von Hayek sind die Dinge, wenig überraschend, komplexer. Doch der Kern seiner Aussage ist klar genug. Bereits in Law, Legislation and Liberty diskutiert er Notstandsbefugnisse als möglicherweise notwendig, um die langfristige Stabilität einer politischen Gemeinschaft inmitten einer Krise und/oder am Rande des totalitären Kollektivismus zu sichern. 50 Hayek, 2003, III, S. 124. Dieses Argument befindet sich an einem neuralgischen Punkt in Hayeks Denken, systematisch betrachtet, denn ebenso wie bei anderen Neoliberalen steht er vor der Aufgabe, einen plausiblen Weg zu einer stärker neoliberalen Gesellschaft aufzuzeigen, in einer Welt, die sich laut seiner eigenen Analyse bereits auf dem berühmten Weg zur Knechtschaft befindet. Notstandsbefugnisse und ein Ausnahmezustand in Form einer Übergangsdiktatur stellen die theoretische Brücke dar, die den Status quo mit Hayeks neoliberaler Vision verbindet. Dies wird am deutlichsten und auch am kontroversesten in Hayeks berüchtigten Bemerkungen über Chile nach dem Putsch von Augusto Pinochet, in denen er seine übliche Freimütigkeit »El Mercurio« im Jahr 1981 zeigt 51 El Mercurio. (1981). Friedrich von Hayek: Lider y maestro de liberalismo economico. El Mercurio, April 12, 1981, D9. :
Als langfristige Institutionen bin ich völlig gegen Diktaturen. Aber eine Diktatur kann für eine Übergangszeit ein notwendiges System sein. Manchmal muss ein Land für eine Zeit eine Art diktatorischer Macht haben. Wie Sie verstehen werden, ist es möglich, dass ein Diktator liberal regiert… Mein persönlicher Eindruck… ist, dass wir in Chile… den Übergang von einer diktatorischen zu einer liberalen Regierung erleben werden…
Anfang der 1980er Jahre hatte sich Hayek also offensichtlich davon überzeugt, dass eine Übergangsdiktatur eine legitime Option sei, um politische Gemeinschaften davor zu bewahren, dem Totalitarismus und Kollektivismus zu verfallen. Und wie wir aus dem Zitat im vorherigen Abschnitt wissen, war Hayek auch überzeugt, dass dies nicht nur ein Problem für Chile oder andere »unterentwickelte« Länder sei, sondern dass der Weg in den Totalitarismus eine Tendenz sei, die in der tatsächlich existierenden modernen Demokratie angelegt war.
Wie sind diese Vorschläge zu bewerten? Beginnen wir mit Rüstow: Wenn die angestrebte »Diktokratie« wirklich innerhalb der Grenzen der Demokratie bleiben soll, müsste sie durch eine parlamentarische Abstimmung etabliert werden, die die Verfassung ändert. Doch wie er selbst feststellt: »Ich bin nicht genug Utopist, um anzunehmen, dass ein Vorschlag, wie ich ihn eben skizziert habe, heute im Reichstag eine Mehrheit finden würde, um die Verfassung zu ändern … Wenn wir einen Reichstag hätten, in dem so etwas denkbar wäre, dann wäre der Vorschlag überflüssig«. 52 Rüstow, 1959, S. 100. Angesichts dieses »Catch 22«, das den entsprechenden Problemen bei Eucken ähnelt, muss Rüstow entweder seine Hoffnungen auf eine wahrhaft transformative Politik, die den schmalen Grat zwischen Demokratie und Diktatur beschreitet, begraben, oder er müsste seine verbliebenen demokratischen Sensibilitäten ablegen und sich für eine diktatorische Politik ohne Abstriche entscheiden.
Sowohl Rüstow als auch Hayek stehen vor einem weiteren, allgemeineren Problem, das sie weitgehend unbeachtet lassen: Ist es realistisch zu glauben, dass eine Übergangs-Diktatur tatsächlich nur vorübergehend bleibt? Es gibt zwar historische Beispiele, in denen Diktatoren oder demokratische Führer mit de facto diktatorischen Befugnissen sich stillschweigend zurückgezogen haben und so eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen ermöglichten. Doch gerade Hayek hat in Der Weg zur Knechtschaft seine Argumentation auf die Vorstellung gestützt, dass unkontrollierte Macht dazu neigt, sich zu verfestigen und eine Dynamik zu erzeugen, die in Richtung Totalitarismus abläuft. Die Fülle an Macht, die für umfassende Planung erforderlich ist, würde nach Hayek selbst die wohlmeinendsten Sozialisten in die tödliche Politik des Totalitarismus treiben. Warum sollten diese Mechanismen nicht auch für die Übergangsdiktaturen gelten, die nicht den Weg zum Sozialismus, sondern zum liberalen Autoritarismus ebnen wollen? Eine Hayeksche Verteidigungslinie könnte darauf abzielen, auf einen Punkt in Der Weg zur Knechtschaft hinzuweisen, wonach eine solche Dynamik nur durch wirtschaftlichen Interventionismus und nicht durch politische Interventionen ausgelöst wird; das heißt, wenn liberaler Autoritarismus von wirtschaftlichen Interventionen absähe, könnte er jene potenziell totalitäre Dynamik stoppen. Ob diese Differenzierung jedoch überzeugend ist, ist eher zweifelhaft. Während Hayek jedoch zumindest ein Argument vorbringt, wenn auch ein schwaches, bleibt es ein echtes Rätsel, warum Rüstow diesem Dilemma nie explizit Aufmerksamkeit geschenkt hat; umso mehr, da er – ebenso wie Hayek – mit den Arbeiten von Carl Schmitt vertraut war. Und in seinen Schriften über den Ausnahmezustand ist ein wesentlicher und nicht ganz unplausibler Punkt, dass das liberale Bestreben, die unberechenbare Natur eines Ausnahmezustands durch die Kodifizierung von Regeln, die seine Modalitäten und die daraus resultierenden Notstandsbefugnisse regeln, einzudämmen, letztlich vergeblich ist. Wenn also Rüstows Hoffnung darin bestand, dass seine Version einer Übergangsdiktokratie tatsächlich vorübergehend bleibt, weil sie in der Verfassung kodifiziert wurde – falls es jemals eine Mehrheit dafür gäbe – dann ist dies aus schmittianischer Sicht fast naiv. In beiden Fällen sehen wir also, dass die vorgeschlagene Reformstrategie mit den mehr oder weniger expliziten Annahmen, die den jeweiligen Standpunkten zugrunde liegen, unvereinbar ist.
Unsere letzte Fallstudie ist das Werk von James Buchanan. Das ist hier das wohl faszinierendste Beispiel. Während Rüstow und Eucken meist versuchen, die Frage der Strategie und Umsetzung zu vermeiden, stellt sich Buchanan ihr immer wieder direkt.
Buchanans spezifische Herausforderung unterscheidet sich dabei nicht grundsätzlich von den Problemen, die die bereits besprochenen Neoliberalen plagen. Sie lässt sich in Form einer einfachen Frage zusammenfassen, die sich jedoch als äußerst folgenreich erweist: Wenn die Annahmen der Public-Choice-Theorie nahelegen, dass der homo oeconomicus ein geeignetes Verhaltensmodell für die Analyse politischer Akteure ist und Rent-Seeking nicht nur den Rent-Seeker, sondern auch denjenigen, der Renten gewähren kann, das heißt Politiker, zugutekommt, wie können wir dann annehmen, dass diese Akteure eine verfassungsmäßige Schuldenbremse verabschieden werden, die unter anderem das Rent-Seeking eindämmen soll?
Offensichtlich war Buchanan sich des Problems, vor dem er stand, sehr wohl bewusst und unternahm mehrere erfolglose Versuche, damit umzugehen – deren chronologische Darstellung den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. Schließlich, und das ist, worauf ich mich fokussieren möchte, sah Buchanan sich gezwungen, ein zentrales Element seines eigenen Denkens zu überdenken, nämlich das des homo oeconomicus und wie es mit dem Rent-Seeking-Verhalten verflochten war.
Hierbei wurde er mit der Zeit immer nachdrücklicher: Der Homo oeconomicus ist nur eine von mehreren Persönlichkeiten, die jede echte Person ausmacht. Hier deutet Buchanan zeitweise fast eine dualistische Anthropologie an. So schreibt er, dass es »einen Konflikt in jedem von uns gibt… zwischen Rent-Seeker und Konstitutionalist, und dass fast alle Bürger beide Rollen gleichzeitig spielen werden.« 53 Buchanan, J. (1991). Constitutional economics. Blackwell. S. 2, 10. Der Konflikt zwischen diesen normativen Ausrichtungen wird für Buchanan zu einem strategisch bedeutsamen Schlachtfeld, da er zu dem Schluss kommt, dass der »Konstitutionalist« in uns gegen den »Rent-Seeker« gestärkt werden muss, genauso wie Rousseau meinte, der »citoyen« müsse gegenüber dem »bourgeois« gestärkt werden. Es ist daher nur folgerichtig, dass Buchanan schreibt: »Die Reform, die ich anstrebe, beginnt vor allem mit den Geisteshaltungen«. 54 Buchanan, J. (1975). The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. University of Chicago Press. S. 176. Dies ist bemerkenswert, da es dem Anspruch widerspricht, den Liberale oder Konservative routinemäßig erheben, nämlich einer realistischen Anthropologie zu folgen, die »die Menschen so nimmt, wie sie sind« und ihre Präferenzen als »exogene Variablen« behandelt, wobei sie sich weigern, die Menschen zu erziehen oder zu verändern, sondern sich allein auf soziale und politische Regeln konzentrieren. Buchanan jedoch will die Menschen verändern, und er nimmt zunehmend explizit die Vorstellung an, dass es in dieser Angelegenheit nicht ausreicht, sich auf den homo oeconomicus zu berufen. In seinem Aufsatz The Soul of Classical Liberalism diagnostiziert Buchanan das Versagen des Liberalismus, die Herzen – und nicht nur die Köpfe – der Menschen zu gewinnen, da ihm eine ansprechende Erzählung fehlt 55 Buchanan, J. (2000). The soul of classical liberalism. Independent Review, 4, 112. :
Wissenschaft und Eigeninteresse, insbesondere in Kombination, verleihen jedem Argument zwar Nachdruck. Aber eine Vision eines Ideals, das über Wissenschaft und Eigeninteresse hinausgeht, ist notwendig, und diejenigen, die sich zum Club der klassischen Liberalen zählen, haben es in dieser Hinsicht auf bemerkenswerte Weise versäumt.
Der Konstitutionalist in uns kann nicht allein durch ein »rationales« Argument gestärkt werden, das sich auf die Autorität von Wissenschaft oder Eigeninteresse stützt, denn es geht um eine ganze Weltanschauung, an die man glaubt. Nur wenn sich die Einstellungsmuster in ausreichendem Maße verändert haben, wird es möglich sein, das politische Projekt zu verfolgen, das Buchanan weiterhin im Blick hat und welches er als nicht weniger als eine »konstitutionelle Revolution« beschreibt, im scharfen Gegensatz zum schrittweisen Pragmatismus der »pragmatischen Reform«. 56 Buchanan, J., & Di Pierro, A. (1969). Pragmatic reform and constitutional revolution. Ethics, 79(2), S. 95. Diese Strategie beinhaltet jedoch ein bedeutendes Zugeständnis, das Buchanan selbst deutlich macht: »Um die Hoffnung auf Reform der grundlegenden Regeln, die das soziopolitische Spiel beschreiben, aufrechtzuerhalten, müssen wir Elemente einführen, die das Postulat des Eigeninteresses verletzen«. 57 Brennan & Buchanan, 1985, S. 146. Dies ist äußerst bemerkenswert, denn die gesamte Kritik an der Rent-Seeking-Gesellschaft und der tatsächlich existierenden Demokratie beruht auf dem »Postulat des Eigeninteresses« des homo oeconomicus.
Und so sehen wir hier schließlich, dass nicht nur Buchanan seine Haltung gegenüber der potenziellen Wohltätigkeit von Akteuren abschwächen musste, und sich somit ein wenig den Ansichten von denen nähert, die wie Röpke ihre Hoffnungen in eine bestimmte Gruppe von Akteuren setzen. Sondern er sieht sich auch dazu genötigt, nicht einen Ausnahmezustand als Voraussetzung für neoliberale Reformen zu akzeptieren, sondern das, was man als Politik des Außergewöhnlichen mit den radikalen Konnotationen einer Revolution bezeichnen könnte. Und so sieht Buchanan, ähnlich wie Hayek und Rüstow, neoliberale Reformpolitik als eine Zäsur, die einen echten Bruch mit dem stahlharten Gehäuse des Immergleichen »grundlegenden Regeln des soziopolitischen Spiels« endlich geändert werden können. Diese Träume von einer Disruption werden nicht nur von Buchanan und Hayek geteilt. Auch Rüstow drückt diese aus, wenn er über »große Politik, die Politik, die die Kunst des Unmöglichen ist, die zu Unrecht für unmöglich gehalten wurde« sinniert 58 Rüstow, 1963, S. 117. genauso von Friedman, der sich ein politisches Zeitfenster vorstellt, in dem »was unmöglich schien, plötzlich unvermeidlich wird«. 59 Friedman, M., & Friedman, R. (1990 [1988]). Free to choose. A personal statement. Harvest Books. S. xiv. Hier zeigt sich eine fast eschatologische Hoffnung auf den Moment des großen Bruchs, den Tag der Abrechnung und der Wende, an dem die herrschenden Mächte gestürzt werden und ein neues Reich errichtet wird – doch hier handelt es sich nicht um das Reich Gottes, sondern um das Reich des Neoliberalismus.
Fazit
Zum Abschluss dieser Ausführungen lässt sich festhalten: Die neoliberale Denkweise ist nicht in der Lage, das Problem der Transition konsistent und überzeugend zu durchdenken. In diesem Sinne ähneln die Neoliberalen denen, die Marx als utopische Sozialisten verspottete: Sie sind voller Visionen für eine bessere Zukunft, haben aber keine Strategien, um diese Visionen zu verwirklichen. Trotz der oben beschriebenen Unterschiede lässt sich ein allgemeines Muster erkennen: Mit ihren teils scharfen Kritiken an den tatsächlich existierenden Demokratien bringen sich die neoliberalen Denker selbst in Schwierigkeiten. Denn je apokalyptischer ihre Diagnosen werden, desto schwieriger ist es, einen Ausweg aus dem Elend des Status Quo zu skizzieren. Anders gesagt: Was der neoliberale Kritiker an Dringlichkeit gewinnt, verliert der neoliberale Reformer an Veränderungsfähigkeit. Dies stellt die Neoliberalen vor ein Dilemma, das am besten in Buchanans Zugeständnis zum Schwächen des Eigeninteresse-Postulats zusammengefasst ist: Entweder wollen die Neoliberalen an ihren scharfen Kritiken der Demokratie und den dahinterstehenden Annahmen festhalten, verlieren dann aber effektiv die Fähigkeit, auch zu erklären, wie sich die Bedingungen ändern könnten, und ihre Analysen kippen in pessimistischen Konservatismus. Oder sie wollen die theoretische Fähigkeit bewahren, die Politik neoliberaler Reformen zu erfassen, müssen dann jedoch einige ihrer Annahmen lockern und damit ihre Kritik am demokratischen Status Quo erheblich zurückschrauben.
Dies als Dilemma zu beschreiben, ist die mildeste Version dieser Schlussfolgerung. Das ändert sich jedoch, wenn wir die Dimension des tatsächlich existierenden Neoliberalismus berücksichtigen, der schließlich reichlich Beweise für die Möglichkeit und Tatsache neoliberaler Reformen liefert: Die sogenannten Schuldenbremsen, die europäische Länder in Reaktion auf die Eurokrise eingeführt haben, entsprechen Buchanans hochgeschätzter Haushaltsgleichgewichtsklausel, und auch in den USA gibt es solche Haushaltsgleichgewichtsklauseln auf einzelstaatlicher und kommunaler Ebene. 60 Siehe Peck, J. (2010). Constructions of neoliberal reason. Oxford University Press. Weiterhin, wenn es um Akteure geht, die hinreichend von demokratischem Druck isoliert sind, um »rationale« Entscheidungen zu treffen, sind die Zentralbanken zu nennen, denen in der gesamten OECD-Welt Unabhängigkeit mit minimalen Anforderungen an die Rechenschaftspflicht zugestanden wurde, sowie die Europäische Kommission, die für die Überwachung der Wettbewerbs- und Defizitregeln in der Eurozone zuständig ist, die beide als Teil dessen betrachtet werden können, was als »Aufstieg der Ungewählten« bezeichnet wurde. 61 ibert, F. (2009). The rise of the unelected. Democracy and the new separation of powers. Cambridge University Press. Zuletzt dürfen wir die internationalen Handelsregime nicht vergessen, wie die WTO, Freihandelszonen wie die Europäische Union oder Mercosur in Südamerika, sowie Freihandelsabkommen wie CETA zwischen Kanada und der EU, die die Macht souveräner Nationalstaaten in vielen handelsbezogenen Bereichen und darüber hinaus effektiv beschränkt haben. 62 Siehe Slobodian, Q. (2018a). Globalists: The end of empire and the birth of neoliberalism. Harvard University Pres. Die dargelegten Aspekte werfen weiterführende Fragen auf. Erstens: Wenn es klare Beispiele für neoliberale Reformen gibt, sind die Lücken in der neoliberalen Theorie dann nicht im Wesentlichen bedeutungslos, und ist das nicht ein Hinweis auf die Bedeutungslosigkeit der neoliberalen Theorie im Vergleich zum tatsächlich existierenden Neoliberalismus? Zweitens: Angesichts der Verwirklichung neoliberaler Reformen, könnte es nicht auch so etwas wie eine performative Theorie des Übergangs geben, die aus den nicht-akademischen Bemühungen von jemandem wie Buchanan destilliert werden kann? Und schließlich, wie ändert sich die Schlussfolgerung zum oben skizzierten Dilemma in diesem Licht? Beginnen wir mit der letzten Frage: Der klassische Falsifikationismus sagt uns, dass, wenn die Schlussfolgerung einer Theorie mit der beobachteten Realität im Widerspruch steht, dies notwendigerweise bedeutet, dass mit den Annahmen der Theorie etwas nicht stimmt. Übertragen auf die aktuelle Konstellation: Die neoliberale Theorie kommt zu Schlussfolgerungen, die im Widerspruch zur beobachteten Realität stehen, also der Faktizität der neoliberalen Reformpolitik. Daher stimmt etwas mit den Annahmen der Theorie nicht, was bedeutet, dass die neoliberalen Kritiken der Demokratie, soweit sie auf diesen Annahmen basieren, als fragwürdig angesehen werden müssen. In Bezug auf die zweite Frage stimmt es, dass Neoliberale wie Buchanan und Hayek ihre Vorstellungen davon hatten, wie ihre Ideen Wirkung entfalten oder sie ihnen dazu verhelfen könnten. Nancy Maclean hat das in ihrer kontroversen Darstellung seiner nichtakademischen Aktivitäten, einschließlich der Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen und zwielichtigen Geldgebern, dokumentiert. 63 Siehe MacLean, N. (2017). Democracy in chains. The deep history of the radical right’s stealth plan for America. Viking Press. S. 199-204. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass es auf theoretischer Ebene immer noch Lücken gibt, die sich auf die Plausibilität ihrer kritischen Analysen der Demokratie auswirken, und darauf ziele ich mit meinem Argument letztlich ab.
Materialisten werden hier darauf hinweisen, dass die Identifikation theoretischer Lücken den Neoliberalismus oder seine Kritik an der Demokratie nicht plötzlich verschwinden lässt, und dem stimme ich zu. Um jedoch letztlich effektiv zu sein, muss die Kritik am Neoliberalismus nicht nur im Bereich des Kampfes und der Machtpolitik geführt werden, indem der tatsächlich existierende Neoliberalismus herausgefordert wird, sondern auch in der diskursiven Auseinandersetzung und im Bereich der Theorie auf der Grundlage verschiedener Arten von Kritiken, einschließlich einer immanenten, die Inkonsistenzen aufzeigt. Wichtig ist, dass das Argument dieses Textes nicht darauf abzielt, die neoliberale Theorie in ihrer Gesamtheit »zu widerlegen«, nicht zuletzt, weil Ideologien dazu neigen, Widersprüche zu enthalten, deren Identifizierung nicht unbedingt einen metaphorischen Todesstoß versetzt. Mein Ziel ist spezifischer: Es geht darum, das Dilemma hervorzuheben, dem die Neoliberalen gegenüberstehen. Das wird besonders deutlich im Fall Buchanans sichtbar, der offen zugibt, dass die Annahmen, die seine Kritik der Demokratie leiten, gelockert werden müssen, um Hoffnung auf bedeutende Reformen zu haben. Damit untergräbt er jedoch die Plausibilität neoliberaler Argumente gegen die Demokratie. Es ist nicht notwendig, die Bedeutung einer solchen Kritik zu übertreiben, die bei weitem nicht ausreicht. Jedoch lässt andererseits durch die ausschließliche Fokussierung auf die materielle Ebene den Neoliberalen die Option offen, unsaubere und unvollständige Implementierungen ihrer policies für negative Auswirkungen verantwortlich zu machen, wie zum Beispiel bei der Einführung von Haushaltsgleichgewichtsklauseln, und zu behaupten, dass ihre theoretischen Rahmenwerke dadurch nicht widerlegt sind. Auf diese Mängel auf der Ebene der Theorie macht meine Kritik aufmerksam.
Über diese unmittelbare Schlussfolgerung hinaus möchte ich noch auf eine weitere Implikation hinweisen, die im Licht meiner Argumentation in zukünftigen Forschungen näher diskutiert werden sollte: Die eschatologischen Hoffnungen, die Neoliberale hinsichtlich eines politischen Bruchs zu hegen scheinen, könnte auch eine Verbindung zur Politik des derzeit typischerweise als (Rechts-)Populismus bezeichneten Autoritarismus darstellen. Schließlich entspricht die Selbstdarstellung populistischer Führer, die schwören, »den Sumpf auszutrocknen« und das allgemein dekadente und korrupte Establishment beiseitezufegen, in erheblichem Maße dem, was Neoliberale anscheinend für notwendig hielten, um die Blockade und Trägheit der normalen Politik zu überwinden und neoliberale Reformen umzusetzen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass Hayek oder Buchanan den Gedanken an einen Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten oder einen Boris Johnson als Premierminister des Vereinigten Königreichs verabscheut hätten – schließlich könnten sie nicht weniger »Aristokraten des öffentlichen Geistes« sein. Dennoch führen die theoretischen Dilemmata, die ihre Kritiken an der Demokratie für sie schaffen, dazu, dass sich die Neoliberalen ungewollt zu der Art von disruptiver Anti-Establishment-Politik hingezogen fühlen müssen, die populistische Bewegungen und Parteien zumindest vorgeben zu vertreten. Exakt dies ist das »Frankenstein«-Monster des Neoliberalismus, um einen Ausdruck von Wendy Brown 64 Brown, W. (2018). Neoliberalism’s Frankenstein: Authoritarian freedom in twenty-first-century democracies. Critical Times, 1(1), 60–79. zu verwenden – oder sind seine »Bastarde«, um einen von Quinn Slobodian 65 Slobodian, Q. (2018b). Neoliberalism’s populist bastards. in: Public Seminar. Available online at https://publicseminar.org/2018/02/neoliberalisms- populist- bastards/ zu entlehnen. Sicherlich könnte man argumentieren, dass beispielsweise die erste Trump-Administration globale Regime wirtschaftlicher Multilateralität im Namen des protektionistischen Nationalismus angegriffen hat und damit im Gegensatz zu den oben genannten internationalen Freihandelsregimen, -zonen und -abkommen steht, die Manifestationen neoliberaler Reformen sind. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Opposition gegen neoliberale Pläne weniger strikt ist: Die Trump-Administration hat NAFTA tatsächlich verlassen – aber nur, um eine neue Freihandelszone namens USMCA mit minimal besseren Bedingungen für die Vereinigten Staaten auszuhandeln. Andererseits hätte die Steuerreform unter Trump genauso gut unter Reagan verabschiedet werden können – tatsächlich wurde Reagans Berater von damals, Arthur Laffer, auch von der Trump-Administration hinzugezogen. Ungeachtet dieser teilweisen Parallelen geht es mir nicht hauptsächlich darum, dass die von den Rechtspopulisten verfolgte inhaltliche Politik mit den neoliberalen Ideen substantiell übereinstimmt. Vielmehr besteht der wesentliche Punkt der Konvergenz zwischen beiden in ihrer Auffassung, dass Politik notwendigerweise disruptiv sein muss. Es gilt, die Dominanz von Mainstream-Politikern zu brechen, die keinen Anreiz haben, echte Veränderungen im »System« herbeizuführen. Dies wiederum verwandelt sowohl Neoliberale als auch rechtsgerichtete Populisten in Gegner der liberalen Demokratie und ihrer inhärenten Trägheit. Aber während Neoliberale von einer ultra-stabilen Welt mit sich fast selbst-durchsetzenden Regeln träumen, die im Moment des Bruchs erfolgreich entstehen soll, streben rechtsgerichtete Populisten das Gegenteil an: eine Welt der permanenten Disruption.
Übersetzung aus dem Englischen von Jannis Köster und Otmar Tibes.
Literatur
Brennan, G., & James, B. (1980). The Power to Tax: Analytical foundations of a fiscal constitution. Cambridge: Cambridge University Press.
Brennan, G., & Buchanan, J. (1985). The reason of rules: Constitutional political economy. Cambridge University Press.
Brenner, N., & Theodore, N. (2002). Cities and geographies of ‘actually existing neoliberalism’. Antipode, 34(3), 349–379.
Brown, W. (2018). Neoliberalism’s Frankenstein: Authoritarian freedom in twenty-first-century democracies. Critical Times, 1(1), 60–79.
Buchanan, J. (1975). The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. University of Chicago Press.
Buchanan, J. (1991). Constitutional economics. Blackwell.
Buchanan, J. (1997). The balanced budget amendment: Clarifying the arguments. Public Choice, 90, 117–138.
Buchanan, J. (1997). The balanced budget amendment: Clarifying the arguments. Public Choice, 90, 117–138.
Buchanan, J. (2000). The soul of classical liberalism. Independent Review, 4, 111–119.
Buchanan, J. (2005). Afraid to be free: Dependency as desideratum. Public Choice, 124, 19–31.
Buchanan, J., & Di Pierro, A. (1969). Pragmatic reform and constitutional revolution. Ethics, 79(2), 95–104.
Buchanan, J., Tullock, G., & Tollison, R. (1980). Toward a theory of the rent-seeking society. Texas A&M University Press.
Burgin, A. (2012). The great persuasion: Reinventing free markets since the depression. Harvard University Press.
Cahill, D. (2014). The end of laissez-faire? On the durability of embedded neoliberalism. Edward Elgar.
Chomsky, N. (1999). Profit over people: Neoliberalism and global order. Seven Stories Press.
Crouch, C. (2011). The strange non-death of neoliberalism. Oxford University Press.
Dardot, P., & Laval, C. (2013). The way of the world: On neoliberal society. Verso.
Davies, W., & Gane, N. (2021). Post-neoliberalism? An introduction. Theory, Culture, Society, 38(6), 3–28.
Eucken, W. (1960 [1952]). Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Mohr Siebeck.
Eucken, W. (2017 [1932]). Structural transformations of the state and the crisis of capitalism. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 51–72). Rowman and Littlefield International.
Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Lectures at the Collège de France 1978–79. Palgrave.
Friedman, M., & Friedman, R. (1984). Tyranny of the status quo. Harcourt Brace Jovanovich.
Friedman, M., & Friedman, R. (1990 [1988]). Free to choose. A personal statement. Harvest Books.
Hall, P. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275–296.
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
Hayek, F. A. (2001 [1944]). The road to serfdom. Routledge.
Hayek, F. A. (2003 [1982]). Law, legislation and liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Volumes I–III. Routledge.
Hayek, F. A. (2006 [1960]). The constitution of liberty. Routledge.
Innset, O. (2020). Reinventing liberalism. The politics, philosophy and economics of early neoliberalism (1920–1947). Springer.
MacLean, N. (2017). Democracy in chains. The deep history of the radical right’s stealth plan for America. Viking Press.
Mannheim, K. (1997 [1936]). Conservatism: A contribution to the sociology of knowledge. Collected works, Volume 11. Routledge.
El Mercurio. (1981). Friedrich von Hayek: Lider y maestro de liberalismo economico. El Mercurio, April 12, 1981, D8-9.
P. Mirowski, & D. Plehwe (Eds.). (2009). The road from Mont Pèlerin: The making of the neoliberal thought collective. Harvard University Press.
Peck, J. (2010). Constructions of neoliberal reason. Oxford University Press.
Peck, J. (2014). Pushing austerity: State failure, municipal bankruptcy and the crises of fiscal federalism in the USA. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 7, 17–44.
J. Reinhoudt, & S. Audier (Eds.). (2018). The Walter Lippmann Colloquium: The birth of neo-liberalism. Palgrave.
Röpke, W. (1950 [1942]). The social crisis of our time. University of Chicago Press.
Röpke, W. (1960 [1958]). A humane economy: The social framework of the free market. Henry Regenery.
Rüstow, A. (1959). [1929] Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie. Dokumentation des Vortrags und der Diskussion von 1929 and der Deutschen Hochschule für Politik. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 7(1), 85–111.
Rüstow, A. (1963). Rede und Antwort. Martin Horch.
Rüstow, A. (2017a [1942]). General sociological cause of the economic disintegration and possibilities of reconstruction. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 151–162). Rowman and Littlefield International.
Rüstow, A. (2017b [1932]). State policy and the necessary conditions for economic liberalism. In T. Biebricher & F. Vogelmann (Eds.), The birth of austerity: German ordoliberalism and contemporary neoliberalism (pp. 143–150). Rowman and Littlefield International.
Scheall, S. (2020). F.A. Hayek and the epistemology of politics. The curious task of economics. Routledge.
Slobodian, Q. (2018a). Globalists: The end of empire and the birth of neoliberalism. Harvard University Pres.
Slobodian, Q. (2018b). Neoliberalism’s populist bastards. in: Public Seminar. Available online at https://publicseminar.org/2018/02/neoliberalisms-populist-bastards/
Vibert, F. (2009). The rise of the unelected. Democracy and the new separation of powers. Cambridge University Press.
 Lesezeit 53 Minuten
Lesezeit 53 Minuten