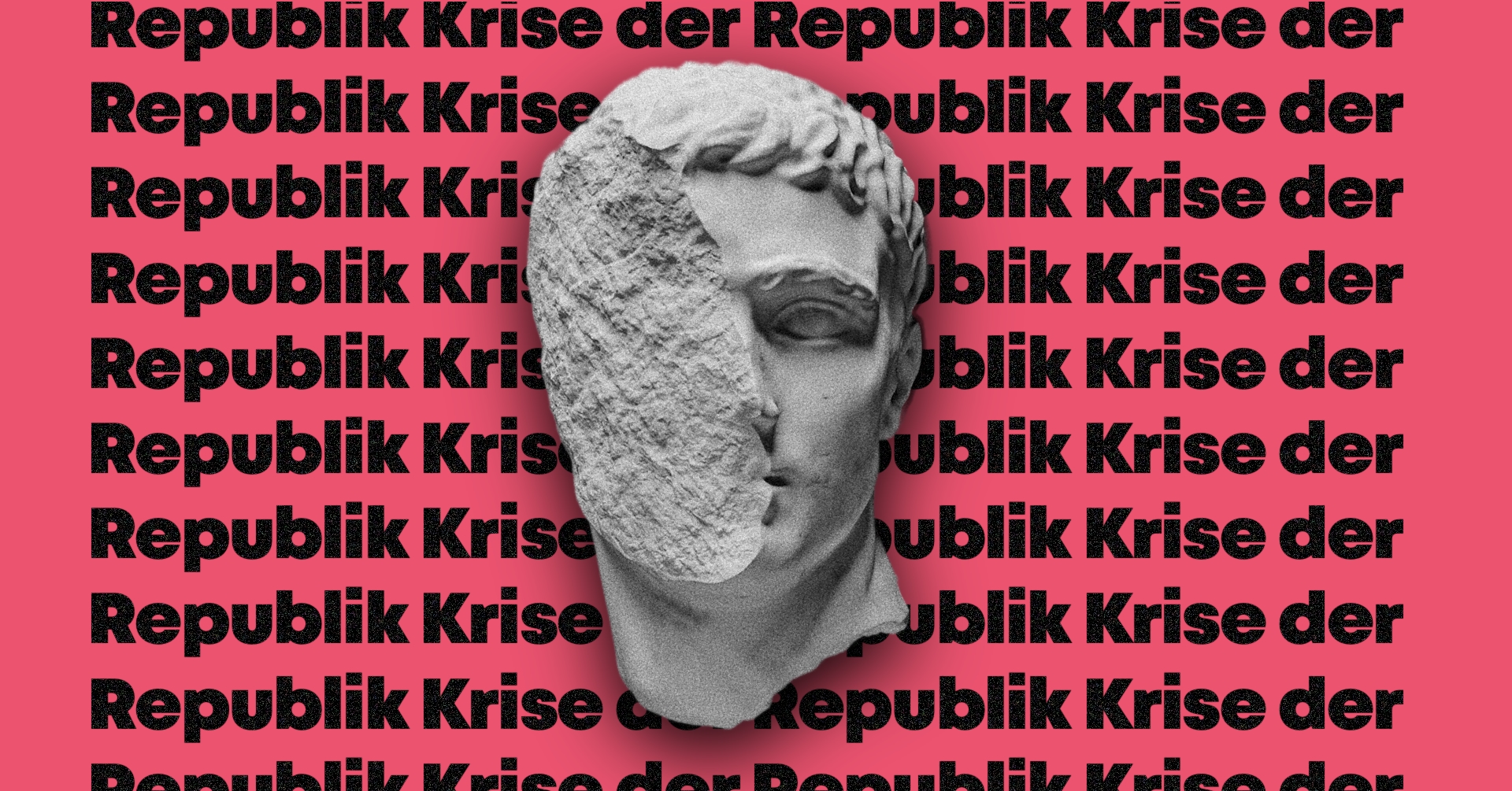
Postliberale Kapitalismuskritik
In Regime Change setzt der postliberale Vordenker Patrick J. Deneen seine Kritik am Liberalismus fort und flankiert sie mit einer moralisch motivierten Kapitalismuskritik. Angesichts neuer protektionistischer Maßnahmen der US-Regierung gewinnen seine Ideen neue Virulenz.
Der Liberalismus als Gesellschaftsordnung ist gescheitert: Mit dieser These in Buchform wurde der US-amerikanische Politikwissenschaftlicher Patrick J. Deneen 2018 auf einen Schlag zum gefragten Stichwortgeber für den politischen Diskurs. Inzwischen hat er ein neues Buch vorgelegt – Regime Change. Und wie der Titel verrät, wagt Deneen darin den Rollenwechsel vom kritischen Beobachter zum politischen Architekten. Sein Anspruch: Ein funktionaler und normativer Entwurf einer postliberalen Ordnung, die auch und gerade ein politisch-ökonomisches Zielbild umfasst.
Deneens Kapitalismuskritik klingt in vielem vertraut. Eine systematische Analyse des Kapitalismus und seiner Funktionsweise umgeht Deneen jedoch. Stattdessen setzt er darauf bestimmte Pathologien des Kapitalismus mit moralischem Vokabular zu kritisieren. Im Mittelpunkt steht dabei die zersetzende Wirkung des Kapitalismus auf traditionelle Bindungen und soziale Strukturen, vor allem auf die heteronormative Einheitsfamilie. Hier weist Deneens Kritik Parallelen zur Tradition der christlichen Kapitalismuskritik auf, die bis in die Gegenwart fortbesteht. 1 Casper, M., K. Gabriel & Hans-Richard Reuter 2016. Kapitalismuskritik im Christentum: Positionen und Diskurse in der Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik. Frankfurt: Campus Verlag und »Diese Wirtschaft tötet«. Dieser Satz aus dem Schreiben Evangelii Gaudium des damals neu gewählten Papstes Franziskus sorgte 2013 für weltweite Aufmerksamkeit und hitzige Diskussionen. Insgesamt greift Deneen eklektisch auf eine Reihe tradierter Topoi der Kapitalismuskritik zurück, ohne jedoch eine wirklich systematische gesellschaftstheoretische Ambition zu entwickeln. So avanciert beispielsweise Karl Marx zu einem Favoriten von Deneen; er wird mehrfach affirmativ zitiert, ohne dass dessen Kritik auch nur in Ansätzen entfaltet wird. Stattdessen konzentriert sich Deneen darauf, bestimmte Elemente Marxschen Denkens – etwa die Maßlosigkeit des Kapitalismus 2 Maßlosigkeit ist bei Marx keine moralische Kategorie, sondern eine Metapher, um die kapitalistische Dynamik der nur am Selbstzweck orientierten Akkumulation zu schildern. Vgl. Marx, K. & F. Engels 1962. Werke Bd. 23. »Das Kapital« Bd. I. Berlin: Dietz, S. 167. – in seine eigene Kapitalismuskritik einzuflechten. Dabei übernimmt er aber nicht die gesellschaftstheoretischen Prämissen von Marx, sondern münzt sie einfach moralisch um.

Alexander Schwitteck
Wenn Konservative über Klasse reden
Für Deneen steht die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Entfremdung und Verdinglichung durch Lohnarbeit nicht im Mittelpunkt. Auch die Eigentumsordnung wird von ihm nicht näher analysiert oder infrage gestellt. Verantwortlich für die gegenwärtigen Krisen – von der Klimakrise bis zur Finanzkrise – sind vielmehr die Funktionseliten des Managerkapitalismus. Seine Kritik richtet er vor allem gegen den von ihm polemisch bezeichneten »Woke Capitalism«. Dieser sei das Produkt der »perfect weeding of progressivist economic right and the social left.« 3 Deneen, P. J., 2023. Regime Change. Torwards a Postliberal Future. London: Forum, S. xii. Durch die Kombination von neoliberalem Kapitalismus und linkem Progressivismus erhalten Unternehmen eine übermäßige Macht, was sich auf gesellschaftliche Normen und politische Prozesse negativ auswirkt. Das veranschaulicht Deneen anhand eines Beispiels aus dem US-Bundesstaat Indiana. Im Jahr 2015 verabschiedete der dortige Senat den »Religious Freedom Restoration Act«, ein Gesetz zur Religionsfreiheit, das sich an bestehenden Regelungen auf Bundes- und Landesebene orientierte und darauf abzielte, religiöse Überzeugungen in Abwägung zu Antidiskriminierungsansprüchen zu stärken. 4 Zu diesem Gesetz und seinen Implikationen insbesondere im Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und Diskriminierung lässt sich viel sagen, ohne dass hier Platz ist, um die gesamte Problematik zu entfalten. Während Befürworter dieses Gesetzes die Religionsfreiheit gestärkt sahen, befürchteten Kritiker, dass es Unternehmen de facto erlauben würde, aufgrund von religiösen Überzeugungen LGBTQ*-Personen aus ihrem Kundenkreis auszuschließen und Dienstleistungen zu verweigern. Große Unternehmen wie Apple und Salesforce positionierten sich deshalb öffentlich gegen das Gesetz und drohten damit, ihre Standorte und Arbeitsplätze aus Indiana abzuziehen, sollte es nicht geändert werden. Letztendlich war dieser Druck erfolgreich und führte dazu, dass das Gesetz modifiziert wurde. Für Deneen symbolisiert dieser Fall die demokratiegefährdende liberale Allianz aus ökonomischen Machtinteressen und einer progressiven Ideologie. Mächtige Wirtschaftsakteure versuchen, demokratisch legitimierte Entscheidungen in ihrem Sinne zu steuern, insbesondere wenn diese Entscheidungen ihren Interessen widersprechen.
Deneens Analyse lenkt die Kritik also auf die sozialmoralische Ebene und konzentriert sich auf das Verhalten spezifischer Akteursgruppen. Zentral ist dabei die Unterscheidung zwischen Volk und Elite. »The many« werden dabei zur unterdrückten Klasse stilisiert, wobei sich Deneen in idealisierenden Beschreibungen ihrer vermeintlichen Tugenden ergeht, die er in scharfen Kontrast zu den als korrupt und dekadent dargestellten Charakterzügen der Elite setzt: Die »Vielen« besäßen anders als die rastlose »laptop class« beispielsweise ehrenwerten Lokalpatriotismus und gesunden Menschenverstand. 5 Deneen, P. J., 2023. Regime Change. Torwards a Postliberal Future. London: Forum, S. 23. Sie seien instinktiv konservativ, »grounded in the realities of a world of limits and natural processes, in tune with the cycle of life and rhythms of seasons, tides, sun and stars.« 6 Ebd.
Gemeinwohl-Konservatismus
In solchen Passagen deutet sich an: Regime Change atmet den Geist der »Retropie«. 6 Bauman, Z., 2018. Retropia. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Durchgehend finden wir die Verklärung der 1950er Jahre. Deneen preist die Ära der »industrial oligarchs«, die sich mit den nationalen Idealen identifizierten und als Philanthropen sichtbar in ihren Städten und Regionen gewirkt haben. Ihre Wirksamkeit und Verwurzlung kann man, wie Deneen betont, heute noch nachvollziehen anhand der von ihnen gestifteten Bibliotheken, Theatern und Schulen, die ihren Namen tragen. 7 Deneen, P. J., 2023. Regime Change. Torwards a Postliberal Future. London: Forum, S. 34. Sie stehen symbolisch für eine Zeit, in der man die destruktiven Kräfte eines entfesselten Kapitalismus abfedern wollte. Man findet bei Deneen sogar ein explizites Lob des Korporatismus der frühen Nachkriegszeit mit (relativ) starken Gewerkschaften. So lobt er explizit das deutsche System der Tarifpartnerschaft sowie die Idee der Betriebsräte. 8 Ebd., S. 171.
Das Besondere an dieser Zeit, so betont Deneen, war jedoch nicht so sehr die institutionelle Einhegung des Kapitalismus, sondern es war das Ethos der Elite. Während Deneen heute eine tiefe Kluft zwischen den Eliten und dem Volk hinsichtlich der Werte behauptet, waren sie in seiner Vorstellung in den 1950er Jahren annähernd deckungsgleich. Angeblich stützte sich die damalige Regierungsphilosophie auf korporatistische und christliche Werte der Solidarität und Subsidiarität. Sie durchdrang klassenübergreifend alle gesellschaftlichen Schichten und förderte damit eine weitreichende Angleichung von Werten. 9 Ebd., S. 162-163. Diese Philosophie will Deneen in neuer Form wieder herstellen. Dafür soll an eine »premodern common-good conservative tradition« 10 Ebd., S. 69. anknüpft werden, die auf der Idee beruht, dass es »objective conditions of good« gibt, die es erlauben, das Gemeinwohl universell zu bestimmen. 11 Ebd., S. 228. Dieses geht auch weit über die aggregierten Interessen einer bestimmten Gemeinschaft oder der einzelnen Bürger hinaus – eine Überzeugung, die tief in der katholischen Soziallehre verwurzelt ist. 12 Siehe Wolkenstein, F., 2024. The past and present of catholic anti‐liberalism in: Contemporary Political Theory. Was jedoch die Kriterien ganz konkret sind, an welchen man die Gemeinwohlkompatabilität testen kann, bleibt weitestgehend im Dunkeln. So argumentiert Deneen:
common good consists in those needs and concerns that are identified in the everyday requirements of ordinary people. The common good is the sum of the needs that arise from the bottom up, and that can be more or less supplied, encouraged, and fortified from the top down. In a good society, the goods that are common are daily reinforced by the habits and practices of ordinary people.
Deneen, P. J., 2023. Regime Change. Torwards a Postliberal Future. London: Forum, S. 230.
Wenn diese »habits and practices of ordinary people« als alleiniger Maßstab für die Konzeption des Gemeinwohls herangezogen werden, ergibt sich ein grundlegendes Problem: Eine systematische Kritik an der Gemeinwohlkonzeption wäre letztlich unmöglich, da es in dieser Denkweise keinen externen Kritikmaßstab geben kann. Deneens »Gemeinwohl«-Vorstellung ist insofern notwendig konservativ-christlich. Überhaupt bildet das Christentum bzw. der Katholizismus das implizite und unhintergehbare Wertefundament seiner Theorie und Analyse. Wie auch Carlotta Voß treffend herausstellt, sind es »die Kategorien von Gut und Böse, von Sünde und Gottgefälligkeit«, die in den Texten Deneens und seiner Mitstreiter immer wirksam bleiben. Sie fungieren nicht nur als semantische Rahmung ihrer Gegenwartskritik, sondern als normativer Anker, von dem aus vermeintliche Pathologien des Liberalismus benannt werden. Deneens Maßstäbe politischer und moralischer Kritik gründen letztlich in den geoffenbarten Wahrheiten des Evangeliums – auch wenn diese nicht immer explizit gemacht werden. 13 Voß, C., 2025. Für Gott und gegen das Böse. Die postliberale Ideologie oder: JD Vance verstehen. In: Internationale Blätter für Politik, 04/2025.
Nationale Wagenburg statt Weltmarkt
Um die liberale Ordnung zu stürzen, identifiziert Deneen als zentralen Hebel, den Elitenaustausch. Er empfiehlt ein »peaceful but vigorous overthrow of a corrupt and corrupting liberal ruling class«, um Platz für eine postliberale Elite zu schaffen. 14 Ebd., S. xiv[tooltip] In paternalistischer und karitativer Manier soll diese sich um das Volk kümmern. Deneen reserviert für diese Idee den Begriff des »Aristopopulismus«, der die Wiederverschmelzung von Volk und Elite in einer klassenübergreifenden Moral bezeichnen soll. [tooltip title=15]Ebd. S.152 Sobald die neuen Eliten an den Schaltzentren der Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Kultur sitzen, stellt sich jedoch die Frage nach der konkreten Umsetzung – nach den »richtigen« policies, die dem postliberalen Projekt Gestalt verleihen sollen. Doch sucht man bei Deneen vergeblich nach einem kohärenten Wirtschafts- oder Sozialprogramm. Stattdessen begegnet man einzelnen Vorschlägen, lose eingestreut, weder systematisch gebündelt noch auf eine tragfähige Analyse der gegenwärtigen politökonomischen Verhältnisse gestützt. Deneens Empfehlungen speisen sich vielmehr aus ideengeschichtlicher Reflexion. Indem Deneen die zentralen Dogmen des marktliberalen Denkens – den ökonomischen Kern des »konservativen« Liberalismus – explizit verwirft, öffnet er sich implizit einer Agenda, die man im kontinentaleuropäischen Kontext zumindest in Ansätzen als sozialdemokratisch bezeichnen könnte.
Deneens Projekt durchkreuzt die vertraute Einteilung des politischen Raums: Was sich als »linke« Kritik am entgrenzten Kapitalismus artikuliert, erscheint zugleich als »rechte« Rückbesinnung auf traditionelle Institutionen wie Familie, Glauben und gemeinschaftliche Bindung. So ist sein Postliberalismus »pro worker, favoring policies that protect jobs and industries within nations, urging more controlled immigration policies, supporting private-sector unions, and calling upon the power of the state to secure social safety nets targeted at supporting middle-class security.« 16 Ebd., S. 94. Deneen will keineswegs den Kapitalismus abschaffen, stattdessen will er eine Wirtschaftsordnung errichten, die anders als die jetzige im Kontext des Gemeinwohls eingebettet ist und das Gedeihen aller Klassen anstrebt, Sicherheit und Ordnung gewährleistet, starke und gesunde Familien ermöglicht und kommunale Formen des bürgerlichen und kirchlichen Engagements fördert. Auffällig – wenn auch kaum überraschend angesichts der nostalgischen Grundierung seiner politischen Agenda – ist Deneens dezidierte Aufwertung der heteronormativen Familie mit dem »single breadwinner«-Modell. Der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen, die dieses Modell wieder ökonomisch ermöglichen. 17 Ebd., S. 166. Im Zuge dessen lobt Deneen von der ungarischen Orban-Regierung aufgesetzte Programme und wünscht sich bezahlte Elternzeit, finanzielle Anreize dafür, mehr als drei Kinder zu bekommen, wie auch »generous grants« für Familien mit vielen Kindern. 18 Ebd., S., 182
Besonderen Wert legt er zudem auf die Entwicklung einer nationalen Wirtschaftspolitik, dessen Primat die Sorge um die nationale Verteilung von produktiver Arbeit ist, statt der Akkumulation massiver Vermögen bei einigen Wenigen. 19 Ebd., S. 166. Dazu gehört der Schutz der nationalen Industrie und Arbeitsplätze durch Schutzzölle und die Produktion von bestimmten als notwendig erachteten Gütern, die sogar staatlich vorgeschrieben werden soll. 20 Ebd., S. 179 Ein wichtigeres Instrument ist zudem die Subvention von inländischen Unternehmen. Gleichzeitig fordert Deneen eine massive Reduktion von Migration, um die inländischen Arbeitnehmer*innen vor Lohndumping zu schützen. Insbesondere soll die illegale Migration unterbunden werden und jene, die von ihr profitieren, hart bestraft werden. 21 Ebd., S. 181
Nimmt man diese Blumenstrauß an policies zusammen, ergibt sich das Panorama einer nationalen Kommandowirtschaft, in welcher globale Güter-, Finanz und Arbeitsmärkte keinen Platz mehr haben. Gleichzeitig offenbart sich eine eindeutige Ablehnung gegenüber dem Pluralismus, der liberale Demokratien heute prägt. An die Stelle des liberalen Pluralismus soll ein postliberaler, korporatistisch geprägtes Modell treten, das autoritäre Züge trägt – mit dem erklärten Ziel, ein vermeintlich objektiv bestimmbares Gemeinwohl zu verwirklichen, selbst wenn dies auf Kosten ökonomischer Effizienz geschieht. In diesem politikökonomischen Governance-Modell werden die Ansprüche von Individuen und Minderheiten systematisch dieser Gemeinwohlidee untergeordnet.
Postliberalismus als politisches Projekt
Deneen ist ein Einflüsterer der Mächtigen. Ob J. D. Vance oder Viktor Orban: Sie alle lesen Deneen und hören ihm zu. J. D. Vance spricht offen über den intellektuellen Einfluss von Deneen auf sein eigenes politisches Denken. Er bezeichnet sich selbst als Mitglied der »postliberalen Rechten«. 22 Devlin, B. & A. Kaliabakos 2024. The Right Reacts to ›Vice President J.D. Vance‹ [online] https://www.theamericanconservative.com/right-reacts-to-vice-president-j-d-vance/ Die von Donald Trump verhängten Zölle lassen sich im Lichte von Deneens Postliberalismus als Ausdruck einer politischen Wende deuten, die sich vom globalistisch geprägten Freihandels-Wirtschaftsliberalismus abwendet. Trumps protektionistische Maßnahmen entsprechen daher in ihrer Stoßrichtung dem postliberalen Denken, das ökonomische Steuerung wieder stärker an einer vermeintlichen Gemeinwohlorientierung und nationaler Selbstbestimmung ausrichten will – auch entgegen ökonomischer Vernunft. Deneens Wunsch, dem Interregnum, in dem wir uns befinden, seinen Stempel aufzudrücken und einen Leitstern für die postliberale Zukunft anzubieten, scheint teilweise in Erfüllung zu gehen.
Die Konzeption einer neuen Elite, geleitet vom Ethos eines gemeinwohlorientierten Konservatismus, die die diagnostizierten Pathologien der liberalen Moderne zu überwinden vermöchte, unterliegt jedoch einer grundlegenden Überschätzung der normativen Reichweite moralischer Appelle. Sie lebt von dem Phantasma, dass die Strukturprobleme der Moderne verschwinden würden, würde eine sozial-moralisch homogenisierte Gesellschaft hergestellt, die einen klassentranszendierenden Solidaritätsraum erzeugt. Deneens postliberaler Entwurf entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung weniger als Alternative zum liberalen Paradigma, denn als idealtypische Reminiszenz an vormoderne Ordnungsmodelle. Diese zeichnen sich zwar durch normative Geschlossenheit aus, bleibt jedoch gegenüber den Herausforderungen einer globalisierten, kulturell pluralen und funktional ausdifferenzierten Weltgesellschaft analytisch unterkomplex. Insofern enttäuscht der Postliberalismus durch seine theoretische Impotenz, die sich primär daraus speist mit den systemischen Eigenlogiken moderner Gesellschaften nicht zu rechnen.
 Lesezeit 13 Minuten
Lesezeit 13 Minuten









