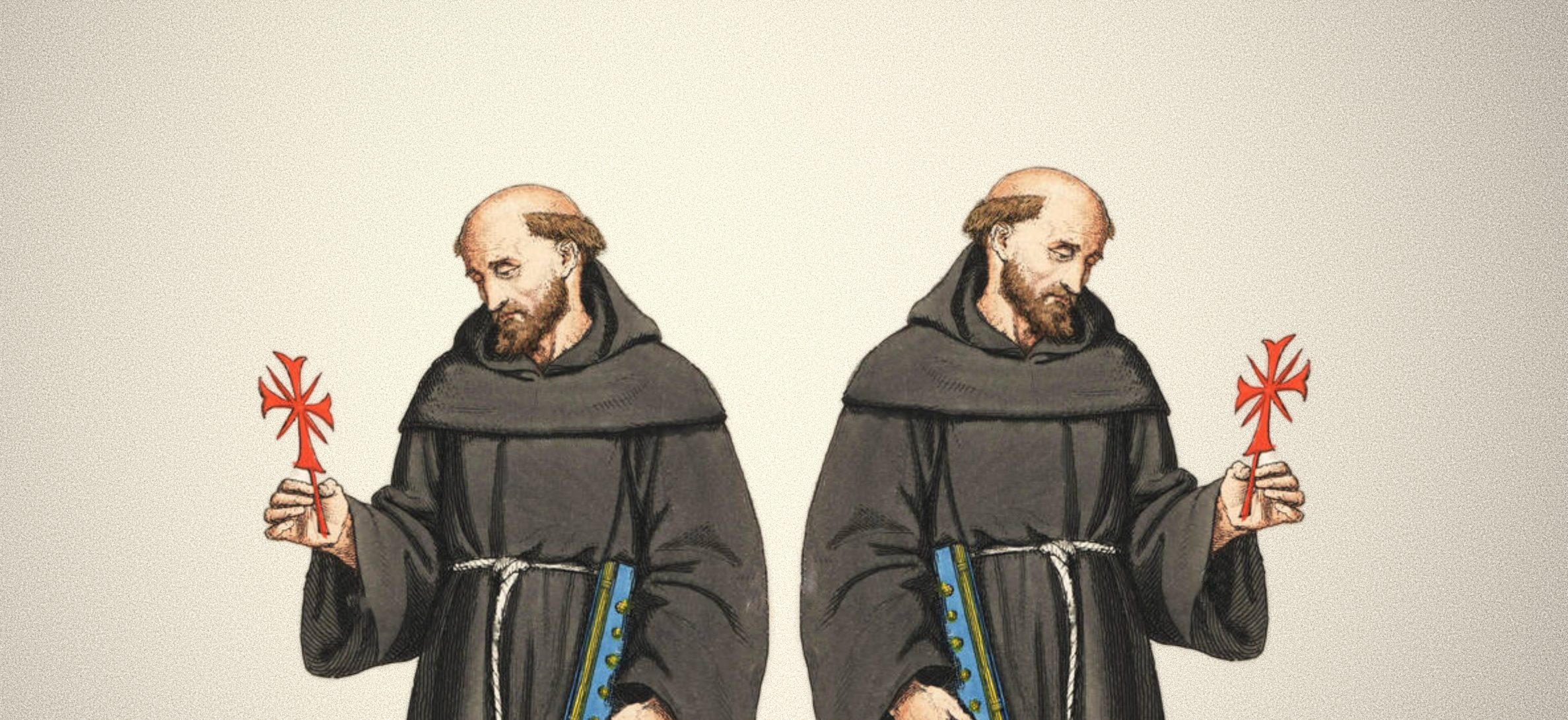Der lange Schatten Margaret Thatchers
Am 13. Oktober wäre Margaret Thatcher hundert geworden. Sie war die Frau, die Großbritannien umkrempelte, den Keynesianismus beerdigte und den Neoliberalismus zur politischen Doktrin erhob. Ihr Einfluss und Erbe wirkt bis in unsere heutige Gegenwart fort – als Vermächtnis einer Überzeugungstäterin, wie Thomas Biebricher schreibt.
Das politische Leben Margaret Thatchers ließe sich über weite Strecken in Anekdoten, ikonisierten Szenen und denkwürdigen Zitaten nachzeichnen. Eine dieser Anekdoten bezieht sich noch auf die Zeit, bevor sie als einfache Abgeordnete für den Wahlkreis Finchley ins Unterhaus einzog. Thatcher hatte Chemie studiert und arbeitete nach ihrem Abschluss Anfang der 50er Jahre unter anderem in der Lebensmittelindustrie. In diesem Zusammenhang, so die Erzählung, soll sie mit ihrer Forschungsarbeit zur Entwicklung des Soft-Eis beigetragen haben. Auch wenn sich die Geschichte nicht zweifelsfrei bestätigen lässt, ist sie zu gut, um sie unerwähnt zu lassen, denn bekanntlich war Thatcher als Politikerin das Gegenteil von soft. Bereits 1976, als sie noch als Parteichefin der Conservative Party die Opposition anführte, verlieh ihr Radio Moskau nach einer geharnischten Rede nach allen Regeln der Kunst des Kalten Krieges den Spitznamen ›Eiserne Lady‹. 1 Nicht zu verwechseln mit der ›Eisernen Jungfrau‹, Folterinstrument und Name der Heavy Metal Band Iron Maiden, die unmittelbar nach Thatchers erstem Wahlsieg durch ein kontroverses Album Cover von sich reden machte, auf denen sie erstochen abgebildet war.
Der Weg der jungen Politikerin an die Spitze des britischen Staates war alles andere als unvermeidlich. Nachdem ihr Vorgänger Edward Heath 1974 als amtierender Premierminister die Unterhauswahlen verloren hatte, war es einzig die Uneinigkeit des Partei-Establishments, die dazu führte, dass die als unerfahren und radikal geltende Thatcher sich in den parteiinternen Wahlen gegen Heath und seine Thronprinzen durchsetzen konnte und den Vorsitz übernahm. Dabei machte sie sich keine Illusionen über die ideologischen Machtverhältnisse in ihrer Partei: Die eher zentristische Tradition des ›One-Nation-Conservatism‹ wenn nicht gar die Tory-Labor-Synthese des sogenannten Butskellitismus verzeichneten zahlreiche Anhänger und in der Vergangenheit hatten auch konservative Regierungen immer wieder auf Instrumente der keynesianischen Nachfragepolitik zurückgegriffen. Von daher war es konsequent und weitsichtig, dass Thatcher gemeinsam mit ihrem wohl engsten wirtschaftspolitischen Berater Keith Joseph ebenfalls im Jahr 1974 das Centre for Policy Studies ins Leben rief, welches sich den immer noch vorherrschenden Orthodoxien des Keynesianismus widersetzte und darauf abzielte, die ideologischen Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Konservativen Partei zugunsten einer stärker neoliberal geprägten Ausrichtung zu verändern. Noch Jahre später sollten Thatcher und ihr engster Führungszirkel regelmäßig sondieren, wie es um die Kräfteverhältnisse zwischen ›wets‹ (Thatcher-Gegnern) und ›drys‹ (ihren Unterstützer) innerhalb der Partei bestellt war.

Thomas Biebricher
»This is what we believe!«
Laut Thatcher hatte Hayeks Der Weg zur Knechtschaft bereits großen Eindruck auf sie gemacht, als sie das Buch in jungen Jahren gelesen hatte, aber man tritt ihr wohl nicht zu nah, wenn man hier die Rolle des erwähnten Joseph hervorhebt, der Thatcher weite Teile des neoliberalen Ideenkosmos nahebrachte und zwar nicht zuletzt auch die von Friedman geprägte Theorie des Monetarismus. So wurde aus ihr eine neoliberale Überzeugungstäterin, die einst laut einer weiteren Anekdote zu Beginn einer Kabinettssitzung Hayeks Verfassung der Freiheit mit den Worten auf den Tisch warf: »Das ist es, woran wir glauben!« Tatsächlich muss man festhalten, dass Thatcher zumindest zu Beginn ihrer ersten Amtszeit zu den wenigen Politikern gehörte, die neoliberale Rezepte gewissermaßen direkt aus den Schriften der Vordenker umzusetzen versuchte. Während Reagans Version neoliberaler Politik eher vermittelt und selektiv auf den neoliberalen Policy-Werkzeugkasten zurückgriff, versuchte Thatchers erste Regierung von Beginn an, eine der Kernforderungen Milton Friedmans eins zu eins umzusetzen: In Reaktion auf die sogenannten Stagflationskrisen, deren Erklärung und Bewältigung den Keynesianismus vor enorme Problem stellte, machte Thatcher die Bekämpfung der Inflation zur höchsten Priorität und zwar mit dem Versuch, die Geldmenge und ihre Ausweitung strikt zu reglementieren, wie es Friedman immer wieder gefordert hatte. Die Rechnung ging insofern auf, als man die Inflation mit Hilfe der kontraktiven Geldpolitik tatsächlich in den Griff bekam. Der Preis, den Großbritannien dafür zahlte, war allerdings beträchtlich: Die Verknappung des Geldangebots führte erwartungsgemäß zu einer schweren Rezession, zu deren Hauptleidtragenden die Arbeiter in den Midlands mit ihrem Industriesektor gehörten. Es war der erste Schritt in Richtung einer Deindustrialisierung, die das Profil der britischen Volkswirtschaft nachhaltig zugunsten von Dienstleistungs- und Finanzsektor verändern sollte. Und es war eine durchaus riskante Strategie, denn die Wirtschaftskrise ließ unweigerlich die Arbeitslosigkeit ansteigen. Ganz im Geist von Friedman und Hayek erklärte sich die Regierung aber als nicht mehr zuständig für Konjunktur und eben auch Arbeitslosigkeit, da schließlich nur der Keynesianismus an so etwas wie eine Globalsteuerung der Wirtschaft glaube. Es ist aber zweifelhaft, ob Thatcher diese Krise politisch überlebt hätte (zumal in einer Conservative Party, die noch ziemlich ›wet‹ war), wenn ihr das argentinische Militär im April 1982 nicht den Gefallen getan hätte, die von der Junta ebenso wie von Großbritannien beanspruchten Malwinas (Falklandinseln) zu besetzen. Thatcher ergriff die ihr gebotene Gelegenheit und blies zum Kampf, als ob es um die Verteidigung des längst verlorenen Empires ginge. Damit erhielt der thatcheristische Diskurs sein zweites Standbein in Form eines Nationalpopulismus im Namen des nach innen und außen ›starken Staates‹ – tatsächlich lautet die kompakteste Formel des Thatcherismus wie auch des Neoliberalismus insgesamt: Starker Staat und freie Wirtschaft.
Großbritannien ging erwartungsgemäß als Sieger aus dem Falklandkrieg hervor und in der hochpatriotisch aufgeladenen Atmosphäre, in der ein gehöriges Maß an imperialer Nostalgie mitschwang, gewann Thatcher, inszeniert als Oberste Befehlshaberin in der Tradition Churchills, die Unterhauswahlen 1983 – und zwar mit einem Erdrutschsieg. Mit diesem Erfolg im Rücken, der ihre Stellung in der eigenen Partei vorübergehend festigte, hatte Thatcher ausreichend Beinfreiheit, um die Ausweitung ihrer Regierungsagenda und deren Radikalisierung einzuläuten. Die Geldmengenpolitik der ersten Amtszeit war eine kalkulierte Schocktherapie gewesen, aber auf einen recht spezifischen Bereich konzentriert – wenn auch mit weitreichenden Folgen. Nun fuhr die Regierung den orthodoxen Monetarismus zurück und nahm sich einer Vielzahl anderer Themen an, um neoliberale Reformrezepte zu erproben: Eine ganze Reihe von Staatsunternehmen von British Airways bis British Steel wurden verkauft, wobei die erste und überaus populäre Privatisierungsmaßnahme den Bestand an kommunalen Wohnungen betraf, die unter staatlicher Subventionierung von den Mietern erworben werden konnten. Im Gesundheitswesen begann man damit, dem National Health Service (NHS) privatwirtschaftliche Elemente zu implantieren, indem man beispielsweise vorschrieb, die Erbringung bestimmter Leistungen auch privat auszuschreiben (compulsive competitive tendering). Der Strukturwandel der britischen Volkswirtschaft und die Stärkung des Standorts London wurde durch die Deregulierung des Finanzsektors – dem sogenannten Big Bang 1986 – vorangetrieben. Einkommens- und Unternehmenssteuern wurden teils drastisch gesenkt, Verbrauchssteuern erhöht, was in Kombination mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu einer dramatischen Zunahme sozialer Ungleichheit führte. Der robuste Individualismus, in dessen Namen all dies geschah, spiegelte sich auch in Thatchers Bild von Gesellschaft wider, dass vor allem durch deren Abwesenheit gekennzeichnet war. 1987 äußerte sie im Hinblick auf die »Gesellschaft«, auf die sich zu viele verließen: »So etwas gibt es gar nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen und die Regierung kann nur durch diese Menschen handeln und die Menschen kümmern sich in erster Linie um sich selbst.«
Autoritärer Populismus und Post-Thatcherismus
Und dann gab es da noch die Gewerkschaften, die in Thatchers zweiter Amtszeit ins Fadenkreuz der Regierung rückten. Durch die Rezession zu Beginn der Dekade bereits angeschlagen sahen die Gewerkschaften sich mit diversen Versuchen ihrer weiteren Schwächung konfrontiert. So ging Thatcher gegen die Praxis des ›closed shop‹ vor, durch welche die Gewerkschaftsmitgliedschaft für eine Anstellung in einer Vielzahl von Betrieben faktisch zur Voraussetzung gemacht wurde. Doch reichte das Vorgehen bis hin zur diskursiven Agitation. Unter Thatchers Regierung wurde die Figur des ›inneren Feindes‹ zwar nicht in den Diskurs eingeführt, aber eben salonfähig gemacht, wodurch nordirische Terroristen sich ebenso brandmarken ließen wie Gewerkschaftler und – zunehmend – rassifizierte Einwanderungs-Communitys (oftmals aus ehemaligen Kolonien). Der marxistische Kulturtheoretiker Stuart Hall prägte in diesem Zusammenhang den Begriff des »autoritären Populismus« als Kern des Thatcherismus. Die Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften spitzten sich immer weiter zu bis zum Standoff mit der National Union of Mineworkers 1984/85. Der von den Bergleuten ausgerufene Streik, um Zechenschließungen bzw. –privatisierungen zu verhindern, dauerte ein ganzes Jahr und über die Monate kam es immer wieder zu Ausschreitungen am Rande von dem, was seinerzeit als ›bürgerkriegsähnliche Zustände‹ beschrieben wurde. Thatcher blieb eisern und scheute nicht davor zurück, ebenjene Faust des Staates gegen die Streikenden und ihre Sympathisanten einzusetzen. Der Ausstand endete im März 1985 ergebnislos und von dieser Niederlage erholten sich weder die Bergarbeiter noch die einstmals mächtigen britischen Gewerkschaften insgesamt. Dabei waren jene nur eine von diversen Bastionen anti-thatcheristischer Opposition, die Thatcher systematisch bekämpfte. Dazu gehörte die BBC ebenso wie das Oberhaus, aber auch die Ebene der Kommunalpolitik, die oftmals von Labour-Politikern genutzt wurde, um die Regierungspolitik vor Ort zu sabotieren. Der Grad der Machtzentralisierung im britischen Regierungssystem war von je her hoch, gab es doch weder föderale Strukturen, noch ein starkes Verfassungsgericht und auch nur selten Koalitionsregierungen in der parlamentarischen Monarchie. Ein Teil der Thatcher-Agenda bestand ganz ausdrücklich darin, diese Zentralisierung der Macht in No. 10 noch weiter zu forcieren, um so die politischen Hebel für die angestrebten Reformen zu erlangen und Veto-Spieler, seien es Personen, Organisationen oder Institutionen, zu neutralisieren. Nicht von ungefähr hieß es damals leicht sarkastisch über die Regierungschefin, sie könnte an keiner Institution vorbeilaufen, ohne dieser einen Schlag mit ihrer Handtasche mitzugeben. Doch bei aller Radikalität und autoritären Anmutungen schreckte Thatcher dennoch vor dem Äußersten zurück: Als Hayek ihr einst brieflich riet, sich doch den ›Reformeifer‹ des Pinochet-Regimes in Chile zum Vorbild zu nehmen, lehnte sie höflich, aber bestimmt mit dem Verweis auf die britische Tradition des Konstitutionalismus ab.
Eine Ironie des Thatcherismus bestand darin, dass seine Protagonistin eine Agenda verfolgte, die in den Lehren der Public Choice-Theorie und dem Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus wurzelte, die aber selbst gerade nicht die Strategie der rationalen Nutzenmaximierung im eng verstandenen Eigeninteresse verfolgte. Denn Thatcher war keine rationale Opportunistin, deren politisches Handeln weitgehend prinzipienlos und in erster Linie vom Motiv, ihre Wiederwahl sicherzustellen, geleitet gewesen wäre, wie es die Public-Choice-Schule nahelegt und woraus sie eine beständige Tendenz zum Staatsversagen ableitet. Die Premierministerin war Überzeugungstäterin und verfolgte eine Agenda bisweilen auch dann, wenn sie politisch extrem inopportun war – und dies sollte sie letztlich die Macht kosten. Thatcher hatte die Wahl 1987 abermals gewonnen – drei Wahlsiege in Folge waren zuletzt dem Zweiten Earl of Liverpool zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelungen – aber sie war auch in der eigenen Partei nicht mehr unumstritten. In den Folgejahren verrannte sie sich zusehends in einen europakritischen Kurs, den sie freilich bereits zu Beginn ihrer Amtszeit bei ihrem ersten EU-Gipfel eingeschlagen hatte, als sie – eine weitere Anekdote – auf den Tisch schlug und den übrigen Staats- und Regierungschefs zu verstehen gab: »Ich will mein Geld zurück und ich will es jetzt.« Der 1984 eingeführte sogenannte ›Britenrabatt‹ war die Folge dieser unnachgiebigen Haltung, doch er beruhigte die Verhältnisse zwischen EU und UK nicht, sondern schien Thatchers europaskeptischem Furor noch mehr Nahrung zu geben. Aber weder wurde dieser in weiten Teilen der Bevölkerung geteilt, noch in den höheren Etagen und wirtschaftsnahen Kreisen der Conservative Party, wo man sich der ökonomischen Vorteile einer EU-Mitgliedschaft – noch dazu zu einem ermäßigten Mitgliedsbeitrag – wohl bewusst war und kein Interesse an einer völligen Zerrüttung der Verhältnisse hatte. Thatcher blieb jedoch unbeirrt, oder auch völlig beratungsresistent bei ihrem Kurs und manövrierte sich so zusehends ins Abseits. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war allerdings die Einführung einer Kommunalabgabe, der sogenannten Poll Tax. Das Kalkül der Regierung bestand darin, der Kommunalpolitik und in gewisser Weise der gesamten öffentlichen Infrastruktur vor Ort ein Preisschild anzuhängen und damit die Stellung von Kommunalpolitikern und Local Councils zu schwächen. Doch dieses Kalkül erwies sich als zu durchsichtig und gegen die als Kopfsteuer stigmatisierte Poll Tax formierte sich breiter Widerstand. Und abermals beharrte Thatcher in konsequent nutzenminimierender Art und Weise auf der Abgabe und plötzlich war sie nach elf Jahren als Regierungschefin nicht mehr unantastbar, sondern wurde durch ihre Herausforderer Michael Hesseltine und John Major zum Rücktritt genötigt. Am 28. November 1990 beerbte letzterer Thatcher als Premierminister und damit brach die lange Ära des Post-Thatcherismus an, die in gewisser Weise bis heute andauert.
What would Maggie do?
Thatchers Erbe war komplex und weitreichend; in mancherlei Hinsicht war die Langzeitwirkung ihrer Politik womöglich sogar größer als die unmittelbaren Effekte. Denn bei allen gewollten und ungewollten Folgen und Erfolgen des Thatcherismus standen etwa sowohl NHS als auch BBC noch immer als Thatcher abtreten musste, und sie erfreuten sich laut Umfragen sogar einer noch größeren Unterstützung in der Bevölkerung als zuvor. Aber selbst wenn die kurzfristigen Erfolge stellenweise hinter den Ambitionen zurückblieben, die man unter Thatcheristen gehegt hatte, waren die Auswirkungen mittel- und langfristig umso beeindruckender – und Thatcher war sich darüber im Klaren. Gefragt nach ihrem größten Erfolg, antwortete sie ohne groß zu überlegen: »Tony Blair«. In der Tat war das Versprechen des New Labor-Premiers in spe, die zentralen Pfeiler thatcheristischer Politik im Falle eines Wahlsiegs unangetastet zu lassen, der eindeutige Nachweis der Hegemonie des Thatcherismus, dem auch der politische Gegner zumindest seine passive Zustimmung nicht vorenthalten konnte bzw. wollte. New Labor führte also (nach dem kurzen Intermezzo Majors) den Kurs des Thatcherismus mutatis mutandis fort. Beeindruckt von den elektoralen Erfolgen New Labors (und deren Vorbild, den New Democrats in den USA) fand ihr Kurs eine Reihe von Nachahmern unter den Sozialdemokratien Europas, was pointiert gesagt aber auch den Anfang des Niedergangs der europäischen Sozialdemokratie einläutete, die sich etwa in Deutschland, Frankreich und Großbritannien immer mehr von ihrer ehemaligen Stammklientel der Arbeiterschicht und der popularen Klassen entfremdete. Man darf historische Kausalketten nicht überstrapazieren, aber diese Entwicklung lässt sich auch auf den Thatcherismus und seine Hegemonialisierung zurückführen.
Das Erbe, das sie ihrer eigenen Partei und damit indirekt auch der britischen Politik vermachte, ist bis heute zumindest ambivalent. Nach Majors Wahlniederlage 1996 dauerte es mehr als zehn Jahre, bis die Konservativen wieder die Regierung stellen konnten, während derer man sich unzählige Male um die Frage drehte, wie man sich zum Erbe Thatchers stellen sollte, das eben zunächst einmal New Labor erfolgreich angetreten hatte. Daraus entwickelte sich in Teilen der Partei eine Art retrospektiver Thatcher-Kult, für den etwa der ehemalige Minister und Abgeordnete Norman Tebbit stand, der die konservative Renaissance an die Rückkehr zu den vermeintlichen Prioritäten der Thatcher-Jahre geknüpft sah: Steuersenkungen, Einwanderungsbegrenzung und Europaskepsis. Dieses Glaubensbekenntnis bezeichnete keineswegs immer die Mehrheitsmeinung in der Konservativen Partei, aber in den 2010er Jahren erstarkten die post-thatcheristischen Hardliner und erzwangen bekanntlich von David Cameron das Referendum, das mit dem Brexit endete. Zu Tebbits dreifaltiger Doktrin bekennt sich heute die große Mehrheit der Tories, ganz zu schweigen von Reform UK. Thatchers langer Schatten reicht also auch in dieser Hinsicht bis in die jüngste Vergangenheit. Das inoffizielle Motto der von Tebbit mitgegründeten Tory-Parlamentarier-Gruppe Conservative Way Forward lautet ›What would Maggie do?‹ und die gleiche Frage hatte sich zweifellos auch Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss gestellt, bevor sie sich in Anlehnung an ein berühmtes Foto von Thatcher in einem Panzer ablichten ließ. Auch gute zehn Jahre nach ihrem Tod 2013 prägt das Erbe Thatchers, die am 13. Oktober 2025 ihren hundertsten Geburtstag gefeiert hätte, so die Politik in Großbritannien – und darüber hinaus.
 Lesezeit 13 Minuten
Lesezeit 13 Minuten