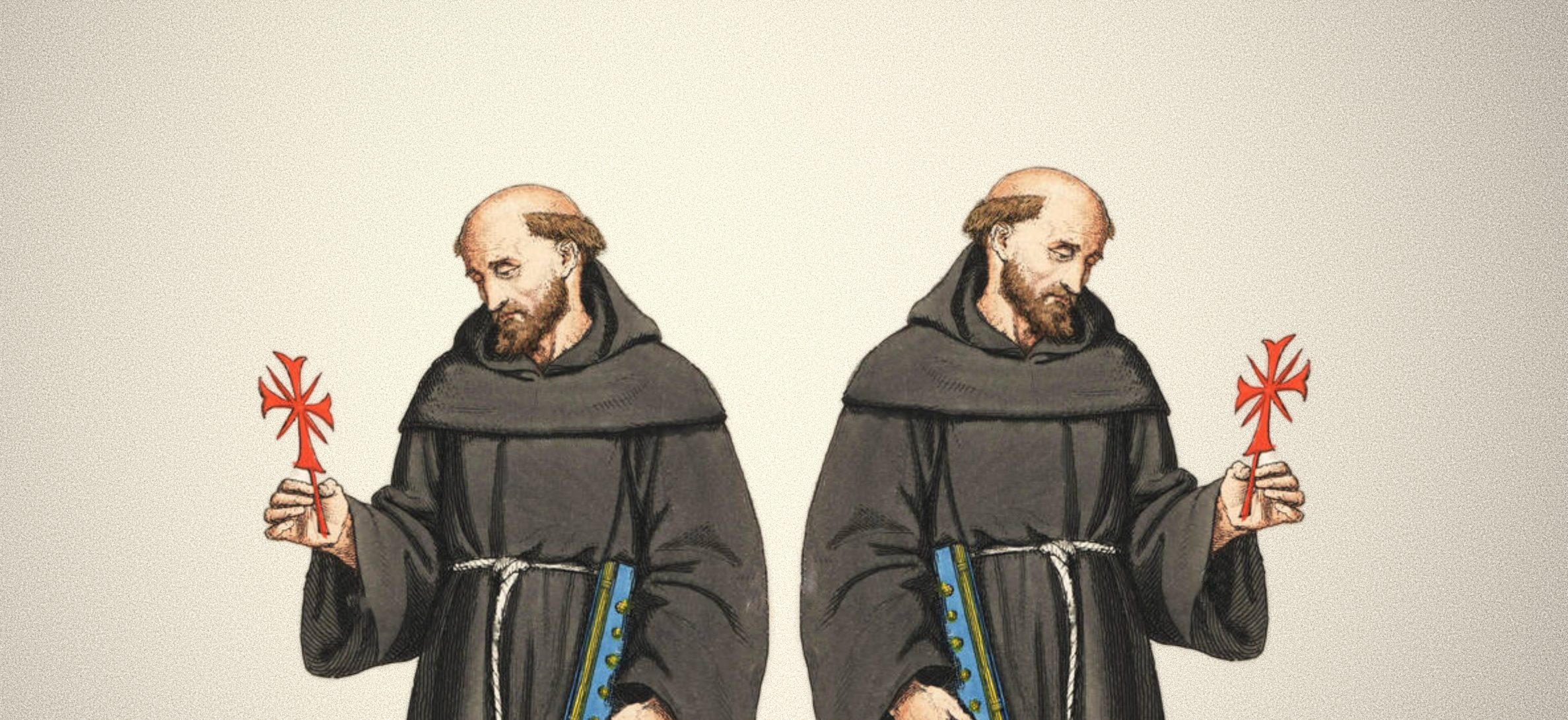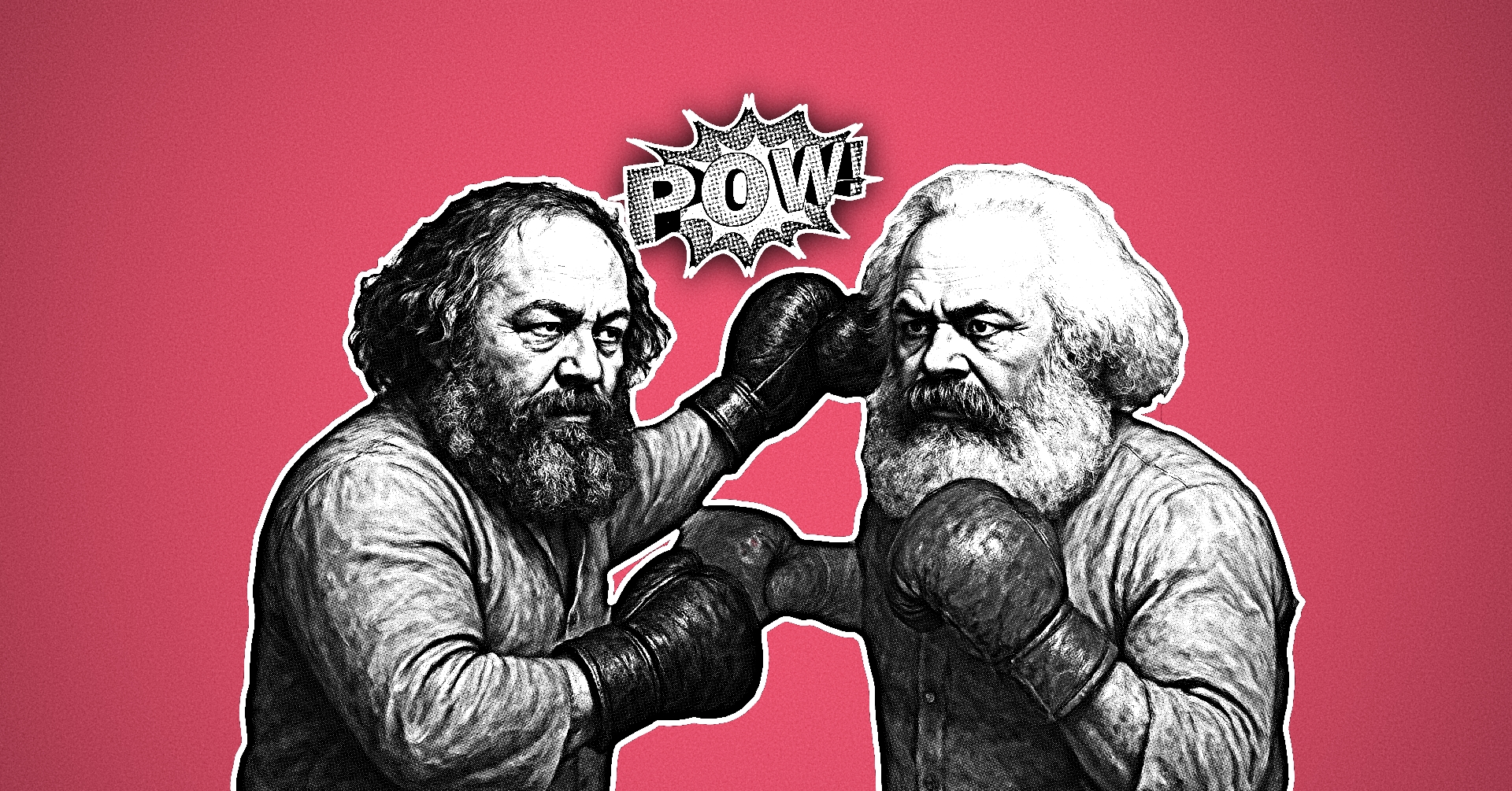
Grafik P&Ö
»Verein von Egoisten«
Libertäre in rebellischer Pose: Marc Püschel schreibt über die Marxsche Kritik an den Anarchisten und darüber, warum die Gleichsetzung aller Staaten als Unterdrückungsinstrumente zur Einebnung politischer Differenzen und Vernachlässigung ökonomischer Machtverhältnisse führt.
Weder davor noch danach hat es wohl eine so prominent besuchte Vorlesung in Deutschland gegeben wie diejenigen Schellings in Berlin Anfang der 1840er Jahre. Die politisch hochaufgeladenen »Vorlesungen zur Philosophie der Offenbarung«, die laut König Friedrich Wilhelm IV. zugeschriebenen Worten der Ausrottung der »Drachensaat des Hegelschen Pantheismus« dienen sollten, besuchten unter anderem Carl von Savigny, Sören Kierkegaard, Alexander von Humboldt, Ferdinand Lassalle, Johann Gustav Droysen, Jacob Burckhardt, Leopold Ranke und Friedrich Engels. Zu den zahlreichen ausländischen Studenten, die – wie Kierkegaard – der Ruf des Deutschen Idealismus nach Berlin lockt, zählte auch Michail Bakunin. Der junge Russe aus adligem Hause, der sich politisch rasch radikalisierte, machte Eindruck. Noch am Ende seines Lebens entsann sich Engels in einem Brief daran, dass Bakunin in einem Logik-Kolleg vor ihm saß. Doch es ist keine ungetrübte Erinnerung. Jahrzehnte nachdem sie gemeinsam die Studienbank gedrückt haben, wird sich zwischen Bakunin auf der einen, Engels und Marx auf der anderen Seite, eine Feindschaft entwickeln, die zu den entscheidenden politischen Weichenstellungen des 19. Jahrhunderts zählt.
Kampf um die Internationale
Im Zentrum der Auseinandersetzung, in deren Ergebnis sich Marxismus und Anarchismus voneinander trennen, stand die Frage um die im September 1864 in London gegründete »Internationale Arbeiter-Association« (IAA), die man später die Erste Internationale nennen wird. Die IAA war ein loses Bündnis. Zwar wählte ein jährlich zusammentretender Kongress einen koordinierenden Generalrat, doch dessen genaue Befugnisse blieben lange Zeit unklar. In den einzelnen europäischen Ländern konnten regionale Sektionen und übergeordnete Föderationen der IAA beitreten. Jede Sektion durfte einen Delegierten zum Kongress entsenden, egal, wieviel Mitglieder sie hatte – Streit war vorprogrammiert.
Von Anfang an war die IAA ein »Kind« von Marx, der das Programm und das Statut schrieb und seit der Gründung dem Generalrat angehörte. Erst ein paar Jahre später, 1868, schloss sich Bakunin der Genfer Sektion der IAA an. Zu dem Zeitpunkt konnte der Revolutionär bereits auf ein bewegtes Leben zurückblicken. 1814 im heutigen Kalinin geboren, studierte er zunächst an russischen Militärschulen, bevor er 1840 nach Berlin ging. 1848 beteiligte er sich in Sachsen an der bürgerlichen Revolution, wurde allerdings festgenommen und zuerst nach Österreich, dann nach Russland abgeschoben. Aus seiner Festungshaft konnte er erst 1861 fliehen. Fortan verbrachte er sein Leben als durch Europa ziehender »Revolutionstourist«. In der Schweiz organisierte er sich in der »Allianz der sozialistischen Demokratie«, die sich um eine Aufnahme als Sektion in die IAA bemühte, aber abgelehnt wurde.
Das Bestehen paralleler Strukturen wurde zum Katalysator des Streits. Umkämpft war vor allem die Frage, welche Befugnisse dem Generalrat als exekutivem Gremium zukommen sollten. Der Streit wurde daher vorrangig als organisationspolitischer geführt – doch im Hintergrund prallten auch zwei völlig divergierende politische Positionen aufeinander.

Marc Püschel
Nach dem kriegsbedingten Ausfall des jährlichen IAA-Kongresses 1870 fand im September 1871 nur eine »Konferenz« in London statt, zu dem 13 Mitglieder des Generalrats und 23 Delegierte kamen, bei einer freilich sehr undurchsichtigen Einladungspraxis. In Abwesenheit von Bakunin nutzen Marx und Engels diese Konferenz zu einer klaren politischen Ausrichtung der IAA. Bakunin und sein Anhänger James Guillaume wollten den Generalrat zu einem »Bureau für Korrespondenz und Statistik« zurechtstutzen und lehnten es ab, die Arbeiterbewegung in Parteien zu organisieren. In London erhielt der Generalrat jedoch mehr Befugnisse. Dazu brachten Marx und Engels folgende Resolution ein: »In Erwägung, daß gegen die kollektive Gewalt der besitzenden Klassen das Proletariat als Klasse nur dann auftreten kann, wenn es sich als besondere politische Partei konstituiert, im Gegensatz zu allen alten Parteibildungen der besitzenden Klassen; (…) ruft die Konferenz den Mitgliedern der Internationale in Erinnerung, daß in dem Kampfzustand der Arbeiterklasse ihre ökonomische und ihre politische Betätigung untrennbar verbunden sind.«
Ein Jahr später fand, vom 2. bis 7. September 1872, der nächste reguläre Kongress der IAA in Den Haag statt. Dort wurde die besagte Resolution mit 29 zu 5 Gegenstimmen in die Statuten aufgenommen. Mit ähnlichen Stimmenverhältnissen beschloss der Kongress, auf dem insgesamt 67 Delegierte waren, den Ausschluss von Bakunin und Guillaume.
Von anarchistischer Seite ist dies als Zeichen des Totalitarismus gewertet worden und in der Tat zeigten sich Marx und Engels hier als geschickte Machtpolitiker, die vorab sicherstellten, dass die Mehrheit in Den Haag auf ihrer Seite war, indem sie gezielt Delegierte »organisierten«. In dem Vorgehen der beiden mag man auch den Beginn einer unheilvollen Tendenz in der marxistischen Bewegung erkennen, politische Gegner nicht argumentativ, sondern durch den Vorwurf der Verschwörung zu erledigen. Denn der Kern der Kritik an Bakunin bestand darin, dass die – offiziell 1871 aufgelöste – Allianz der sozialistischen Demokratie weiterbestünde und als Geheimorganisation von Bakunin genutzt werde, um die IAA zu unterwandern. Enge Mitstreiter von Marx, darunter Wilhelm Liebknecht, kolportieren zudem Gerüchte, Bakunin sei ein russischer Spion.
Doch abgesehen davon, dass auch die Anarchisten Marx unterstellten, er stecke mit Bismarck unter einer Decke, zeigt die Geschichte der IAA, dass Marx und Engels keine Dogmatiker waren und die Heterogenität der Bewegung anerkannten. Der Zweck der IAA wurde von Marx im Statut absichtlich vage gehalten. Voraussetzung für die Mitarbeit war lediglich, das gemeinsame Ziel anzustreben: »den Schutz, den Fortschritt und die vollständige Emanzipation der Arbeiterklasse.« 1 MEW 17, 441 Doch dass die IAA eine politische Vereinigung darstellte, die eine gewisse Struktur besitzen musste, um handlungsfähig zu sein, war für Marx und Engels conditio sine qua non des ganzen Zusammenschlusses. Gerade dies allerdings griff Bakunin an.
Gegensätzlich aber gleich
Wer den Streit zwischen Marxismus und Anarchismus nachvollziehen will, muss ihn bis an die Ursprünge, die theoretischen Kämpfe der 1840er Jahre zurückverfolgen. Damals fochten Marx und Engels gegen den französischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon und den deutschen Junghegelianer Max Stirner, als deren Epigonen sie später Bakunin sehen.
Gegen Proudhon wandte Marx ein, dass er »die Kategorien vergöttlicht, die die bürgerlichen Verhältnisse in der Form des Gedankens ausdrücken. Er hält die Produkte der bürgerlichen Gesellschaft für spontan entstandene, mit eigenem Leben ausgestattete ewige Wesen, da sie sich ihm in der Form von Kategorien, in der Form des Gedankens darstellen.« 2 MEW 4, 554f. Entsprechend bemühte Marx sich in seiner Schrift »Das Elend der Philosophie« (1847) vorrangig darum, Proudhons Verständnis ökonomischer Kategorien zu kritisieren.
Anders stellt es sich bei Stirner dar. Er radikalisierte die Hegel-Kritik der Junghegelianer, die dem schwäbischen Philosophen vorwarfen, bei ihm verselbständige sich der Begriff, das Allgemeine, während das lebendige Sein, der einzelne Mensch nur akzidentiell sei. Der individuelle Mensch sei für Hegel nichts, die Menschheit bzw. der »Weltgeist« sei alles. Diese, an den eigentlichen Gehalten der Hegelschen Philosophie weit vorbeizielende Kritik wurde von Stirner auf die Spitze getrieben, indem er jegliches Allgemeine ablehnte: »Jedes höhere Wesen, wie Wahrheit, Menschheit usw., ist ein Wesen über uns.« 3 Stirner, 49 Dies sei vergleichbar knechtend wie die Unterordnung unter einen Gott in der christlichen Religion.
Entsprechend hätte auch keine Instanz, in der sich ein allgemeines Interesse manifestiert, egal ob Kirche, Nation, Staat oder Partei, eine Berechtigung. Stirner zieht die radikale Konsequenz: »Darum sind wir beide, der Staat und ich, Feinde. Mir, dem Egoisten, liegt das Wohl dieser ‚menschlichen Gesellschaft‘ nicht am Herzen, ich opfere ihr nichts, ich benutze sie nur; um sie aber vollständig benutzen zu können, verwandle ich sie vielmehr in mein Eigentum und mein Geschöpf, d.h. ich vernichte sie und bilde an ihrer Stelle den Verein von Egoisten.« 4 Stirner, 177f.
So kippt die zunächst linke Kritik der Junghegelianer ins radikal Libertäre. Auf den ersten Blick mag Stirner damit als das genaue Gegenteil Proudhons wirken. Wo dieser Kategorien verewigt, will jener überhaupt keine anerkennen. Doch in einer entscheidenden Hinsicht fallen diese Extrempositionen in eins: Beide stehen einer politischen Organisierung prinzipiell feindlich gegenüber. Proudhon, weil jeder Kampf um sozial-ökonomische Maßnahmen und um politische Rechte im Staat ein unzulässiger, den ökonomischen Gesetzen widersprechender Eingriff in eine Sphäre freier Vertragsverhältnisse sei. Und Stirner, weil er nur noch sich und sein Eigentum anerkennen will. In dieser egozentrischen Perspektive kann ein Zusammenschluss, der dazu dient, für gemeinsame Interessen zu kämpfen, immer nur eine Unterdrückung der eigenen Person, der eigenen Willkür bedeuten.
In Bakunin sahen Marx und Engels also eine Symbiose von Proudhon und Stirner, dessen Standpunkte viel besser zusammengehen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. In einem Brief brachte Engels dies 1889 wie folgt auf den Punkt: »Die harmlose, nur etymologische Anarchie (d.h. Abwesenheit einer Staatsgewalt) von Proudhon hätte nie zu den jetzigen anarchistischen Doktrinen geführt, hätte nicht Bakunin ein gut Teil Stirnerscher ‚Empörung‘ in sie hineingegossen. Infolgedessen sind die Anarchisten auch lauter ‚Einzige‘ geworden, so einzig, daß ihrer keine zwei sich vertragen können.« 5 MEW 37, 293
Meister des Nivellierens
Entsprechend gelangweilt reagierten Marx und Engels auf die theoretischen Entwürfe Bakunins. Sein Hauptwerk »Staatlichkeit und Anarchie« wurde zwar von Marx auf 50 Seiten umfassend exzerpiert, doch nur selten kommentiert. Selbst die persönlichen und offen antisemitischen Angriffe des Anarchisten auf ihn überging Marx einfach.
Die wenigen Anmerkungen in seinem Konspekt zu Bakunin treffen allerdings neuralgische Punkte. »Die Hauptsache bei Bak. – Nivellieren« 6 MEW 18, 619 , notierte Marx und wer Bakunin liest, wird ihm recht geben müssen. Tatsächlich versammelt »Staatlichkeit und Anarchie« viele Reflexionen zur europäischen Außenpolitik und nur wenige zur inneren Verfassung der Staaten. Denn Bakunins höchster Grundsatz ist die Gleichheit aller Staaten als Unterdrückungsinstrumente: »Der Staat, und zwar jeder Staat, auch wenn seine Formen so liberal und demokratisch wie nur irgend möglich sind, gründet sich nämlich unvermeidlich auf Vorherrschaft, Beherrschung und Gewalt, das heißt auf den Despotismus, der vielleicht getarnt sein mag, aber dann um so gefährlicher ist.« 7 Bakunin, 45
Doch für wen alle Staaten gleich sind – so deutet es Marx in seiner Kritik an – der bekommt echte politische und ökonomische Differenzen kaum mehr in den Blick. Die Gleichmacherei schlägt um in Ignoranz. Wo Bakunin offensichtliche Unterschiede zwischen den europäischen Nationen einräumen muss, erklärt er sie zu anthropologischen Konstanten, mit deutlich rassistischen Untertönen. So seien die »Germanen« ein prinzipiell etatistisches Volk und dagegen die Slawen »von Natur aus und von ihrem Temperament her in keiner Weise ein politisches Volk, das heißt, dazu befähigt, einen Staat zu bilden« 8 Bakunin, 50 .
Wo Unterschiede zwischen Staaten, die etwa die Stärke und den Zentralisierungsgrad der Exekutive betreffen, allzu augenfällig sind, behilft sich Bakunin, indem er – um sein Dogma der Gleichheit aller Staaten als Unterdrückungsinstrumente zu retten – ihren staatlichen Charakter überhaupt anzweifelt. So kommt er zu Urteilen wie dem, dass England eigentlich kein Staat sei, sondern »vielmehr eine Föderation privilegierter Interessengruppen« 9 Bakunin, 33 . Allgemein hätten Länder wie Holland, England und die Vereinigten Staaten durch die Reformation eine »anti-staatliche Kultur« 10 Bakunin, 63 erhalten. Marx, der darin ein Desinteresse an ökonomischen Machtgefällen erkennt, bemerkt trocken: »Diese Stelle sehr charakteristisch für Bakunin; der eigentlich kapitalistische Staat für ihn antigouvernemental.« 11 MEW 18, 610
Aus der Unterschätzung des Ökonomischen folgt eine illusionäre Haltung in der Politik. Wie es zur Revolution kommen und welchen Charakter diese haben soll, bleibt bei Bakunin unbestimmt.
Seine realitätsferne Position führt wiederum notwendigerweise zu einer ultra-radikalen Haltung: Nachdem im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges die Republik in Frankreich ausgerufen wurde, ging Bakunin nach Lyon, wo er am 28. September 1870 die Abschaffung des Staates verkündete – und natürlich krachend scheiterte. Rasch kippte die ultra-radikale Politik danach sofort in die völlige Abstinenz von echter Politik, die von den Anarchisten damit begründet wurde, dass durch jeden konkreten politischen Kampf der Staat in seiner Existenz anerkannt werde. Marx und Engels höhnten, Bakunin wolle nicht »den bonapartistischen, preußischen oder russischen Staat umstürzen, sondern den abstrakten Staat, den Staat als solchen, einen Staat, der nirgends existiert«. 12 MEW 18, 342
Wie schon Proudhon und Stirner erwies sich Bakunin als Gegner der praktischen Tätigkeit, was durch sein ultra-revolutionäres Gebaren nur überdeckt wurde. Engels kritisierte den Glauben der Bakunisten, es sei »eine große revolutionäre Handlung, bei den Wahlen zu Hause zu bleiben«. 13 MEW 18, 478 Und Marx brachte in seiner Schrift »Der politische Indifferentismus« den anarchistischen Standpunkt sarkastisch auf den Punkt: »In ihrem alltäglichen praktischen Leben müssen die Arbeiter die gehorsamsten Diener des Staates sein, in ihrem Innern aber müssen sie auf das energischste gegen seine Existenz protestieren und ihm ihre tiefe theoretische Verachtung durch Kaufen und Lesen von literarischen Traktaten über die Abschaffung des Staates bekunden; sie müssen sich aber hüten, der kapitalistischen Ordnung einen anderen Widerstand entgegenzusetzen als Deklamationen über die Gesellschaft der Zukunft, in der die Existenz dieser verhaßten Ordnung aufhören wird!« 14 MEW 18, 299f.
Eine besondere Wut entwickelten die beiden Kommunisten angesichts des Desinteresses der Anarchisten an der konkreten Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Auch für Marx und Engels ist der Grad gewerkschaftlicher Organisierung als Gradmesser für die Entwicklung des politischen Bewusstseins der Arbeiterklasse interessant – doch gestehen sie dem Kampf auch einen Eigenwert zu. Einige ihrer wütendsten Polemiken richten sich daher dagegen, dass die Anarchisten dem konkreten Leid der Arbeiter kaum Beachtung schenkten.
Die Geringschätzung echter Politik, die direkt aus der Doktrin folgt, dass der »Staat an sich« das Problem sei, führt aber noch zu anderen Problemen, etwa der Missachtung nationaler Befreiungsbewegungen. Marx zitiert ein Bakunin zugeschriebenes Flugblatt, in dem Polen vorgeworfen wird, »nur an der Wiederherstellung ihres historischen Staates« zu arbeiten; und wenn sie Erfolg hätten, »so würden sie ebensowohl unsere Feinde werden, wie sie die Unterdrücker ihres Volkes sein würden. Wir werden sie im Namen der sozialen Revolution und der Freiheit der ganzen Welt bekämpfen.« Marx kommentiert, daran sehe man, »Bakunin ist mit dem Zar in dem Punkte einverstanden, dass man die Polen um jeden Preis hindern muß, ihre inneren Angelegenheiten nach eignem Ermessen zu ordnen.« 15 MEW 18, 399
Daraus lässt sich – unabhängig von der Frage, ob Marx und Engels mit Recht Bakunin als Autor solcher Zeilen vermuten – eine allgemeine Kritik am Anarchismus destillieren: Aus der Fokussierung auf den Staat als dem alleinigen Missstand folgt, dass auch jeder neue Staat, egal unter welchen Umständen er entsteht, nur ein Übel sein kann. Die Folgen sind entweder Gleichgültigkeit gegenüber Bewegungen zur nationalen Selbstbestimmung oder im schlechtesten Fall ihre Ablehnung und damit indirekt eine Parteinahme für größere imperialistische Mächte, die kleinere Nationen unter sich aufteilen.
Wo Anarchisten nationale Befreiungsbewegungen oder andere politische Initiativen doch unterstützen, können sie diese Praxis nicht mit ihrer ultraradikalen Theorie zusammenbringen, sie hängt in der Luft. Sobald sie mit politischer Praxis konfrontiert werden, verfallen die Staatsgleichmacher daher entweder in Opportunismus oder schaffen in ihrem Radikalismus weitaus autoritärere Konstrukte, als es eine öffentlich agierende politische Partei jemals sein könnte. Dass etwa Bakunin an einer revolutionären und hierarchischen Geheimorganisation arbeitete, die es bedürfe, um den »natürlichen Revolutionsinstinkt« des Volkes zu entzünden, kommentierten Marx und Engels spöttisch: »Wir befinden uns mitten in der Gesellschaft Jesu.« 16 MEW 18, 346
Der abstrakten Ablehnung von Autorität, die gerade aufgrund ihrer Einseitigkeit droht, in unreflektiertes eigenes Autoritätsgebahren umzuschlagen, begegnen Marx und Engels mit einem klügeren Begriff. Es sei absurd, so Engels in einer im Zuge der IAA-Debatte entstandenen kurzen Schrift, »vom Prinzip der Autorität als von einem absolut schlechten und vom Prinzip der Autonomie als einem absolut guten Prinzip zu reden. Autorität und Autonomie sind relative Dinge, deren Anwendungsbereiche in den verschiedenen Phasen der sozialen Entwicklung variieren.« 17 MEW 18, 307f.
Radikale Republik
Die Kritik am Anarchismus lässt sich also auf den folgenden Nenner bringen: Die absolute Gleichsetzung aller Staaten als Unterdrückungsinstrumente (wie sie heute in der öffentlichen Debatte etwa Ole Nymoen vertritt) führt zur Einebnung politischer Differenzen und zur Vernachlässigung ökonomischer Machtverhältnisse. Betreiben solche Staatsgleichmacher Politik, so findet sie nur in einem ultra-radikalen Modus statt, als lautes Deklamieren, dass allein das Abschaffen von Staaten eine Lösung sei. Eigentliche Politik, also die kollektive Organisation in Parteien, Vereinen oder Gewerkschaften, findet nicht oder kaum mehr statt. Eine libertär-individualistische Haltung ist die Folge oder – je nach Perspektive – die Voraussetzung der Staatsgleichmacherei.
Damit kann generell kein positiver Bezug mehr auf politische Formen begründet werden, denn letztlich steckt in allen Institutionen, wie bereits der »Einzige« Stirner postulierte, das Prinzip der Unterordnung und Unterdrückung. Dies trifft auch für alle Formen von Repräsentativversammlungen und Wahl von Delegierten zu. Entsprechend lag für Bakunin bereits im Delegationsprinzip selbst die Unfreiheit. Sogar wenn Arbeiter gewählt werden würden, so wären sie »keine Arbeiter mehr« und würden »die Welt des Proletariats vom Standpunkt des Staates betrachten, nicht mehr das Volk repräsentieren, sondern sich selbst und ihre Ansprüche; sie regieren!« 18 Bakunin, 234
Demgegenüber wies Marx immer wieder darauf hin, dass nicht die Form des (republikanischen) Repräsentationsprinzip das Problem sei, sondern die ökonomische Spaltung der Gesellschaft in Klassen: »Der Charakter der Wahl hängt nicht von (…) Namen ab, sondern von der ökonomischen Grundlage, den ökonomischen Zusammenhängen der Wähler…« 19 MEW 18, 635
Daher können für Marx die Arbeiter auch in der politischen Periode, die er in seiner »Kritik des Gothaer Programms« bereits als »revolutionäre Diktatur des Proletariats« bezeichnet, an republikanische Formen anknüpfen. Zwar dürfe die Arbeiterklasse die bestehende Staatsmaschinerie nicht einfach in Besitz nehmen 20 MEW 17, 336 , aber an der Pariser Commune als »Regierung der Arbeiterklasse«, welche »die endlich entdeckte politische Form« sei, unter der »die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte« 21 MEW 17, 342 , lobt Marx vor allem die Ausweitung und Radikalisierung von republikanischen Prinzipien: Eine durch allgemeines Stimmrecht gewählte Kommune aus Vertretern der Arbeiterklasse; Rechenschaftspflicht und jederzeitige Absetzbarkeit; eine Deckelung des Lohns für öffentliche Dienste auf der Höhe von Arbeiterlöhnen; die Bewaffnung des ganzen Volkes usw. Für Marx und Engels hatte dabei immer die Herstellung politischer Handlungsfähigkeit Vorrang gegenüber abstrakten theoretischen Konzepten. Es ist daher auch nicht gleichgültig, welche historisch konkreten Staaten bestehen, da unterschiedliche Staatsformen unterschiedliche Bedingungen der Möglichkeit zur Organisierung der Arbeiterklasse bedeuten. Diese Einsicht spiegelt sich noch bei Lenin, der klarstellte: »Wir sind für die demokratische Republik als die für das Proletariat unter dem Kapitalismus beste Staatsform« – natürlich nicht ohne sogleich anzufügen, man dürfe »nicht vergessen, daß auch in der allerdemokratischsten bürgerlichen Republik Lohnsklaverei das Los des Volkes ist.« 22 Lenin: Staat und Revolution, 333
Entsprechend wichtig war es für Marx, dass die Arbeiter in bürgerlichen Republiken auch für fortschrittliche Reformen kämpfen. Bemerkenswerterweise war eine der ersten Handlungen der IAA nach ihrer Gründung ein Glückwunschtelegramm zur Wiederwahl des US-Präsidenten Abraham Lincoln, in dem es heißt: »Solange die Arbeiter, die wahren Träger der politischen Macht im Norden, es erlaubten, daß die Sklaverei ihre (!) eigene Republik besudelte; (…) solange waren sie unfähig, die wahre Freiheit der Arbeit zu erringen oder ihre europäischen Brüder in ihrem Befreiungskampfe zu unterstützen.« 23 MEW 16, 19
Im Hinblick etwa auf Marxens »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte« und Engels späte, »kanonische« Schriften könnte zwar der Eindruck entstehen, dass beide selbst Staatsgleichmacherei betreiben, liegt doch dort die Betonung auf der Kontinuität, die in Sachen Ausweitung der Staatsmaschinerie zwischen der absoluten Monarchie und der bürgerlichen Republik herrscht.
Doch wer allein dies im Blick hat, übersieht die Bedingung der marxistischen Gesellschaftskritik, die in Marxens Frühschriften expliziert und auch später als implizite Voraussetzung nie in Frage gestellt wird. Erst mit der Französischen Revolution und dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft entsteht die Trennung von politischem und privatem Leben, wie Marx in seiner »Kritik des Hegelschen Staatsrechts« (1843) ausführt. Der Staat wird dadurch als Sphäre des Politischen ein neuer und gleicher Bezugspunkt für alle Bürger, der es überhaupt erst ermöglicht, die ökonomische Ungleichheit angemessen – das heißt nicht utopisch oder religiös – zu adressieren. Erst wenn der Mensch auch Citoyen ist, hat er die Kontrastfolie, die es ermöglicht, einzusehen, wie problematisch seine Existenz als Bourgeois (verstanden im weiten Sinne als Teil der bürgerlichen Erwerbsgesellschaft) ist. Und die Vergemeinschaftung der Produktionsmittel schafft nicht die neue geteilte Sphäre des Politischen ab, sie macht im Gegenteil noch das Ökonomische zur »res publica«, zur öffentlichen Sache.
Erst wenn man dies bedenkt, wird verständlich, warum Friedrich Engels im Kontext des Streits mit Bakunin 1871 in einem Brief einräumt, es sei »die ‚Abschaffung des Staates‘ eine alte Phrase der deutschen Philosophie, von der wir viel Gebrauch gemacht haben, als wir noch einfältige Jünglinge waren«. 24 MEW 33, 657
Nachspiel
In Reaktion auf den IAA-Kongress in Den Haag bildete sich noch im September 1872 die »Antiautoritäre Internationale« heraus, die sich auf einem Kongress im schweizerischen St.-Imier vom Generalrat abspaltete. Dort fassen die Anarchisten unter anderem folgende Resolution: »Die Zerstörung der politischen Gewalt ist die erste Aufgabe des Proletariats. (…) Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Verbände und Sektionen ist die Grundvorbedingung zur Befreiung der Arbeiterschaft. Der Kongreß spricht allen General- oder Regional-Kongressen das Recht ab Gesetzgeber zu sein. Ihre einzige Aufgabe ist, die Bestrebungen und Ideen des Proletariats verschiedener Länder zu offenbaren, damit seine innere und äußere Einigung sich leichter vollziehe. In keinem Fall kann eine Majorität ihre Resolutionen einer Minorität aufdrängen.« Dies beschließt die Majorität der 14 anwesenden Antiautoritären für ihre ganze Internationale.
So zeigt sich recht schnell, wie widersprüchlich der Anarchismus in der Praxis wird. Bereits auf dem Zweiten Kongress der Antiautoritären in Genf im September 1873 entbrannten heftige Debatten darüber, ob nicht jegliche Leitungsebene abgeschafft werden sollte. Denn jedes koordinierende Gremium trage den Keim der Autorität in sich. Einem Todesstoß kam dann folgender Beschluss gleich: »Über Kongreßbeschlüsse wurde des weitern bestimmt, daß sie nur obligatorisch wären für die, welche sie annehmen wollten.« 25 Brupbacher, 165
Indem die Anarchisten damit der Willkür aller Mitglieder Tür und Tor öffneten, entwerteten sie ihre eigenen Kongresse. Auf dem Dritten Kongress in Brüssel (7.-13. September 1874) wurden nur noch Ideen diskutiert, ohne dass daraus noch irgendeine Handlung gefolgt wäre. Bakunin selbst trat aus »seiner« Internationale aus und schob die Schuld an der ausbleibenden Revolution defätistisch den Volksmassen zu, welche »gegenwärtig den Sozialismus nicht wollen«, wie es 1874 in einem Brief an Guillaume heißt. 1876 stirbt er in der Schweiz, während die »Antiautoritäre Internationale« noch ein paar Jahre dahinsiecht. Am Ende bleiben in der Tat nur lauter »Einzige« übrig.
Literatur
Karl Marx und Friedrich Engels: Werke in 43 Bänden (= MEW). Dietz-Verlag, Berlin, 1956-1990
Michael Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie. Karin Kramer Verlag, Berlin 1972
Fritz Brupbacher: Marx und Bakunin. Ein Beitrag zur Geschichte der Internationalen Arbeiterassoziation. Verlag der Wochenschrift Die Aktion, Berlin 1922
Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum. Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1845
 Lesezeit 20 Minuten
Lesezeit 20 Minuten