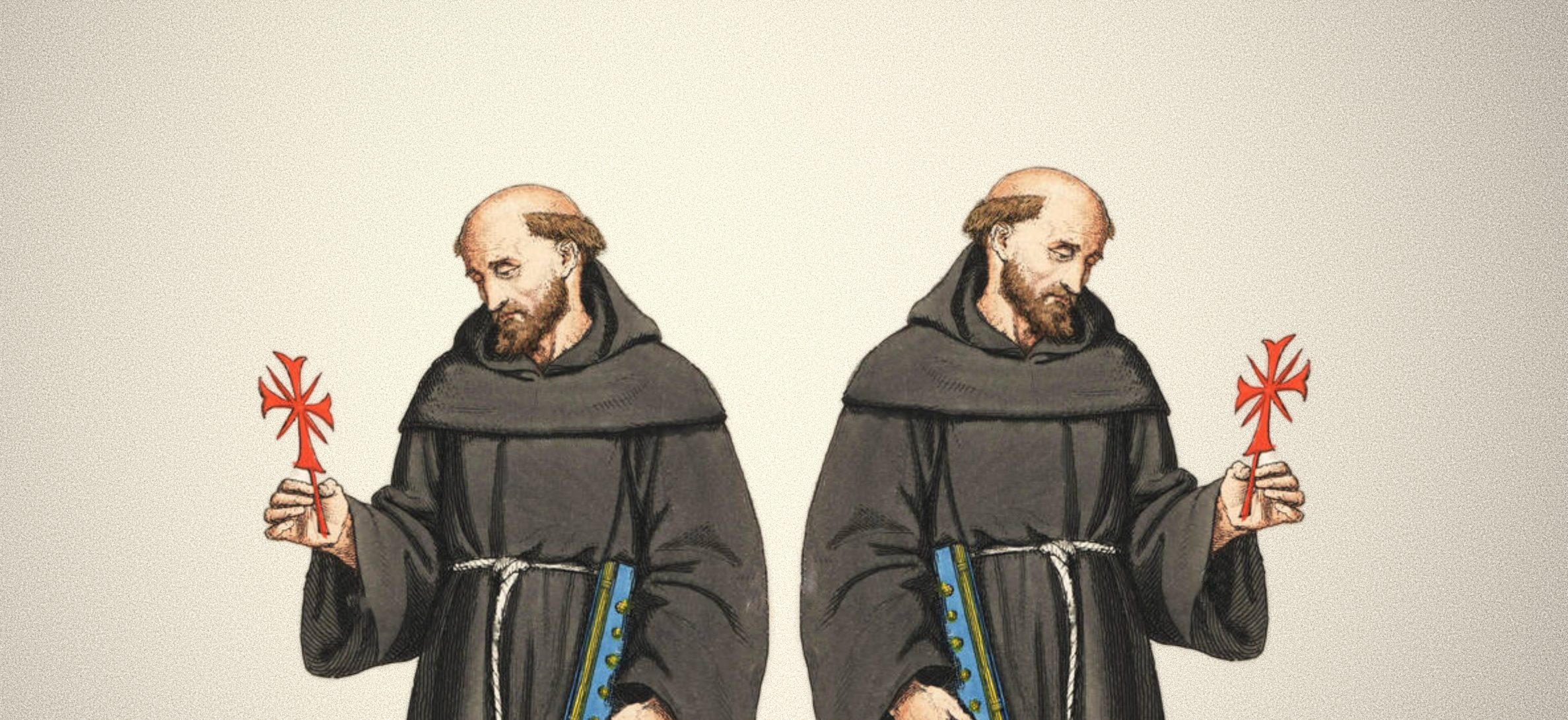Bild: Falk Weiss / Suhrkamp
Nils Kumkar: „Moderne Politik geht nicht ohne Polarisierung“
Nils Kumkar erklärt im Gespräch mit Julia Werthmann, warum sich die Gesellschaft weniger in ihren Meinungen, sondern vor allem in ihrer Kommunikation spaltet. Statt Spaltung grundsätzlich zu fürchten, plädiert Kumkar dafür, Polarisierung als Motor demokratischer Teilhabe zu begreifen.
Herr Kumkar, wer heute eine Zeitung aufschlägt, wird mindestens einen Artikel finden, der die Polarisierung der Gesellschaft beklagt. Gleichzeitig gibt die Soziologie Entwarnung. Wer hat recht?
Beide. In der Tat hat die Sorge um Polarisierung in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich zugenommen, gut zwei Drittel der Deutschen geben sie in Umfragen an. Die Zeitung berichtet also über ein reales Erleben der Leute. Gleichzeitig zeigt die Einstellungsforschung kein Auseinanderdriften der Meinungen. Im Gros tummeln sich die meisten in der Mitte. Und da, wo es auseinandergeht, geht es wild durcheinander. Jemand, der gegen offene Grenzen ist, lehnt nicht zwangsläufig die gleichgeschlechtliche Ehe ab und ist Impfgegner. Das haben vor zwei Jahren auch Steffen Mau und seine Kollegen in Triggerpunkte gezeigt. Die Soziologie gibt also zu Recht Entwarnung. Nun aber zu sagen: Die Leute irren sich einfach – das ginge am Gegenstand vorbei.
Wieso?
Wer in seinem Alltag Polarisierung beobachtet, der blickt nicht auf die Meinungen der Bevölkerung. Sondern auf politische Kommunikationsweisen. Die Menschen sorgen sich darum, wie unterm Weihnachtsbaum und im Fernsehen über Politik gesprochen wird. Und da kann man in der Tat festhalten: In den sichtbaren politischen Diskussionen wird die politische Debatte unter der Maßgabe der Polarisierung prozessiert. Das bedeutet: Wir haben es vielleicht nicht mit Meinungspolarisierung, aber sehr wohl mit kommunikativer Polarisierung zu tun.
Was genau bedeutet kommunikative Polarisierung?
Wir reden miteinander über Politik, als gäbe es bereits zwei klare, sich gegenüberstehende Konfliktlager. Auch wenn die meisten Menschen Mittelpositionen einnehmen, begleiten sie diese Positionierung mit dem Bedauern, dass alle immer mehr den Extremen zuneigen und ordnen sich dementsprechend gegenseitig ein. Kommunikative Polarisierung ist in der Folge ein reales Phänomen, aber etwas anderes als die Spaltung in zwei themenübergreifende Meinungslager – was immerhin das Alltagsverständnis von Polarisierung ist.
Wir diskutieren darüber, ob und wie stark die Gesellschaft polarisiert ist. Einig sind sich jedoch alle darin, dass Polarisierung schädlich ist. Wieso?
Polarisierung hat sich als Sorgefigur etabliert. Viele Menschen machen ihr Unbehagen an der modernen Demokratie an der Polarisierungsbeobachtung fest. Bei einem Forschungsprojekt, das ich gemeinsam mit Uwe Schimank, Serena Pongratz und Rozalie Böge über Politikverständnisse in unterschiedlichen Klassen durchgeführt habe, war auffällig, dass die Leute sich je nach Klasse sehr Unterschiedliches unter Polarisierung vorstellen. Die Polarisierungssemantik funktioniert super, weil jeder seine Probleme in den diffusen Begriff hineinprojizieren kann. Gleichzeitig hat er die Würde eines wissenschaftlichen Konzepts, das die Alltagswahrnehmung adelt. Zu guter Letzt unterstreichen Politiker, Fernsehkommentatoren und das Feuilleton diese Sorge permanent. Es hat sich eingespielt, Polarisierung zu beklagen. Oft geht es dabei jedoch um etwas anderes.

Nils Kumkar
Worum geht es eigentlich?
Alle raufen sich die Haare über die bedenkliche Spaltung der Gesellschaft, meist geht es jedoch um konkrete Probleme mit konkreten politischen Akteuren, besonders um den Aufstieg der extremen Rechten. Es wäre produktiv, das auch so zu benennen. Polarisierung ist als Kommentarform aber auch deshalb so attraktiv, weil es dem Kommentator erlaubt, entpolitisiert über ein politisches Problem zu reden.
Wieso wird Polarisierung überhaupt als durchweg schlecht verstanden? Ist Konflikt nicht eine demokratische Grundtugend?
Durchaus. Mit meinem Buch möchte ich unter anderem zeigen, dass polarisierte Konflikte eine ganze Reihe wichtiger Funktionen für moderne Publikumsdemokratien erfüllen. Polarisierung lädt etwa zum Mitmachen ein. Wenn sich die zur Wahl antretenden Parteien ideologisch scharf gegenüberstehen, drängt das die Bevölkerung zur Wahl, weil sie das Gefühl hat: Von meiner Wahl hängt etwas ab – sonst droht Schlimmes! Polarisierung ermöglicht also die Inklusion des sonst passiven Publikums der modernen Massendemokratien in den politischen Prozess. Selbst wenn dieses Publikum die Politik ablehnt, zieht die Polarisierung es in eine Legitimation der Politik durch Verfahren hinein. Schließlich hat selbst derjenige, der sein Kreuz bei der Anti-Partei AfD setzt, an der Wahl teilgenommen.
Offenbart diese systemtheoretische Gegenüberstellung von Politik und Publikum nicht ein technokratisch-verkümmertes Demokratieverständnis? Demokratie heißt immerhin: Herrschaft des Volkes. Könnte sich das Unbehagen der Menschen, von dem sie sprachen, vielleicht weniger auf die Demokratie beziehen, sondern auf Ihr Fehlen? Indem etwa das Gefühl vorherrscht, bestimmte elitäre Interessen würden die Mehrheitsinteressen übertrumpfen?
Das kann man durchaus so sehen. Allerdings denke ich, dass die moderne Massendemokratie bereits ohne technokratische Tendenzen mit dem Problem zu kämpfen hat, dass viele Menschen von wenigen Politikern repräsentiert werden – was wohlgemerkt in der modernen Massendemokratie unumgänglich ist. In ihrem Alltag werden die meisten Menschen regiert und regieren nicht. Sie können nur episodisch zum Wahltag in die Politik eingreifen. Die meisten lesen Zeitungen und schreiben sie nicht voll, gehen zur Schule und stehen nicht an der Tafel. Selbst wenn das noch gar nicht als problematische Entwicklung bewertet wird, erzeugt es bereits das Unbehagen, regiert zu werden und nichts zu melden zu haben. Allerdings verstärken Technokratisierungstendenzen dieses Gefühl höchstwahrscheinlich.
Gibt es noch andere rezente Gründe für das Unbehagen der Menschen? Denken wir etwa an die zunehmende Prekarisierung und Wohlstandsverluste.
Das spielt alles eine Rolle, aber nicht allein. Neben Technokratisierung, Prekarisierung und Wohlstandsverlusten spielen auch die Demokratisierungsversprechen der letzten Dekaden eine Rolle. Das Versprechen, dass alle mitmachen können, birgt die Gefahr enttäuschter Partizipationserwartungen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Durch Social Media können sich mehr Menschen als je zuvor öffentlich politisch äußern. Zeitgleich kommt damit die Erwartung auf, dass einem zugehört wird – und die Enttäuschung, wenn das nicht passiert. Nur weil alle mitreden können, wird noch längst nicht allen zugehört. Außerdem haben Menschen unterschiedliche Ansprüche an demokratische Teilhabe. Politik soll ein Deliberationszusammenhang sein, in dem alle Standpunkte zu Wort kommen. Gleichzeitig soll sie aber bitte auch schnell zu Lösungen kommen. Das heißt: Selbst, wenn alles läuft, werden Erwartungen enttäuscht. Das bekundete Misstrauen gegenüber Medien und der Wissenschaft nimmt zu. Aber auch darin sehe ich eine Selbstbehauptung als mündiger Bürger im Zuge der Demokratisierungsversprechen. Früher hätten sich wohl weniger Menschen solch eine kritische Pose angemaßt.
Wenn dieses Unbehagen seit jeher zur modernen Massendemokratie gehört, wieso kommt dann vor allem gegenwärtig die Polarisierungsdiagnose auf?
Der Umstand, dass wir in den letzten Jahren so viel über Polarisierung reden, hat nur am Rande damit zu tun, dass die kommunikative Polarisierung wirklich stärker geworden ist. Sie ist zwar im Vergleich zu den als sehr gering polarisiert wahrgenommenen 1990ern und 2000ern angestiegen. Aber die Konfrontation zwischen Sozialdemokratie und Konservativen in der Frühphase der Bundesrepublik war mindestens genauso scharf wie heute. Dass wir jetzt aber von Polarisierung reden, liegt daran, dass politische Kommunikation für ein Gros der Bevölkerung vor fünfzig Jahren nur äußerst episodisch beobachtbar war, etwa wenn man morgens Zeitung gelesen hat oder mit dem Nachbarn über Politik geredet hat. Heute hingegen sind wir mit einer demoskopischen und digitalen Dauerbeobachtung der Bevölkerung und ihres Unbehagens konfrontiert. Wir sehen also ständig, wie viel Konflikt es da draußen gibt.
Ist Polarisierung also weniger eine Folge der Entdemokratisierung als der Demokratisierung?
Der Zusammenhang ist paradox, weil beides Polarisierung fördert. Verstehen wir Demokratisierung ganz basal als Vermehrung von Teilhabechancen am öffentlichen Diskurs: Dann ja. Sie ist eine überaus effiziente kommunikative Ordnung, die es einer großen Masse erlaubt, eine Meinung zu haben. Polarisierung reduziert die Komplexität des politischen Streits. Gleichzeitig will ich normativ anspruchsvollere Verständnisse von Demokratisierung nicht abtun. Der Rückgang des Organisationsgrades der Zivilgesellschaft, von Formen der verbindlichen politischen Meinungsbildung und ihrer Aushandlung gehen zurück. Und das kann man durchaus als Entdemokratisierung beschreiben. Paradoxerweise befeuert auch das Polarisierung. Schließlich fehlen dem Massendiskurs zwischen Individuen die eingespielten, organisierten Formate. Polarisierung füllt diese Lücke.
Die Rechte hat es geschafft für das Unbehagen der Menschen an der Politik und ihrem Regiertwerden zu stehen. Wie hat sie das geschafft? Wenn man sich Ihre Wirtschaftspolitik ansieht, unterscheidet diese sich immerhin nicht grundsätzlich von der unternehmerfreundlichen Politik der letzten Jahrzehnte.
Zunächst lässt sich feststellen, dass wir in ganz verschiedenen Ländern einen Aufstieg der extremen Rechten beobachten. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass es sich einfach um den Defekt eines konkreten nationalen politischen Systems oder einer bestimmten Wirtschaftspolitik handelt. Die Frage ist also: Wie hat die Rechte es geschafft, die Fundamentalopposition in dieser kommunikativen Ordnung zu werden? Der Niedergang des historischen Kommunismus und des Kalten Kriegs hat die alte Polarisierungsdynamik zwischen Arbeiterinnenbewegungen und bürgerlichen Parteien zerbrechen lassen. Lange ist es keiner anderen politischen Kraft gelungen, diese Rolle der Fundamentalopposition zu besetzen – bis die Rechten kamen. Im Buch analysiere ich das am Beispiel des rechtslibertären Vordenkers Murray Rothbard. In den 1990ern hat er erkannt, wie produktiv eine rechte Strategie der Polarisierung ist.
Wie nutzt die deutsche AfD Polarisierung als Strategie?
Wie alle anderen bekennt sich auch die AfD nicht positiv zur Polarisierung. Aber an die Öffentlichkeit gelangte Kaminzimmergespräche und durchgestochene Strategiepapiere dokumentieren: Ihre Strategie zielt darauf, sich als Gegner aller anderen zu etablieren. Diese Position festigt sich, wenn die anderen sie als diesen Herausforderer annehmen. Von der Linken bis zur CDU sind sich alle einig, dass die AfD ein Problem für die liberale Demokratie darstellt. Bei der letzten Bundestagswahl haben alle anderen Parteien behauptet, ihr Programm wäre das beste Mittel gegen die AfD. Der Umstand, dass nach jeder Talkshow darüber geredet wurde, wieso die AfD entweder eingeladen wurde oder nicht, und also stets über sie gesprochen wurde, hat ihre Position als Fundamentalopposition zementiert.

Julia Werthmann
Wieso ist es für die Bevölkerung attraktiv, ihr Unbehagen durch die Zustimmung zu einer Partei zu äußern, die die Polarisierungswelle reitet ohne Lösungsvorschläge für ihr Unbehagen anzubieten?
Zunächst einmal wählen die allermeisten Menschen durchaus andere Parteien – und das vielleicht auch aus Unbehagen. In der Nachwahlbefragung der Landtagswahl in Brandenburg kam raus, dass 75 Prozent die SPD gewählt haben, um die AfD zu verhindern. Die extreme Rechte ist somit nicht grundsätzlich attraktiver. Aber ihre relative Durchschlagskraft kommt daher, dass die Menschen den Eindruck haben, ihre Wahl sei die effizienteste Art und Weise, ihre Wut auszudrücken und allen anderen einen Schrecken einzujagen. Der Gegensatz zwischen destruktiver Fundamentalopposition und lösungsorientierter Opposition setzt eine Vorstellung von politischer Gestaltungsmacht voraus, die die meisten gar nicht haben. Die Leute misstrauen der Politik, überhaupt Probleme lösen zu können. Ab einem bestimmten Resignationsgrad ist die Frage nicht mehr, welche Lösung attraktiver ist, sondern: Mit welcher Stimme kann ich meiner Frustration den stärksten Ausdruck verleihen.
Was würde gegen die rechte Polarisierungsstrategie helfen?
Die Grundthese meines Buches lautet, dass moderne Politik ohne Polarisierung nicht auskommt. Und die Rechte bewirtschaftet diesen Umstand am effizientesten, indem sie den Anti-Pol besetzt. Deshalb gibt es mittelfristig keine andere Möglichkeit, sie loszuwerden, als den Nein-Pol anders zu besetzen. Allerdings kann man das nicht einfach vorschlagen, im Sinne: Lasst uns doch alle zusammen eine andere Opposition machen! Zentral ist immerhin, dass diese neue Opposition auch von den anderen als Bedrohung wahrgenommen wird, sonst ist sie keine Fundamentalopposition. Daraus ergibt sich die unbequeme Lage, gegen eine Opposition zu sein, die man nicht will, aber eine Opposition zu brauchen, die man vielleicht nicht wollen kann.
Kann eine erfolgreiche Strategie gegen rechts nur in einem anderen Nein bestehen, oder könnte auch ein utopisches Ja diese Rolle übernehmen?
Selbst das grundlegendste Nein wird in programmatischer Form vorgebracht, sodass es ein Ja mitbringt. Darin liegt ja das Problem mit dem Aufstieg der AfD. Wir hätten all den Kummer nicht, wenn sie tatsächlich einfach nur dagegen wäre. Stattdessen ist sie eine extrem rechte Partei, die durchaus einen Plan hat, wie sie die Gesellschaft umgestalten möchte. Das gilt auch für ein alternatives Nein, es bräuchte ebenfalls einen utopischen Horizont, der die Menschen motiviert und über das Bestehende hinausweist. Gleichzeitig hat die Polarisierungsstrategie der Rechten eine gewisse inhaltliche Leere, die es tatsächlich schwer macht, ihr mit einem alternativen Ja zu begegnen. Schließlich ist ihr zentrales Ziel, den anderen eins auszuwischen und ihnen Korruption vorzuwerfen. Wir sehen hier letztlich eine leere Form der Polarisierung, an der die Gegenstrategien verzweifeln. Die Migrationspolitik der AfD zu übernehmen, um die Sorgen der Leute ernst zu nehmen, schwächt die AfD nicht. Vielmehr steigern sich die anderen Politiker in eine demonstrative Entschlossenheitspolitik hinein, die bloß Entscheidungsfähigkeit aufführt. Aus dieser Dynamik kommen sie schwer heraus.
Wie sähe eine produktive Polarisierung aus, die der gegenwärtig heißlaufenden Polarisierungsdynamik entkommt?
Eine produktivere Polarisierungsdynamik würde sich an Antagonismen ausrichten, die über das politische System hinausweisen – anstatt sich nur darum zu drehen, wer regiert. Wenn Polarisierung zum Beispiel ökonomische Fragen oder Klimapolitik betrifft, kann sie hoffentlich lernfähiger sein. Diese Hoffnung nehme ich aus der Geschichte der modernen Demokratie mit. Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit hat den politischen Betrieb über Dekaden geprägt, wurde aber nie gelöst. Allerdings ist aus dieser Konfrontation der moderne Sozialstaat entstanden. Solche Formen der Lernfähigkeit erfordern einen inhaltlichen Kern der Polarisierung, der im Leben der Leute einen Unterschied macht. Wenn ich mir nicht als Soziologe, sondern als Bürger etwas wünschen dürfte, dann wäre es wohl solch eine Polarisierung.
Vielen Dank für das Gespräch!
 Lesezeit 12 Minuten
Lesezeit 12 Minuten