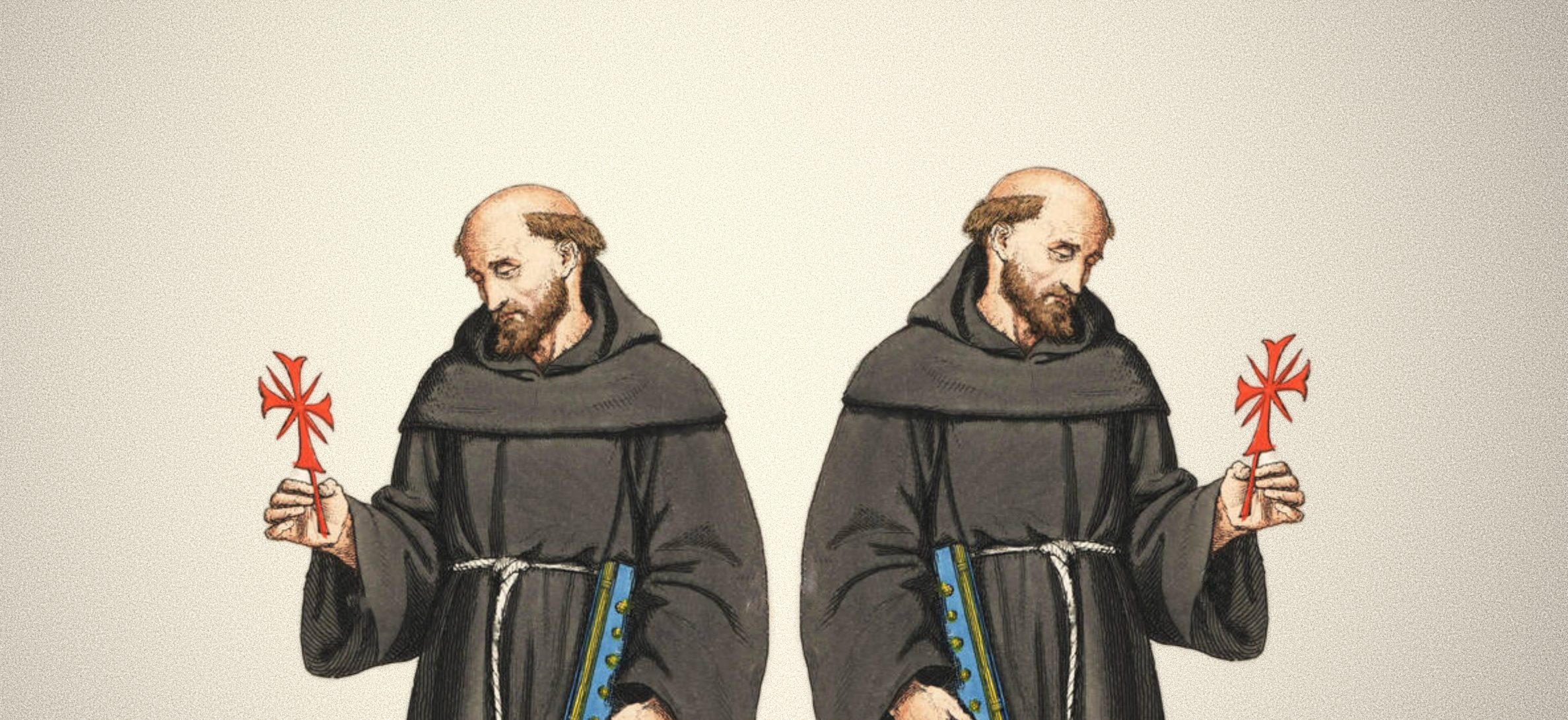BILD: UAV 605.295.11, BOX 3. HARVARD UNIVERSITY ARCHIVES
After Utopia und das Ende der Ideologie
Judith Shklars erstes Buch After Utopia ist ein vergessenes Juwel der Ideengeschichte, schreibt Samuel Moyn. Jahrzehnte vor der Rede vom »Ende der Ideologie« analysierte Shklar bereits die intellektuelle Blockade des politischen Denkens nach dem Zweiten Weltkrieg – eine Diagnose, die heute, im Zeitalter liberaler Ratlosigkeit, überraschend aktuell ist.
Die erste und dringendste Aufgabe nach dem sogenannten »Ende der Ideologie« besteht für all jene, die neue politische Hoffnung schöpfen wollen, darin, zu begreifen, wie wir überhaupt in die intellektuelle Sackgasse geraten konnten, in der wir heute feststecken. After Utopia, Judith Shklars erstes Buch, gewinnt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung – als klarsichtige Analyse einer Situation, die unserer heutigen Situation erstaunlich ähnelt. Das Buch spricht eindringlich zu all jenen, die sich mit dem politischen Stillstand ihrer Zeit nicht abfinden wollen. After Utopia wird allerdings, obwohl das Denken von Shklar aktuell neu entdeckt wird, häufig übersehen und bleibt deshalb ein verborgenes Juwel der Ideengeschichte. Dabei kann die Lektüre des Buches nicht nur eine reiche Quelle zur Reflexion über den modernen Kanon der Philosophie und deren politische Dimension sein, sie ist in einer Epoche, in welcher der Zustand nach dem Ende der Ideologien keineswegs so rosa und heiter ist, wie viele einst geglaubt oder erhofft haben, auch von besonderer Dringlichkeit.
Judith Shklar wurde 1928 in Riga geboren. Mit ihrer Familie floh sie 1940 aus Lettland und durchquerte mitten im Krieg die Sowjetunion auf der Transsibirischen Eisenbahn – damals die einzige Möglichkeit, um der sowjetischen Besatzung oder der Judenverfolgung durch die Nazis zu entkommen. Sie wuchs danach in Kanada in Montreal auf, studierte an der McGill University und vollendete ihre Dissertation 1955 am Government Department der Harvard University. Zwei Jahre später erschien ihre Dissertation in überarbeiteter Form als Buch. Schließlich erhielt Shklar eine Anstellung als Professorin in Harvard, an jener Fakultät also, in welcher sie auch promoviert hatte. Als Frau befand sie sich jahrzehntelang in einem prekären Beschäftigungsverhältnis, bis sie – inzwischen als eine der führenden politischen Theoretikerinnen ihrer Zeit anerkannt – eine feste Professur erhielt.

Samuel Moyn
Als Shklar 1992 im Alter von nur 63 Jahren starb, war sie auch international bekannt. In Harvard galt sie als eine beliebte Lehrerin, sie galt aber auch als scharfsinnige und gefürchtete Gesprächspartnerin. Ihr elegant geschriebenes Werk Ordinary Vices erschien 1984. Im selben Jahr erhielt sie auch ein »Genie«-Stipendium von der MacArthur Foundation – eine Auszeichnung, die ihr die Möglichkeit eröffnete an renommierten Orten Vorlesungen zu halten, etwa in der University of Oxford (Carlyle Lectures) und in der Yale Law School (Storrs Lectures). Dies bracht ihr einen gewissen Ruhm ein. Ein Essay über den »Liberalismus der Furcht«, der ihre politische Haltung zusammenfasste, die sie im Laufe eines ganzen Lebens – in welchem sie sich überwiegend mit klassischen Autoren beschäftigte – entwickelt hatte, wurde weithin gelesen.
Mehr als ein Erstlingswerk
After Utopia, das Buch, mit dem Shklar sich als politische Theoretikerin ursprünglich einen Namen gemacht hatte, war hingegen in Vergessenheit geraten. Wäre es parallel zu The Liberalism of Fear rezipiert worden, hätte sich ein ganz anderes Bild von Shklar ergeben. Denn ihr Erstlingswerk bringt eine tiefe Skepsis gegenüber jenem minimalistischen Liberalismus zum Ausdruck, den viele Leser in ihrem später berühmt gewordenen Essay als positiv gewürdigt sahen.
After Utopia ist also weit mehr als Shklars Erstlingswerk, mit dem sie ihre akademische Karriere begründet hatte. In einem späteren Interview, das 1981 im Rahmen einer Untersuchung über die wenigen festangestellten Professorinnen an der Harvard University geführt wurde, beschrieb Shklar After Utopia als ein Werk, in das sie (in seiner ursprünglichen Dissertationsform) »alles hineingelegt hatte«, was sie hatte. »Ich habe Tag und Nacht gelesen«, erzählte sie, »jedes große Buch« und saß »in diesem kleinen Keller der Radcliffe-Bibliothek« und durchlief dort, so sagte sie, ein »zweites Studium«.
Was Shklar aus dieser Zeit gewann, bot ihren Leserinnen und Lesern einen außergewöhnlichen Überblick über das europäische politische Denken seit der Aufklärung sowie eine Analyse der politischen Theorie des Kalten Krieges, die bis heute ihresgleichen sucht. Doch die größte Stärke des Buches liegt vielleicht darin, dass es eine Klage und zugleich eine Diagnose liefert – über die intellektuelle Blockade des politischen Denkens in einer Übergangszeit, in einem Interregnum zwischen zwei Epochen, in dem alle Wege verstellt und kein kreativer Impuls mehr möglich scheint. Vielleicht, so darf man hoffen, gelangt auch unsere Gegenwart irgendwann an das Ende eines solchen Interregnums.
Verrat am Liberalismus
In seiner ursprünglichen Gestalt trug das Buch, das in langen Tagen und Nächten im Keller der Radcliffe-Bibliothek entstand, zunächst den Titel: Fate and Futility: Two Themes in Contemporary Political Theory. Es waren die Verlagslektoren von der Princeton University Press, die – wie Shklar Jahrzehnte später erklärte – auf den Titel After Utopia kamen. »Viele Leute dachten, ich hätte ein Buch über Utopien geschrieben«, sagte sie. Ihre Dissertation, die sie zu einem Buch überarbeitete, während sie gleichzeitig die Wiege ihres erstgeborenen Kindes schaukelte, war jedoch keineswegs ein Ausdruck der Sehnsucht nach utopischem Denken. Sie erklärte selbst: »Kein Thema hätte mir und meinen Interessen ferner liegen können.«
Was Shklar mit ihrer Distanzierung andeutete, war ihre skeptische Grundhaltung: Sie hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber überhöhten Heilsversprechen, insbesondere vor dem Hintergrund der Grausamkeiten, die im 20. Jahrhundert im Namen der Utopie von Staaten angerichtet wurden. Und dennoch hatten ihre Verleger womöglich einen Nerv getroffen. Denn bei allen historischen Unterschieden zwischen der düsteren Hochphase des Kalten Krieges, in der After Utopia entstand, und der heutigen Zeit, ist die Grundstimmung des Buches von frappierender Aktualität: Ein Liberalismus, der eine »neoliberale« Wirtschaft, die den aufklärerischen Fortschrittsglauben verrät, und ein Sozialismus, dem die theoretische Kraft zur Erneuerung fehlt – all das mutet heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, nicht weniger wahr und aktuell an.
Shklars Anliegen in After Utopia bestand nicht einfach nur darin, intellektuell ins 18. Jahrhundert zurückzukehren, um eine Deutung der Aufklärung zu wagen und sich in die alte, erbitterte Debatte über das antiaufklärerische Wesen der »Romantik« einzumischen. Es verlangte von ihr ein ganzes Panorama des 19. Jahrhunderts in prägnanten Skizzen zu durchmessen – ehe sie sich dem Denken des 20. Jahrhunderts zuwandte.
Ihre Lesart der Aufklärung scheut sich auch nicht, der Aufklärung hohe Ideale zuzugestehen: eine säkulare, universale Gerechtigkeit, gedacht als Ziel des vernunftgeleiteten Fortschritts. Und von diesem Ausgangspunkt aus unternimmt Shklar einen fesselnden, wenn auch umstrittenen Versuch, mehr als ein Jahrhundert intellektueller Rebellion gegen die Aufklärung als »romantischen« Irrtum zu begreifen. Ob diese Deutung im Einzelnen überzeugt oder nicht, ist beinahe zweitrangig angesichts der intellektuellen Brillanz, mit der sie ihre Gedankenfiguren entwirft. Ihre knappen Porträts einer ganzen Galerie bedeutender Denker – von Goethe und Hegel über Burckhardt und Tocqueville bis hin zu Kierkegaard und Nietzsche – fügen sich zu einer geistreichen und souverän geführten Gesamtschau der europäischen Ideenlandschaft seit dem 18. Jahrhundert.
Das »Syndrom des Kalten Krieges«
Der Höhepunkt von After Utopia – und vielleicht auch sein kühnstes Unterfangen – ist Judith Shklars glänzende Analyse des europäischen Denkens in den 1940er- und 1950er-Jahren. Besonders für all jene, die sich für das christlich geprägte und existenzialistische Geistesleben dieser Zeit interessieren, entfaltet sich hier ein Panorama von außergewöhnlicher Dichte und Schärfe. Shklar argumentiert, dass der weitgehende Verzicht auf politische Theorie mit utopischem Anspruch nach dem Zweiten Weltkrieg nichts grundlegend Neues darstellte, sondern lediglich die radikalisierte Zuspitzung jener Hoffnungslosigkeit war, in die die »Romantik« ihre Anhänger bereits im 19. Jahrhundert geführt hatte.
Dieser Diagnose fügt sie ein messerscharfes Porträt des christlichen »Fatalismus« jener Jahre hinzu – eine Haltung, die tief in der alten Skepsis gegenüber der Moderne verwurzelt sei. Mit feiner Ironie notiert Shklar: »Es fällt christlichen Autoren offenbar nicht schwer, das Ende aller Zeit zu verkünden – schließlich war diese Zeit nie nach ihrem Geschmack.« Doch auch nach dieser eindrücklichen Schilderung des Tiefpunkts europäischen Pessimismus – geprägt von existentialistischer Antipolitik und religiöser Schwermut – war Shklars Analyse noch längst nicht an ihrem Ende angelangt.
Die vielleicht aktuellsten Passagen von After Utopia sind Shklars Auseinandersetzungen mit dem säkularen Liberalismus und dem Sozialismus – jenen Strömungen, die aus ihrer Sicht daran gescheitert sind, eine überzeugende Antwort auf die christlichen und romantischen Verwerfungen des aufklärerischen Fortschrittsdenkens zu formulieren. Für Shklar war es eine bittere Ironie, dass ausgerechnet die glaubhaftesten Erben der Aufklärung sich von deren zentralen Idealen abgewandt hatten.
Besonders hart ins Gericht geht Shklar mit dem Liberalismus. Er hatte begonnen, so ihre These, das Misstrauen gegenüber säkularer Bildung und gegen den Gedanken der »perfektionistischen« Selbstveränderung zu übernehmen – ursprünglich zentrale Ressentiments seiner einst konservativen Gegner. Gerade die Liberalen, so Shklar, trugen die Hauptverantwortung für das »Syndrom des Kalten Krieges«: jenes weitverbreitete Abwenden von der Aufklärung. Sie begannen, den Staat per se als unterdrückerisch zu betrachten und die Demokratie nicht als Hoffnung, sondern als potenzielle Vorstufe zum Totalitarismus – es sei denn, man minimiere den Staat und relativiere die Demokratie.
Denker in der liberalen Tradition begannen, so berichtet Shklar, bereits im 19. Jahrhundert ihre Hoffnung preiszugeben – sie opferten den Optimismus der Aufklärung aus Furcht vor den verstörenden Konsequenzen der Französischen Revolution. Doch was zunächst als vorsichtige Konzession begann, verwandelte sich im 20. Jahrhundert in eine tiefe, nahezu völlige Resignation. Mit feinem Spott und analytischer Schärfe lässt Shklar dabei auch eine frühe Kritik am »Neoliberalismus« à la Friedrich Hayek und seiner Schule einfließen – nicht, weil sie ihnen eine Verschärfung sozialer Ungleichheit durch ökonomische Liberalisierung vorwirft, sondern weil sie ihnen vorhält, den eigentlichen Geist des politischen Liberalismus preisgegeben zu haben, den sie doch angeblich vor dem Totalitarismus retten wollten.
Auch den Sozialismus verschont Shklar nicht: Dieser, so ihre Diagnose, habe sich nie wirklich von seiner Vorstellung erholt, die Geschichte werde das Reich der Gerechtigkeit ganz von selbst hervorbringen. Eine trügerische Gewissheit, die seine Anhänger in der Gegenwart ebenso ratlos zurücklasse wie jene auf der gegenüberliegenden Seite des ideologischen Spektrums.
Das Ende der Ideologie
Wenn Judith Shklar in späteren Jahren auf After Utopia zurückblickte, war sie oft geneigt, das Buch als eine rückblickende Darstellung des »Endes der Ideologie« zu lesen – wenn auch als eine, die vielleicht unbemerkt dazu beigetragen hat, den Boden für eine neuere und ambitioniertere liberale Theorie zu bereiten. In den 1950er-Jahren hatten Intellektuelle, die einst im Namen der Aufklärung für Freiheit und Gerechtigkeit stritten und im Sozialismus ihre politische Heimat gesucht hatten, das Aufkommen totalitärer Regime erlebt – und mit diesem auch das »Massenmorden«. After Utopia war der Versuch, jenes neue geistige Klima zu begreifen – eine postideologische Gegenwart, die aus dem Schock darüber hervorging, wie sehr politische Hoffnungen in Katastrophen umschlagen konnten.
Wie Shklar in einem autobiografischen Vortrag festhielt: »Ideologien waren die Motoren des Fanatismus und der Verblendung – und wir sollten nie wieder in dieser Weise politisch sprechen.« Was nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun blieb, war, so sagte sie, das »ideologische Trümmerfeld aufzuräumen« – mit einem »leidenschaftlichen Bemühen, uns vom politischen Pathos zu befreien«. Dieses Streben nach Nüchternheit, das ihrer Beobachtung nach nicht nur die analytische Philosophie der Nachkriegszeit prägte, sondern auch in der Ästhetik tonangebend wurde, bildete den geistigen Hintergrund von After Utopia.
Ein Ethos intellektueller Strenge, Klarheit und utopischer Askese – im Dienst der Abwehr von ideologischer Ekstase – wurde zum leitenden Prinzip, an dem sich Shklar orientierte. »Ich stand völlig unter dem Bann dieser geistigen Haltung«, erinnerte sie sich später, »die so offenkundig mit der Hoffnung auf einen humanen und funktionierenden Wohlfahrtsstaat verknüpft war.«
Das Ergebnis war eine Art ideengeschichtliche Autopsie – eine präzise und schonungslose Untersuchung des ideologischen Körpers. Gemeinsam mit anderen Initiativen der 1950er-Jahre half After Utopia dabei, »die Schande der unmittelbaren Vergangenheit zu überwinden« und bereitete zugleich den Weg für eine neue Phase politischen Denkens, die John Rawls mit A Theory of Justice (1971) einläuten sollte.
Shklars Erinnerung daran, dass After Utopia aus der geistigen Situation der 50er-Jahre hervorging, ist zweifellos aufschlussreich. Doch ihre eigene Rückschau auf dieses Erstlingswerk reicht nicht aus, um dessen gegenwärtige Bedeutung zu begründen. Tatsächlich, so lässt sich sagen, war sich Shklar selbst nie ganz sicher, ob das politische Denken ihrer Zeit je über jenes postideologische Syndrom aus Blockade und Hoffnungslosigkeit hinausgelangt war, das sie in After Utopia so eindringlich beschrieben hatte.
»Wenn ich behaupten wollte, dass niemand verstand, was mit uns geschah«, erinnerte sie sich 1981 in einem Gespräch, »dann musste das etwas mit den intellektuellen Traditionen zu tun haben, die wir geerbt hatten. … Und so … kam es … zu meiner Untersuchung des politischen Denkens des 19. Jahrhunderts, in dessen Schatten wir damals lebten.« Und dann – das ist entscheidend – fügte sie noch hinzu: »… und in dem wir zum großen Teil noch immer leben.«
Mit anderen Worten: Selbst nachdem John Rawls mit A Theory of Justice eine kraftvolle philosophische Begründung für einen humanen Wohlfahrtsstaat vorgelegt hatte, blieb für Shklar der Eindruck bestehen, dass sie und ihre Zeitgenossen weiterhin in der Nachwirkung jenes geistigen Erschütterungsmoments der Mitte des 20. Jahrhunderts lebten – eines Zusammenbruchs, der alle ratlos hinterließ in Bezug darauf, was eigentlich geschehen war, und der keinen neuen Optimismus mehr zuließ – weder unter liberalem noch unter sozialistischem Vorzeichen.
Leben auch wir noch immer in jenem ideengeschichtlichen Nachbeben? Genauer gefragt: Könnte es sein, dass die Leserinnen und Leser von After Utopia – allen Unterschieden zur Zeit des Kalten Krieges zum Trotz – in diesem Buch nach einer Erklärung für ein analoges postideologisches Zeitalter suchen, in dem sich auch unsere Gegenwart befindet? Und vielleicht gar nach einem Verständnis für jene Hindernisse, die uns heute den Ausgang verwehren?
So viel Hoffnung und Ambition John Rawls auch zeitweilig gestiftet haben mag – und so lautstark sich gegenwärtig manche geistlose Jünger von Fortschritt und Optimismus gebärden – wer wollte bestreiten, dass Intellektuelle unserer Zeit sich in mancher Hinsicht in einer ähnlichen Lage wiederfinden wie Judith Shklar damals? Das nach dem Kalten Krieg verkündete »Ende der Ideologien« – und bald darauf gar das »Ende der Geschichte« – hatte seine Folgen noch nicht voll entfaltet, als Shklar starb. Doch aus heutiger Sicht ist klar: Diese Verheißungen haben uns keineswegs vor der Rückkehr einer Politik der Angst geschützt. Sie haben vielmehr dazu beigetragen, dass sowohl Liberale als auch Sozialisten in einer Phase intellektueller Unentschiedenheit verharren.
Als Erben jenes modernen Denkens, das Shklar in After Utopia so eindrucksvoll rekonstruierte, erkennen wir heute, dass das »Nach« der Utopie keine fernliegende Situation beschreibt – sondern vielmehr ein vertrauter Ort ist, an dem wir uns auch heute wiederfinden.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Otmar Tibes.
 Lesezeit 13 Minuten
Lesezeit 13 Minuten