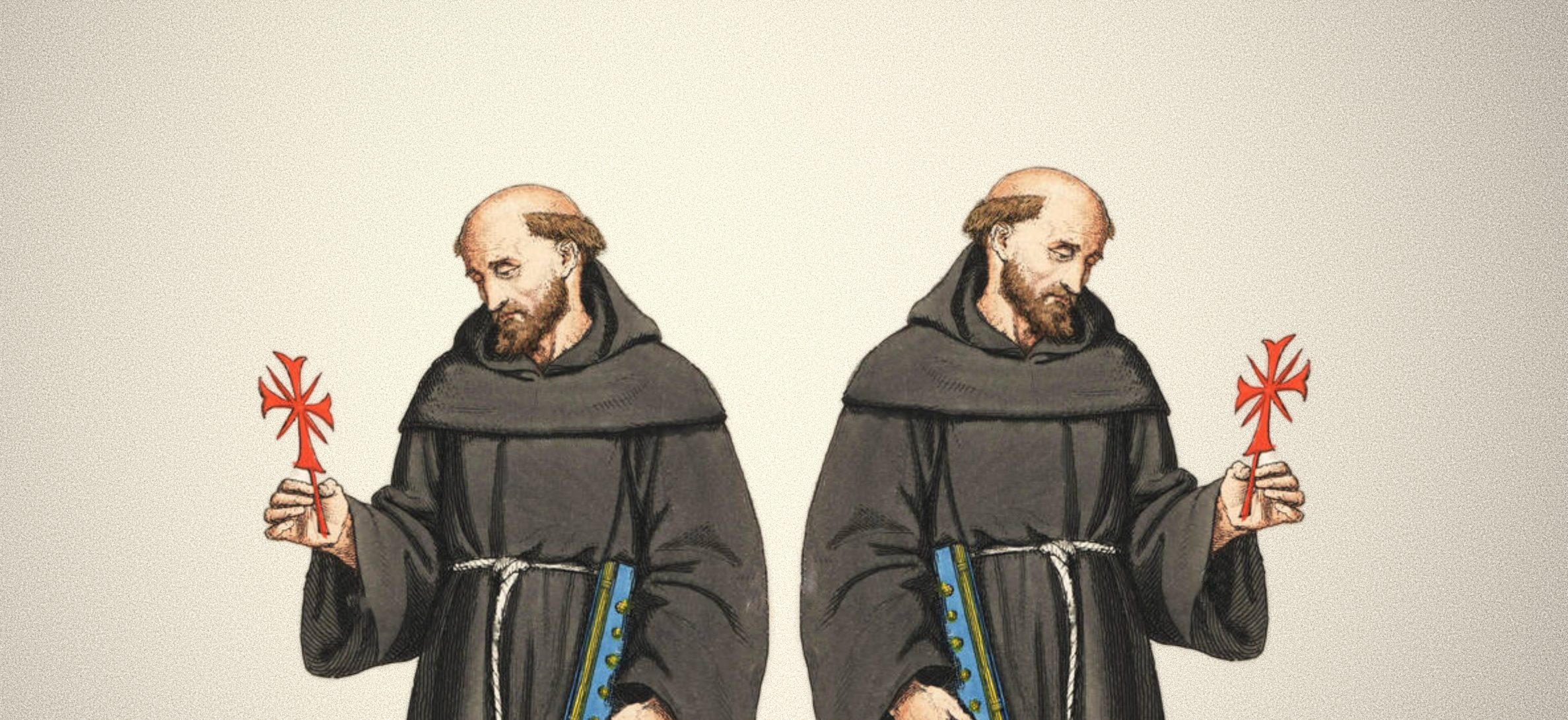Die kranke Stadt
Was ist eigentlich das Problem mit der Ungleichheit? Oliver Weber greift in seinem Rezensionsessay zwei Neuerscheinungen auf, die sich mit dieser Frage befassen, und konfrontiert die Überlegungen von Thomas Piketty und Michael Sandel mit dem argumentativen Reichtum der klassischen Politischen Philosophie.
Will man den Kampf gegen die rechtsautoritären Bewegungen gewinnen, so lautet die Prämisse dieses Buchs, muss man mehr tun als die liberale Ordnung verteidigen. Man muss eine eigene Stimme entwickeln. Die Sprache der Unzufriedenen sprechen, ohne ihren Ressentiments zu verfallen. In »Kämpfe der Zukunft« haben Thomas Piketty und Michael Sandel diesen Versuch gewagt. In Form der Niederschrift eines Gesprächs, das beide an der Paris School of Economics geführt haben, wollen sie für die politische Linke ergründen, welche Zukünfte ihr noch offenstehen, nachdem mit der abermaligen Wahl Donald Trumps Düsterkeit zur vorherrschenden Stimmung geworden ist.
Der Vorschlag Pikettys, der sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gespräch zieht, lautet, das Ungleichheitsproblem in den Mittelpunkt progressiver Programmatik zu rücken. Das ist insofern nicht überraschend, als Pikettys Weltruhm auf dem sozialstatistischen Nachweis beruht, dass in westlichen Gesellschaften der vergangenen vierzig Jahre die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in bemerkenswertem Ausmaß zugenommen hat. Nicht nur konsumieren die Arbeitnehmer einen geringeren Anteil der von ihnen produzierten Güter, darüber hinaus zahlte das deutlich schnellere Wachstum der Vermögenswerte – Boden, Immobilien, Aktien, Betriebseigentum – vor allem bei den sehr Begüterten ein. Im Gespräch mit Sandel wird deutlich, warum diese Tendenz für Piketty bemerkenswert ist: Der französische Ökonom geht von dem Geschichtsbild langfristiger Egalisierung aus. Die vergangenen vierzig Jahre sind ihm gewissermaßen eine Anomalie, ein Ausreißer auf einer sich seit dem Anbruch der Moderne in Richtung Gleichheit beugenden Kurve.
Warum ist Ungleichheit überhaupt ein Problem?
Für Piketty ist die Fortführung dieser Tendenz jedoch kein Automatismus. Man muss für sie kämpfen. Der langfristige Trend beweist lediglich, »dass diese Kämpfe sich gewinnen lassen«. Umso wichtiger ist es beiden, die Frage zu beantworten, warum Ungleichheit überhaupt ein Problem ist. Denn wenn sich eine politische Programmatik auf der Skandalisierung von Ungleichheit gründen lassen soll, muss das Thema von mehr als akademischem Interesse sein – es müsste sich als verbindendes Glied auf der politischen Agenda wiederfinden lassen, sein Wirken müsste im Erleben der Bürgerschaft spürbar sein, es müsste die Nöte und Übel der Zeit wie ein Bündel umgreifen. Und genau an dieser Stelle stand sich die Ungleichheitsforschung bislang selbst im Weg, obwohl sie dank Piketty im vergangenen Jahrzehnt eine neue Hochkonjunktur erlebte. Ihr Erfolg gründete darauf, Ungleichheit messbar zu machen. Plötzlich konnte man auf die Nachkommastelle genau angeben, wie sich Einkommensströme und Vermögenssummen verschoben haben. Diese Genauigkeit verlieh den Erkenntnissen eine besondere Evidenz – doch sie machte aus dem Phänomen der Ungleichheit ein abstraktes Rechenspiel. All die grundsätzlichen Fragen gelungenen Zusammenlebens, die mit dem Thema verbunden sind, verschwanden hinter der Abstraktionsleistung des Gini-Koeffizienten.

Oliver Weber
Statistische Fragen spielen folgerichtig in diesem Gipfelgespräch kaum eine Rolle. Mit Sandel, der als kommunitaristischer Rawls-Kritiker weltbekannt geworden ist, sitzt Piketty dafür genau der richtige Gesprächspartner gegenüber (von einer Diskussion kann keine Rede sein). Sandel interessieren vor allem die moralischen und sittlichen Ungleichheitsfolgen für das republikanische Gemeinwesen. Wenn ein Hedgefonds-Manager fünfhundertmal mehr verdient als eine Lehrerin, ist das ungerecht. »Aber es ist über die Ungerechtigkeit hinaus auch eine Art Beleidigung und eine Kränkung. Es ist eine kollektive Kränkung und Beleidigung, die unsere Gesellschaft, zumindest implizit, denen zumutet, die arbeiten, im altvertrauten Sinne des Wortes Arbeit, ob sie nun Pflegekräfte, Elektriker oder Klempner sind« – so grenzt er sich im Laufe Gesprächs von Piketty ab, der Ungleichheit zunächst vorwiegend aus dem Blickwinkel politischer Einflussnahme und sozialer Teilhabe betrachtet.
Es geht Sandel, und in der Folge auch Piketty, also in erster Linie darum, was Ungleichheit für eine Gesellschaft bedeutet. Wie fühlt sich etwas so Abstraktes wie ein gestiegener Gini-Koeffizient an, was heißt eine ungleichere Verteilung des Sozialprodukts für das Erleben und Zusammenleben der Bürger? Piketty verweist etwa darauf, dass Kaufkraft keine rein ökonomische Kategorie ist, sondern ein Sozialverhältnis bezeichnet: Es handelt sich um »Macht, die Zeit anderer zu kaufen«. Bei »Wohlstand und Eigentum geht es also nicht bloß um Geld. Es geht um Verhandlungsmacht gegenüber anderen und um die Kontrolle über das eigene Leben«. Wer reich ist, kann jeden Job ablehnen, für den jemand Armes kämpfen muss. Und nicht nur das, wie Sandel ergänzt: In einer ungleichen Gesellschaft »schicken wir nicht nur unsere Kinder in verschiedene Schulen, wir leben und arbeiten, wir shoppen und spielen auch an verschiedenen Orten«. Es ist erstaunlich, wie selten Freundschaften und Ehen über große Schichtdifferenzen hinweg geschlossen werden – man ist sich fremder, kann bestimmte Lebensweisen nicht miteinander teilen. Ungleichheit, so könnte man die Ausführungen der beiden zusammenfassen, modifiziert beinahe sämtliche Sozialbeziehungen, verändert Erfahrungen, Erwartungen, wertet und entwertet.
Der Widerspruch von Sozialdemokratie und Individualismus
Piketty ist der energischere der beiden Gesprächspartner. Der Ökonom ist stärker bemüht, Antworten zu geben als Fragen zu stellen, beendet seine Ausführungen nicht selten mit konkreten politischen Forderungen, die zum Teil so vernünftig wie bekannt, zum Teil aber auch neu sind. Er möchte höhere Spitzensteuersätze, substantielle Erbschaftssteuern und überhaupt eine stärkere Steuerprogression. Außerdem Losverfahren, um den Zugang zu Eliteuniversitäten und sogar politischen Institutionen zu egalisieren, schließlich die Dekommodifizierung jener Lebensbereiche, in denen Gewinninteressen keinen Platz haben sollten – Bildung und Gesundheit etwa.
Sandel ist nachdenklicher, skeptischer. Seine Grundfrage ist eigentlich immer dieselbe, klassische: Wie muss eine Bürgerschaft verfasst sein, die die Vorschläge Pikettys (die er im Übrigen teilt) wirklich will und mit ihrer Hilfe eine gemeinsame Lebensform gestaltet? Der »Fehler von Progressiven und Sozialdemokraten« ist aus Sandels Sicht, »für progressive Besteuerung zu plädieren, ohne sich um die moralischen Grundlagen der Gemeinschaftlichkeit oder Identität zu kümmern«. All die sozialdemokratischen Policies haben eine Voraussetzung, nämlich den Glauben, »dass Wohlstand eine kollektive, keine individuelle Errungenschaft ist«. Aber um das »zu erfahren, zu erfühlen, zu glauben, dass wir Teil eines gemeinsamen Projekts sind« fehlen uns inzwischen die Institutionen, die ein solches gemeinschaftliches Ethos pflegen und fördern. Genau dies ist in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen.
Man kann, das ist Sandels Argument, keinen sozialdemokratischen Staat aus lauter Individualisten zusammenfügen. Solchen liberalen Subjekten liegt der Markt immer näher, weil er uns »die Möglichkeit bietet, uns unübersichtliche, kontroverse, konfliktgeladene Debatten darüber zu ersparen, wie wir Güter und die ganz unterschiedlichen Beiträge, die Menschen zur Wirtschaft und zum Gemeinwohl leisten, bewerten sollen.« Der Marktglaube hat den ungemeinen Vorteil, scheinbare »Neutralität gegenüber substantiellen Wertvorstellungen und Konzeptionen des Guten Lebens« gewährleisten zu können. Eine Linke, die wieder Boden unter den Füßen gewinnen will, muss, so kann man Sandel verstehen, also mehr tun, als auf anscheinende Ungerechtigkeiten von Verteilungskurven hinzuweisen. Sie muss sich mit den Zwecken und Sinnformen des gemeinen Lebens auseinandersetzen, ein Ethos der Gemeinschaftlichkeit nicht nur vertreten, sondern auch aufgreifen, wo er schon vorhanden ist, als Familiensinn, lokale Heimatverbundenheit, sogar als Patriotismus.
Der Reichtum der klassischen Ungleichheitskritik
Dass das Gespräch mit diesen Hinweisen nur an der Oberfläche kratzt, merkt man schnell, wenn man eine andere Neuerscheinung aufschlägt. Der amerikanische Politiktheoretiker David Lay Williams hat unlängst eine Ideengeschichte der ökonomischen Ungleichheit vorgelegt, die – »from Plato to Marx« – eindrucksvoll daran erinnert, dass das Nachdenken über Ungleichheit zu den klassischen Topoi der Politischen Philosophie gehört. Der Buchtitel, »The Greatest of all Plagues«, ist eine Zitat Platons. Dessen Figur des Fremden legt in den ›Nomoi‹ seinen beiden Zuhörern dar, dass die Spaltung in Arm und Reich (die einander bedingen) nur das erste Symptom der größten aller Staatskrankheiten ist, nämlich des Bürgerkriegs.
Die ideengeschichtliche Erinnerung funktioniert hier vor allem als Argument gegen all jene, die, wie etwa Hayek oder Friedman, in jüngster Zeit Steven Pinker, Ungleichheitskritik zu einer Erfindung des 20. Jahrhunderts erklärt haben, die mit der westlichen Zivilisation geradezu in Widerspruch stehe. Nichts könnte falscher sein. Anhand der Dialoge Platons, des Alten und Neuen Testaments, Hobbes‘ Staatstheorie, Rousseaus Luxuskritik, Smiths Moralpsychologie, Mills Utilitarismus und Marx‘ Theorie proletarischer Befreiung zeigt Williams, wie sich, trotz aller Unterschiede in Zeit, Begriff und Stoßrichtung, die Problematisierungen von Ungleichheit ähneln und ergänzen. Wenn überhaupt, ist im historischen Vergleich das öffentliche Eintreten für die Akzeptierbarkeit extremer Reichtumsunterschiede das Neue und Bemerkenswerte. Der Inegalitarismus ist das Radikale.
In »The Greatest of all Plagues« lernt man, welche Reflexionshöhe politischen Philosophierens in den Verobjektivierungs- und Vermessungswellen der modernen Wissenschaft verloren gegangen ist. »Diese kanonischen Denker fordern uns dazu auf, über Ungleichheit nicht nur empirisch nachzudenken, sondern auch darüber, wie sie unsere Moral, unsere religiösen Verpflichtungen, unsere Beziehungen zu unseren Nachbarn, Arbeitgebern und Kollegen affiziert«. Williams erinnert daran, dass sowohl Athen als auch Sparta noch vor der klassischen Zeit beinahe an der Krankheit der Ungleichheit zugrunde gegangen wären, hätten nicht Solon und Lykurg der Bürgerschaft jeweils politisch-soziale Verfassungen gestiftet, die die Einheit der Polis wiederherstellten. Im Falle Spartas mithilfe recht radikaler Institutionen, wie der Pflicht zur gemeinsamen Mahlzeit, der Abschaffung von Edelmetallwährungen, dem Verbot von Luxusgütern und der Umverteilung von Land. In Platons Dialogen, so argumentiert Williams, sind diese tradierten Erfahrungen eingegangen. Nicht Fragen der Kaufkraft stehen für ›Sokrates‹ (in der ›Politeia‹) oder dem ›attischen Fremden‹ (in den ›Nomoi‹) daher im Vordergrund, sondern was Ungleichheit für die Tugend des Bürgers und die Seele der Stadt bedeutet.
In den platonischen Dialogen wird nicht davon abstrahiert, dass ein ungleicheres Sozialverhältnis auch die Stellung des Bürgers zu seinen Mitbürgern verändert. Ungleiche Poleis beherbergen zwei Städte in einer: Es besteht stets die Gefahr, dass die Klassenidentität die Polisidentität verdrängt. Doch nicht nur das. Letztlich frisst sich Ungleichheit bis in die Seelen der Bürger hinein: »Während die Reichen egoistisch und habgierig werden, werden die Armen im selben Maße verbittert, verzweifelt und wütend«. Die Eitelkeit der einen macht sie unfähig zur politischen Unterordnung, die Unterlegenheit der anderen öffnet sie für die Rhetorik des Demagogen. Stadtfriede und Stadtstärke gibt es nur dort, wo Bürgerfreundschaft und Bürgertugend herrschen. Extreme Ungleichheit ist hier nicht bloß eine Rechengröße, sondern eine sittliche, seelische Krankheit. Der athenische Fremde schlägt konsequenterweise vor, dass, wo immer eine Kolonie zu gründen ist, der reichste Bürger höchstens viermal so viel wie der ärmste besitzen soll. Heute reden wir über das Tausendfache.
Ähnlich erhellend sind die Kapitel zum Alten und Neuen Testament. Williams erinnert an die jüdische Siebenjahresregel, wonach regelmäßig alle Schulden erlassen werden sollten, um die im Volk Gottes eingerissene Ungleichheit rückgängig zu machen. Eine Regel, an die noch Jesus (ein armer Zimmermannssohn) anschließt, wenn er die Liebe zu Gott über, ja gegen die Hierarchien der Menschenwelt stellt. »Man kann nicht Gott und dem Reichtum zugleich dienen«. Ein Glaube der Nächstenliebe, der dazu führt, dass die Reichen die Armen nicht mehr als Ausbeutungsobjekt und die Armen die Reichen nicht mehr als Ausbeuter wahrnehmen, sondern beide einander als Menschen und Kinder Gottes: Dank Williams historisierender Kapitel versteht man erst die Sprengkraft dieser Lehre im Kontext der jüdisch-römischen Klassengesellschaft.
Die Habgier wird gesellschaftsfähig
Das Buch springt von dort – recht weit – in die Bürgerkriegswelten des jungen Thomas Hobbes, zeigt auf, dass Ungleichheit letztlich das Gewaltmonopol des Staates untergräbt, weil die Privatmacht die öffentliche Autorität überstrahlt und die Eitelkeit der Reichen jede ernsthafte Besteuerung verunmöglicht; streift Adam Smiths Moralpsychologie und Ungleichheitsaversion, um von dort schließlich zu Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill und schließlich Karl Marx zu gelangen.
Auffällig ist zweierlei: Je weiter man den Zeitstrahl entlang schreitet, desto seltener werden Argumente, die das Innere, die Tugend der Bürger thematisieren. Die Moderne trennt Recht und Moral – vollends wird dies bei Mill deutlich, der Ungleichheit nur noch (deswegen aber nicht weniger nachdrucksvoll) zum Zweck der äußeren Schadensvermeidung bekämpfen will. Doch nicht nur das. Auch die moderne Trennung von Staat und Gesellschaft behauptet ihr Recht: Die Einheit der Polis ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt der philosophischen Auseinandersetzung. Die Bedürfnisse und Ziele der Einzelnen schieben sich in den Vordergrund. Damit hängt zusammen, dass seit dem späten 18. Jahrhundert die Möglichkeiten einer wachsenden Wirtschaft der klassischen Ungleichheitsskepsis einen Gutteil ihrer materiellen Evidenz nehmen: Die Gewinne des einen müssen nicht mehr die Verluste des anderen sein. Die Chrematistik und die ihr zugrunde liegende Seelenverformung, die Habgier, werden jetzt gewissermaßen gesellschaftsfähig, insofern sie nämlich zum größeren Konsum aller beitragen.
An dieser Stelle reißt die Tradition klassischer Ungleichheitskritik ab. Nicht nur, aber auch, weil sich die Bedingungen grundlegend gewandelt haben. Darüber kann auch Williams nicht hinwegtäuschen, sosehr er auch die Gegenwartsnähe sucht, indem er für jeden einzelnen Autor auflistet, was in dessen Sinne »getan werden solle« – von Platons Luxusgesetze, über Hobbes Staatsmacht, Rousseaus korsischem Korsett bis zu Mills Erbschaftssteuern und Arbeitergewinnbeteiligungen. Ob noch einmal ein politisches Programm aus der Skandalisierung von Ungleichheit hervorgehen kann, wie es Piketty und Sandel vorschwebt, hängt auch davon ab, ob die Öffentlichkeit noch davon überzeugbar ist, dass es einen »Punkt gibt, ab dem die Vorteile des Wirtschaftswachstums die Kosten der Ungleichheit nicht mehr ausgleichen«. Was hier unter »Kosten« zählen darf, das weiß man nach Williams‘ Buch, ist das Entscheidende. Denn dass und woran die Stadt erkrankt ist, sieht nur derjenige, der nicht an derselben Krankheit leidet.
 Lesezeit 12 Minuten
Lesezeit 12 Minuten