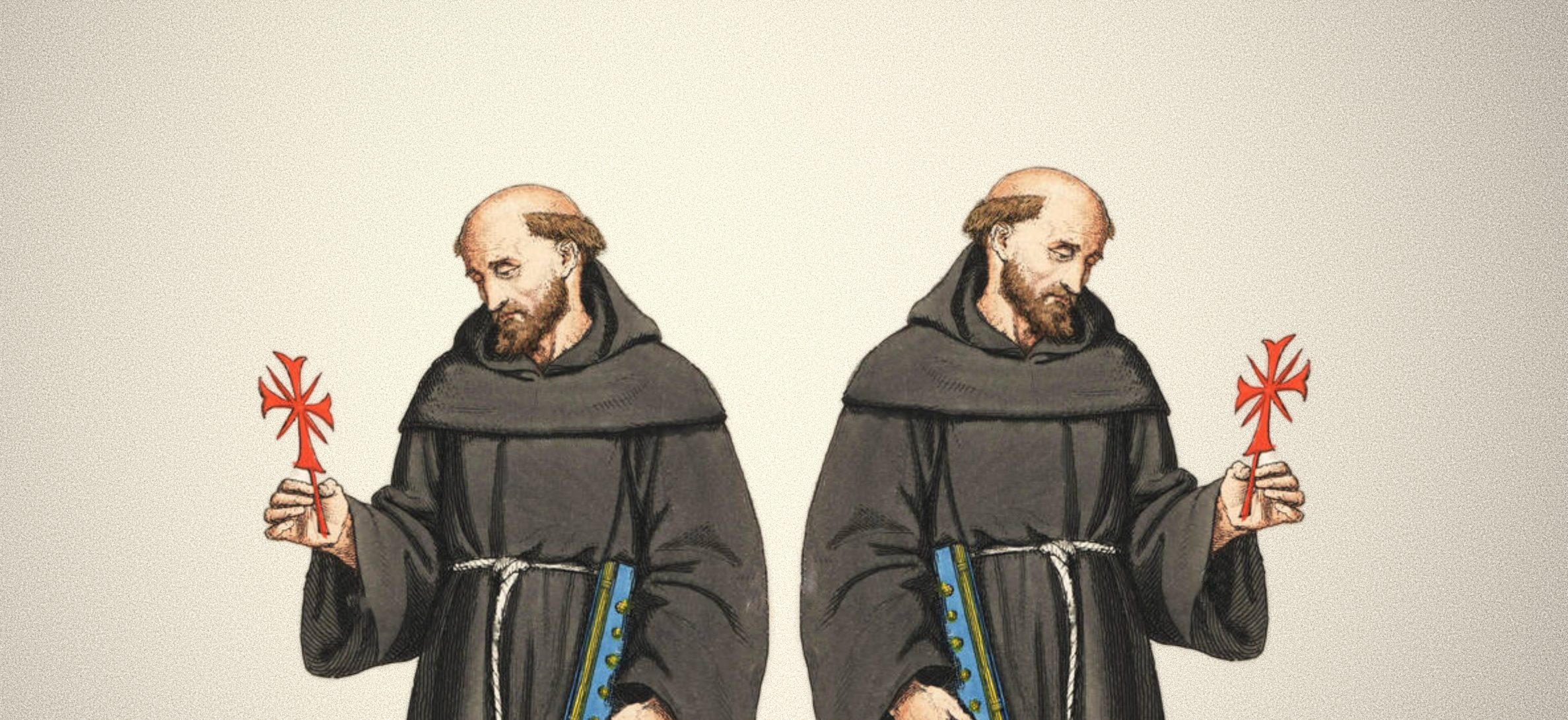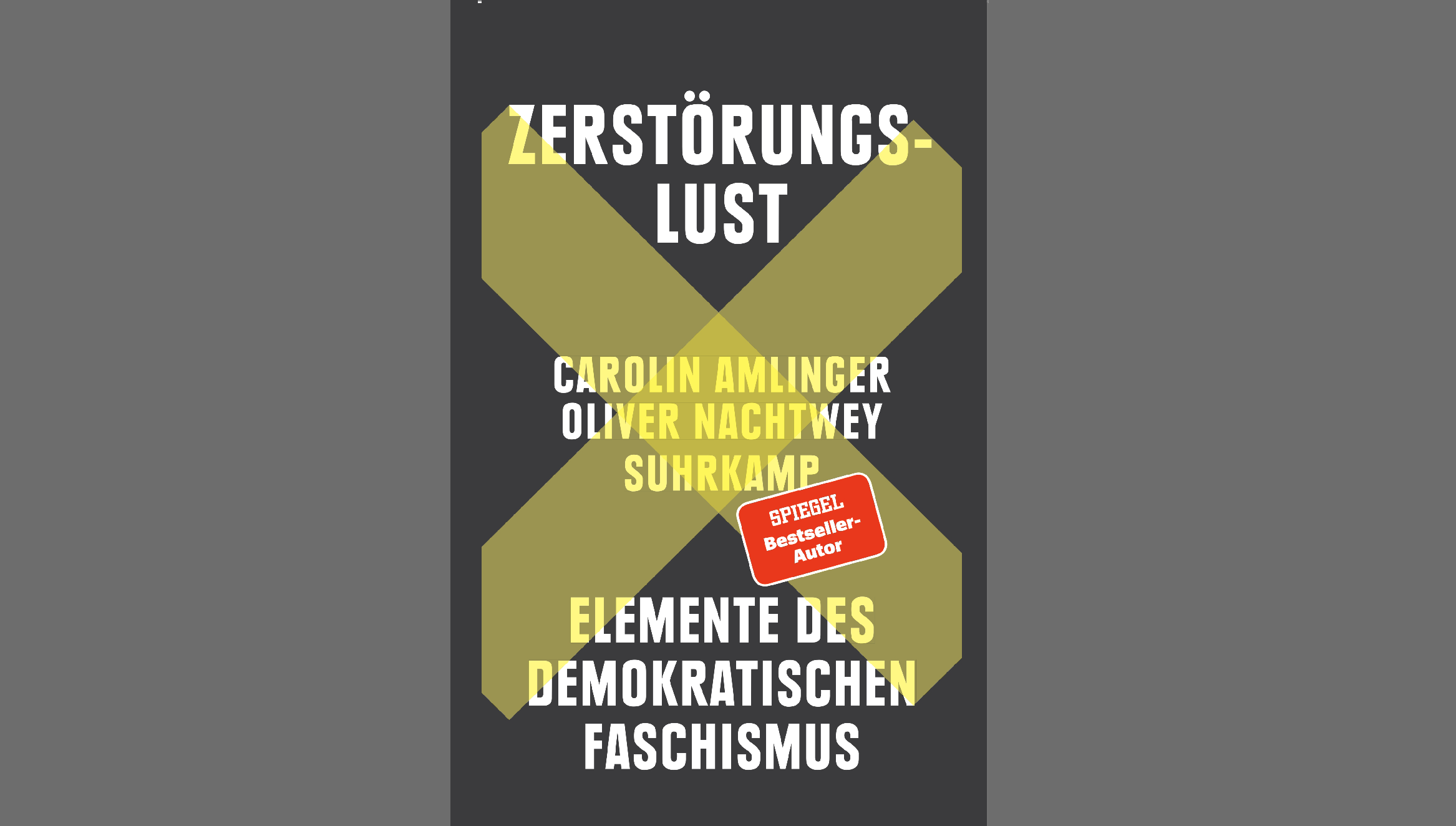
»Nicht wie ein Liberaler denken«
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey zeigen in Zerstörungslust, wie die Verheerungen der liberal-kapitalistischen Gesellschaft destruktive Menschen hervorbringt, die sich nach rechts wenden. Sie fordern einen »postliberalen Antifaschismus«.
Die liberale Demokratie steckt in der tiefsten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Überall auf der Welt gewinnen rechte und autoritäre Kräfte die Hegemonie, große Teile der Bevölkerung verlieren das Vertrauen in liberale Institutionen – oder stehen diesen sogar feindlich gegenüber. Supereiche Eliten und Tech-Oligarchen schlagen sich auf die Seite der Reaktion und helfen, deren Macht auszubauen.
Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben nun ein Buch vorgelegt, das den Verhängniszusammenhang der aktuellen historischen Situation umfassend erhellt. Für Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus haben sie eine Umfrage mit 2.600 Personen durchgeführt und diese mit qualitativen Interviews mit 41 Personen ergänzt. Die Ergebnisse haben sie mit dem gesamten Arsenal der Kritischen Theorie zu einer luziden Gegenwartsanalyse kombiniert. Eine vergleichbare Arbeit sucht man derzeit vergebens im deutschsprachigen Raum.
Den Autoren zufolge zeichnet die aktuelle politische Situation sich durch den Aufstieg eines »demokratischen Faschismus« aus. Diese paradox anmutende Begriffsbildung zielt auf die reale Widersprüchlichkeit der existierenden rechten Koalition. Von Trump über Meloni bis Milei sind die Rechten nicht durch einen Umsturz der Demokratie, sondern auf demokratischem Wege an die Macht gekommen. Gleichzeitig arbeiten sie mit ihrer Politik daran, demokratische Institutionen auszuhöhlen und zu zerstören. Der neue rechte Block setzt sich dabei aus verschiedensten, heterogenen Strömungen zusammen, über Rechtslibertären, zu religiös-fundamentalistischen Konservativen bis hin zu Völkischen-Nationalen. Doch warum gewinnen sie weltweit an Zulauf?

Matthias Ubl
Nullsummendenken
Amlinger und Nachtwey gehen – mit der Philosophin Rahel Jaeggi – davon aus, dass die liberalen Demokratien in eine Regression geraten sind: Liberale Gesellschaften schaffen keinen Fortschritt mehr und lösen auch ihre selbst erzeugten Probleme nicht mehr. Das aber führt zu einem umfassenden Verlustgefühl, das sich vor allem auf die eigene Zukunft richtet. In den westlichen Demokratien ist es zu einer »Eskalation der Ungleichheit« gekommen, die Armut, Abstiegsängste und »blockierte Leben« hervorbringt, während oben weiter Reichtum akkumuliert wird. Das Aufstiegsversprechen der liberalen Leistungsgesellschaft ist gebrochen.
Viele der Interviewten fühlen sich in ihren Lebenschancen gehemmt und von der Gesellschaft missachtet, auch wenn sie nicht akut von Armut bedroht sind. Die Weltsicht vieler Befragter ist dabei von einem sogenannten »Nullsummendenken« geprägt: Jeder Gewinn des einen, ist der Verlust des anderen. Der gesellschaftliche Kuchen wird kleiner, weshalb jeder darum kämpfen muss, ein Stück davon abzubekommen. Die Studie macht deutlich, dass das Nullsummendenken geradezu der ideologische Nährboden für faschistische Einstellungen ist.
Dabei schafft es die Linke nicht, das Nullsumendenken für sich fruchtbar zu machen. Der Groll der Mehrheit richtet sich nicht etwa gegen die Gewinne der Oberklasse, sondern gegen Geflüchtete oder sozial Schwache. Vor allem in den unteren Klassen ist dabei die meritokratische Ideologie deutlich verbreitet: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Die ökonomischen und sozialen Krisen bringen eine Atmosphäre der Härte hervor, bei der ein Hauen und Stechen im Kampf um den gesellschaftlichen Reichtum herrscht und ein jeder sich selbst am nächsten ist. Dass in dieser Situation »Migranten« unterstützt oder »bevorzugt« werden und Menschen ihr Geschlecht vermeintlich willkürlich ändern, sich also »etwas herausnehmen«, ruft bei vielen Befragten Wut, Missgunst und schlicht Ungerechtigkeitsempfinden hervor.
Zerstörungslust
Dem steht dabei laut Amlinger und Nachtwey ein System der Bevormundung gegenüber, das von einem »Strukturwandel der Herrschaft« zeugt. Die gewachsene neue Mittelklasse aus Lehrern, Gleichstellungsbeauftragten, Ärztinnen, Journalistinnen, Sozialarbeitern, Psychologen und anderen symbolischen Kompetenzträgern ist ständig damit beschäftigt, den Rest der Gesellschaft zu einem gesünderen, ethischeren oder effizienteren Leben anzuhalten. Amlinger und Nachtwey kommen zu dem Schluss, dass gegenwärtig überall »regiert und interveniert« wird.
Das erzeuge Abwehr, Renitenz und das Gefühl der Bevormundung, das mit der symbolischen Entwertung des eigenen Lebensstils einhergeht. In einem wunderbaren Beispiel fassen das Nachtwey und Amlinger so: War der Verbrenner einst »das Symbol eines auskömmlichen Lebens, ist er heute ein moralisch umstrittenes Verkehrsmittel, das zudem mit jeder Tankfüllung an die Grenzen des eigenen Geldbeutels erinnert.« Für viele Menschen, die »ihrem Selbstbild nach« ein »anständiges Leben geführt haben, steht ihre moralische und soziale Integrität infrage«.
In den Interviews, die Amlinger und Nachtwey geführt haben, zeigt sich bei vielen der Befragten in dieser Situation die titelgebende »Zerstörungslust«. Viele Befragte haben Schicksalsschläge erlitten, ihr Haus wurde zwangsversteigert, Angehörigen wurde die Pflegestufe verweigert, Frauen litten unter missbräuchlichen Beziehungen. Diese Erfahrungen speisen bei vielen ein destruktives Bedürfnis nach Rache und Chaos, an das die Rechte erfolgreich anknüpfen kann.
Die Führung der Gefühle
Amlinger und Nachtwey können plausibel zeigen, wie das aktuelle rechte Projekt tatsächlich an Elemente des Faschismus des 20. Jahrhunderts anknüpft, vor allem in seiner italienischen Spielart (auch wenn sie natürlich die zahlreichen Unterschiede zurecht betonen). Auch der aktuelle faschistische Block will mit geradezu revolutionärem Eifer eine mythische, imaginäre Ordnung wiederherstellen und stiftet dabei über starke Affekte eine, wenn auch hyperpolitische, »Gefühlsgemeinschaft«, die den Abgehängten, Gekränkten oder Opfern gewordenen Subjekten des liberalen Kapitalismus Teilhabe und affektive Entlastung bietet. In den digitalen Medien arbeiten Rechte an einer karnevalesken, von zynischem Humor und Dominanzfantasien geprägten Mythologie, die den Gekränkten eine imaginäre Omnipotenz verleiht.
Wie schon der Schriftsteller Tommaso Marinetti 1909 in seinem »Manifest des Futurismus« einer umfassenden Zerstörungslust freien Lauf ließ, die aus den Trümmern der alten Ordnung eine neue Welt schaffen will, so zeigen sich bei immerhin 12 Prozent der von Amlinger und Nachtwey Befragten massive destruktive Neigungen. Amlinger und Nachtwey gelingt es so zu zeigen, wie die politischen, ökonomischen und medialen Makrodynamiken in den psychologischen Einstellungen der Subjekte niederschlagen – und wie wiederum der rechte Block an diese Einstellungen andockt. Der neue Faschismus betreibt nach Amlinger und Nachtwey eine »Führung der Gefühle«. Und diese Gefühle sind überwiegend destruktiv.
Die liberale Utopie
Die Soziologen nehmen dabei nicht nur den Kapitalismus und seine Verheerungen in den Blick, sondern vor allem auch den Liberalismus. Im Schlusskapitel erwähnt das Autorenduo den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, der schon früh erkannte, dass die »Durchsetzung der liberalen Utopie der selbstregulierenden Marktgesellschaft« die menschliche Gemeinschaft zerstöre. Amlinger und Nachtwey fordern einen postliberalen Antifaschismus, der für eine »demokratisch eingebettete und zum Teil geplante Ökonomie« eintrete.
Hier gilt es mit den Autorinnen weiterzudenken. Welche Rolle könnten zum Beispiel sozialistische Finanzmärkte oder Genossenschaftsmodelle spielen, wie sie jüngst der Philosoph Hannes Kuch in seinem herausragenden Buch »Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus« diskutierte? Könnten linke politische Kräfte ihre lange Tradition der Kollektivität und Gemeinschaftlichkeit gegen den zerstörerischen Hyperindividualismus liberaler Gesellschaften wiederbeleben, ohne dass das Individuum dabei auf der Strecke bleibt? Amlinger und Nachtwey bieten die soziologische Grundlage, auf der jedes ernsthafte Nachdenken über Antifaschismus und linke Politik heute stattfinden muss.
 Lesezeit 6 Minuten
Lesezeit 6 Minuten