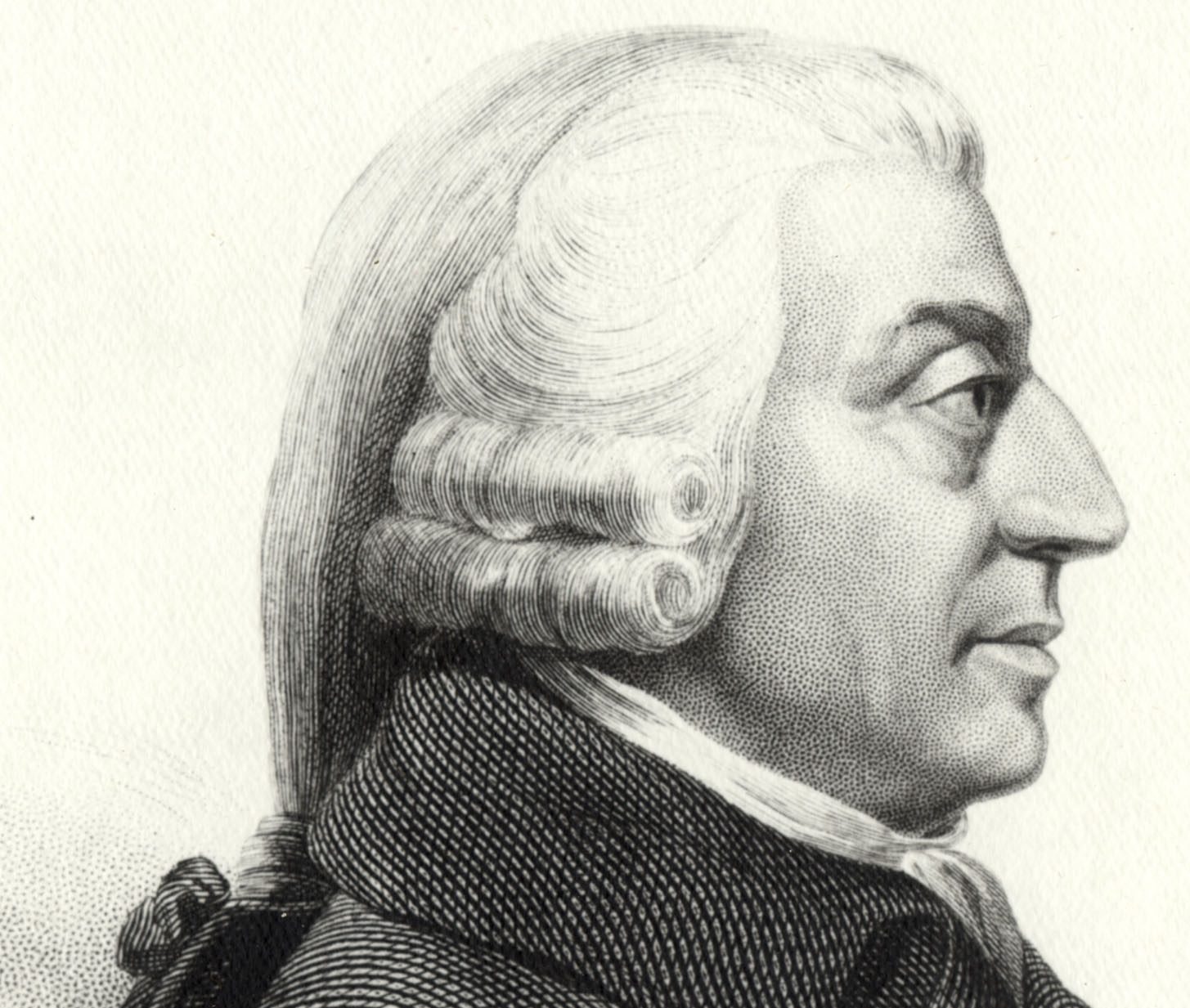
Adam Smith (1723-1790) via Wikimedia Commons
Wirtschaft als Ethik. Adam Smith und der Konfuzianismus
Für Adam Smith war das, was später Kapitalismus heißen sollte, einmal ein humanistisches Programm: Nicht Wirtschaftsethik, sondern Wirtschaft als Ethik – mit einigen Analogien zum Konfuzianismus, schreibt Daniel-Pascal Zorn in seinem Beitrag.
Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kapitalismus. Seit der Finanzkrise ab 2007 und der darauf folgenden Eurokrise ist das uneingeschränkte Vertrauen in die neoklassische Auslegung des Kapitalismus dahin. Diese Auslegung versprach einen perfekten Markt, der unter perfekten Bedingungen perfekt funktionieren würde – und unter den Bedingungen menschlicher Schwäche immer noch so gut, dass so etwas wie ‚Krisen‘ nur die Fehlerhaftigkeit menschlicher Eingriffe in den perfekten Markt bedeuten könnten.
Die neoklassische Auslegung beruft sich auf Adam Smith als ihren Stammvater, der mit dem Konzept der ‚unsichtbaren Hand‘ das Wunder eines freien Marktes vorweggenommen habe und dessen Verständnis des homo oeconomicus – des rein selbstzweckorientierten Marktteilnehmers – eine Blaupause für den modernen und markteffizient handelnden Menschen sei. Adam Smith steht so auch für Kapitalismuskritiker für eine rationalistische, utilitaristische und in ihren Konsequenzen unmenschliche Betrachtung des Marktes und des Menschen.
Zu diesem europäisch-amerikanischen Diskurs über den Kapitalismus tritt seit einigen Jahren die Wahrnehmung einer neuen Form von Kapitalismus hinzu, die vor allem mit Chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht zu tun hat. So warnt der slowenische Philosoph Slavoj Žižek vor einem ‚capitalism with asian values‘, ein ironischer Begriff, der eigentlich einen autoritären, deregulierten und in der Konsequenz illiberalen Kapitalismus meint. 1 Žižek, Slavoj: Demanding the Impossible, hg. v. Yong-june Park, Cambridge 2013, S. 5, 26, 30. Dieser autoritäre Kapitalismus, so Žižek, ist „the real result of the Cultural Revolution“ 2 Žižek, Demanding, S. 5. – und er droht, zu einem Modell für Europa und die USA zu werden: „The marriage between capitalism and democracy is over.“ 3 Žižek, Demanding, S. 30.
Europa, so scheint es, wird ideologisch in die Zange genommen. Seine eigenen neoklassischen und libertären Anteile stehen dem autoritären Modell und seiner Markteffizienz durchaus offen gegenüber – und wer könnte sich, angesichts geheimer Freihandelsabkommen und dem nicht zu unterschätzenden Einfluss globaler Finanzunternehmen auf die EU als Institution, nicht des Eindrucks erwehren, die letzte Bastion sei die Demokratie?
Ich möchte in meinem Beitrag ein etwas anderes Bild von den ökonomietheoretischen Ressourcen Europas und Chinas zeichnen und dem oberflächlich unheilvollen Akkord von neoklassischem und autoritärem, europäischem und chinesischem Kapitalismus eine tieferliegende positive Resonanz gegenüberstellen, eine Resonanz, in der ökonomischem Denken und Handeln ethisches Denken und Handeln zugrundeliegt. Europa und China haben beide, am Grunde dessen, was sich heute als neoklassisch und autoritär präsentiert, wesentliche ethische Prinzipien entwickelt, die auch und insbesondere ökonomische Vernunft anleiten; werden sie vergessen, unterbietet diese Vernunft sich selbst – und gerinnt zu einem fatalen Selbstmissverständnis, das dann nur noch autoritäre und dogmatische Formen annehmen kann. Das muss gar nicht als moralistische Warnung aufgefasst werden, denn ein ökonomisches Selbstverständnis, das den Staat immer weiter in Frage stellt und dem Menschen aus rabulistischen Modellen heraus nicht nur die Erweiterung von Möglichkeiten, sondern sogar das Existenzminimum verweigert, versucht nicht nur den Garanten seiner eigenen Freiheiten abzuschaffen, sondern vernichtet am Ende auch seine wertvollste Ressource – den Menschen.

Daniel-Pascal Zorn
»[Ich] möchte mich in diesem Beitrag vor allem auf den vermeintlichen Stammvater der neoklassischen Theorie konzentrieren und mir die Frage stellen, inwiefern sein ökonomietheoretischer Zugriff tatsächlich so zweckrational, utilitaristisch (und in der Konsequenz unmenschlich) ist, wie sie von seinen Epigonen und Kritikern dargestellt wird.«
Um den ethischen Grund ökonomischer Ratio aufzuweisen, möchte ich mich in diesem Beitrag vor allem auf den vermeintlichen Stammvater der neoklassischen Theorie konzentrieren und mir die Frage stellen, inwiefern sein ökonomietheoretischer Zugriff tatsächlich so zweckrational, utilitaristisch (und in der Konsequenz unmenschlich) ist, wie sie von seinen Epigonen und Kritikern dargestellt wird. Zu diesem Zweck lese ich die »Theory of Moral Sentiments« (1759) und die »Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations« (1776) nicht – wie in der Rezeption üblich – als einander widersprechende oder zueinander komplementäre Werke, sondern als zwei Schritte desselben Gedankens, der insbesondere in der »Inquiry« zu einer Universalisierung gelangt.
Hintergrund ist Smiths Auseinandersetzungen mit den Thesen der Physiokraten, einem von Richard Cantillon und systematisch vor allem von François Quesnay vertretenen sozioökonomischen Gesamtkonzept, das sich wiederum durch die sinophile Bewegung (Leibniz, Wolff, Voltaire, Pufendorf) und durch von ihr rezipierte neokonfuzianische Ideen inspirieren ließ. Für die Physiokraten rückte die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Arbeit in den Mittelpunkt des ökonomischen Geschehens: Wo der Mensch nur Güteraustausch betreiben kann, ist es die lebendige Natur, die den Mehrwert schafft, einfach dadurch, indem aus einem Korn eine ganze Ähre wird. Smith formuliert diesen Gedanken in der »Theory of Moral Sentiments« ganz ähnlich und erweitert ihn aber in seiner »Inquiry« so, dass das Aus-sich-heraus-Schaffen der Natur als universelles Prinzip auf den Menschen umgewendet wird.
Daraus ergibt sich der Aufbau meines Beitrags, ganz im Sinne der behaupteten Resonanz, die gerade keine Ableitung sein will: Einer (1) einleitenden Darstellung der physiokratischen Theorie und der argumentativen Rolle, die China bei Quesnay spielt, folgt (2) der erste (längere) Schritt zu Smith, in dem ich einen bisher eher unbeachteten Aspekt der ‚unsichtbaren Hand‘ in der »Theory« und die Bedeutung der menschlichen Arbeit für Smiths ökonomietheoretischen Entwurf in der »Inquiry« genauer in den Blick nehme. Vor diesem Hintergrund wende ich dann den Blick zurück nach China, mittels einer (3) Darstellung einiger konfuzianischer Ideen, wie sie einerseits für die Rezeption der Physiokraten wichtig werden, andererseits aber auch über diese Rezeption hinausweisen, in ein Verständnis von Ethik, das mit Smiths Denken korrespondiert. Dieser Darstellung folgt (4) ein abschließender (kürzerer) Schritt zu Smith, in dem ich auf sein Konzept der ‚humanity‘ eingehe. Spätestens hier soll dann deutlich werden, inwiefern Smith seine Moralphilosophie und Ökonomietheorie zwar vordergründig auf zweckrationalen Überlegungen aufbaut, diesen aber in beiden Fällen ethische Prinzipien zugrundelegt, die thematisch oft nur am Rande erscheinen, operativ aber den gesamten Entwurf regieren.
China und die Physiokraten
Als das eindringlichste Zeugnis für die Verbindung physiokratischer und chinesischer Ideen gilt Quesnays »Le Despotisme de la Chine« von 1767, in dem eine idealtypische Darstellung der chinesischen Gesellschaft zu einem Modell für das französische Königreich aufgebaut wird. Das Bemerkenswerte an dieser Darstellung ist, dass Quesnay sich in seinem Werk über den ‚ordre naturel‘ an keiner Stelle auf China bezieht, so dass der Bezug auf China nicht etwa genetische, sondern exemplarische Funktion besitzt. 4 Vgl. Jacobsen, Stefan G.: Physiocracy and the Chinese Model, in: Ma, Ying/Trautwein, Hans-Michael (Hg): Thoughts on Economic Development in China, New York 2013, S. 12-34: 30. Zugleich verweist diese exemplarische Funktion auf die offenbar explikative Kraft, die Quesnay und andere in der chinesischen Gesellschaftsordnung sahen.
Das Grundkonzept der Physiokraten lässt sich anhand der Überzeugung verdeutlichen, die einer ihrer frühesten Vertreter, Richard Cantillon, in seinem »Essai sur la nature du commerce en général« von 1730 bzw. 1755 (Erstpublikation in Frankreich) zum Ausdruck bringt: „La terre est la source ou la matière d’où l’on tire la richesse; le travail de l’homme est la forme qui la produit: et la richesse en elle-même n’est autre chose que la nourriture, les commodités et les agréments de la vie.“ 5 Cantillon, Richard: Essai sur la nature du commerce en général, Paris 1997, S. 1. – Im Folgenden zitiere ich Quesnay nicht mehr nach dem französischen Original, sondern nach der gebräuchlicheren englischen Übersetzung von Lewis A. Maverick. – Die Erde – einschließlich der Gewässer – produziert einen natürlichen Überfluss, den der Mensch nur für sich nutzbar machen muss und der damit selbst wertschöpfend tätig ist.
Die Arbeit des Menschen und die Schöpferkraft der Natur gehören auf natürliche Weise zusammen – aus dieser Idee entwickeln die Physiokraten das Konzept des ‚ordre naturel‘, der natürlichen Ordnung also, die zugleich als Beschreibung und als Imperativ menschlichen Handelns gelten soll: Wer sich der natürlichen Ordnung gemäß verhält, der erschafft eine gute Gesellschaft und sorgt für das Gemeinwohl. Der Grundgedanke von Quesnays »Observations sur le Droit naturel des hommes réunis en société« (1765) kann vor allem auf den zweiten Teil von Cantillons Bestimmung bezogen werden: seine Betonung, dass der Mensch ein natürliches Recht auf die Bedingungen dessen hat, was vorteilhaft für sein Leben ist. 6 Vgl. Quesnay, François: Observations sur le Droit naturel des hommes réunis en société, in: Journal de l’agriculture, du commerce & des finances 2 (1765), S. 4-35: 4. Quesnay erwähnt ausdrücklich die ‚jouissance‘, so dass ‚vorteilhaft‘ immer auch mit ‚vergnüglich‘ zusammenzulesen ist. Das bedeutet nicht nur das, was die amerikanische Verfassung ‚pursuit of happiness‘ nennen wird, sondern es schließt auch und in erster Linie das Recht des Menschen auf Lebensunterhalt ein. Ein Kind „a incontestablement un droit naturel à la subsistance“ – sterben seine Eltern, dann ist es „privé de l’usage de son droit naturel“. 7 Quesnay, Observations, S. 9. Von diesem fundamentalen Recht auf Selbsterhaltung folgt für Quesnay das Recht darauf, die von Gott verliehenen körperlichen und geistigen Gaben zum eigenen Vorteil zu gebrauchen; 8 Vgl. Quesnay, Observations, S. 14-22. schließlich diese Gaben dazu einzusetzen, sich gemeinsam ein positives Recht zu geben, das sie alle im Sinne ihres natürlichen Rechts begünstigt. 9 Vgl. Quesnay, Observations, S. 29-35.
»Indem der Mensch der Natur folgt, folgt er auch seiner eigenen Natur. Indem er für seine Kinder sorgt und für sich selbst, verwirklicht er nur die natürliche Ordnung, von der her er das Recht besitzt zu seiner Selbsterhaltung und Erweiterung seiner Möglichkeiten.«
Indem der Mensch der Natur folgt, folgt er auch seiner eigenen Natur. Indem er für seine Kinder sorgt und für sich selbst, verwirklicht er nur die natürliche Ordnung, von der her er das Recht besitzt zu seiner Selbsterhaltung und Erweiterung seiner Möglichkeiten. Mit Spinoza gesprochen: Der Mensch ist – wie die Natur – Sein-Können und je mehr er sein eigenes Sein-Können und das aller anderen fördert, desto mehr handelt er gemäß der natürlichen Ordnung, aus der er stammt und deren Ebenbild er in diesem reflexiven Aspekt des Sich-selbst-Hervorbringens ist. 10 Vgl. zu Spinoza Zorn, Daniel-Pascal: Vom Gebäude zum Gerüst. Entwurf einer Komparatistik reflexiver Figurationen, Berlin 2016, S. 437-446. Ökonomisch bindet Quesnay diesen Aspekt aber vor allem an die Landwirtschaft, insofern sie ja die Subsistenz nicht nur ihrer selbst, sondern aller Menschen sichert. Die aus dem einzelnen Korn herauswachsende Ähre versinnbildlicht geradezu den Überfluss, den die Natur aus sich selbst heraus produziert.
Diesen zentralen Aspekt der Landwirtschaft, der metonymisch für die Grundstruktur allen Lebens steht, als zugleich materielle und ethische Grundlage einer Gesellschaft sieht Quesnay nun in »Le Despotisme« vor allem in der chinesischen Gesellschaft verwirklicht. 11 Vgl. Jacobsen, Physiocracy, S. 18-19. Das Recht dieser Gesellschaft, für Quesnay maßgeblich begründet in den ethischen Lektionen des Konfuzius, fungiert entsprechend zugleich als ethische und politische, d. h. auf die materielle Selbsterhaltung des chinesischen Volkes gerichtete Ordnung: „The laws in China are all based upon the principles of ethics, for […] ethics and politics in China form a single science […]. All three [Religion, Regierung und Recht] are irrevocably dictated by the natural law […]. Thus, everything is permanent in the government of that empire, like the immutable general and fundamental law upon which it is established […].“ 12 Quesnay, François: Despotism in China, übers. v. Lewis A. Maverick, in: Maverick, Lewis A. (Hg.): China. A Model for Europe Bd. 2, San Antonio (TX) 1946, S. 139-318: 212, vgl. S. 189.
Der chinesische Herrscher repräsentiert zugleich das Prinzip dieser Ordnung und sichert es – deswegen ist der ‚despotisme‘ in China kein tyrannischer, sondern basiert auf „wise and irrevocable laws which the emperor enforces and which he carefully observes himself.“ 13 Quesnay, Despotism, S. 141-142, vgl. S. 183. Das chinesische Recht spiegelt so die natürliche Ordnung wieder, die unverkennbar die Züge des physiokratischen ‚ordre naturel‘ trägt: „Everyone of good will […] finds the means to subsist“ 14 Quesnay, Despotism, S. 171. , denn „[i]n China […] agriculture has always been held in veneration, and those who profess it have always merited the special attention of the emperors […].“ 15 Quesnay, Despotism, S. 206. Je mehr ein Land aus sich selbst heraus für sich selbst sorgt, desto größer ist sein eigener Reichtum und sind entsprechend auch Vorteile und Vergnügen des Lebens: „[T]he greatest opulence possible consists in the greatest consumption possible. This consumption has its source within the territory of every nation […].“ 16 Quesnay, Despotism, S. 208.
Aus seiner Beschreibung der chinesischen Agrarwirtschaft vor dem Hintergrund der physiokratischen Perspektive zieht Quesnay moralphilosophische Folgerungen. Zu diesem Zweck erweitert er das konfuzianische Konzept des ‚Himmels‘ (tian) als Grundprinzip moralischer Ordnung zu einem universellen Gesetz: „The aspect of heaven has always drawn the veneration of men heedful of the beauty and the sublimity of the natural order; it is there that the immutable laws of the creator are manifested the most clearly. But these laws should not be attributed simply to the one part of the universe, for they are the general laws of all of its parts.“ 17 Quesnay, Despotism, S. 178. Diese Erweiterung ermöglicht es Quesnay, die abstrakte transzendentale Figur des ‚Himmels‘ quasi vom Kopf auf die Füße zu stellen und die Reflexivität des Aus-sich-heraus-Schaffens in die ontologische Struktur des lebendigen Erdbodens zu übersetzen.
„Die natürlichen Gesetze sind die eigentlichen physikalischen Gesetze der fortwährenden Reproduktion der Güter, die für den Lebensunterhalt, die Erhaltung und das Wohlbefinden der Menschen notwendig sind.“ – François Quesnay
Die Kriterien sind, wie schon im »Essai«, immer noch: die stabile Selbsterhaltung und die Erhaltung der Ressourcen, die zu dieser Selbsterhaltung nötig sind. 18 Vgl. Quesnay, Despotism, S. 265: „These laws were established by the author of nature, for the continual reproduction and distribution of the goods that are necessary for men united into society and subjected to the order that these laws prescribe for them.“ Vgl. Jacobsen, Physiocracy, S. 24. Zwar kann sich aus diesem Grundprinzip der Selbsterhaltung auch natürliches und positives Recht ableiten; es selbst aber ergibt sich nicht aus einer Rechtssetzung, sondern aus dem Studium der natürlichen Ordnung, in die sich der Mensch immer schon hineingestellt sieht. 19 Vgl. Quesnay, Despotism, S. 270. Mit einem modernen Terminus ausgedrückt, formuliert Quesnay hier so etwas wie eine Ethik der Nachhaltigkeit, durchaus nicht nur ökologisch, sondern eben auch ethisch, nicht in erster Linie den Erhalt der Natur, sondern vor allem den Erhalt des Menschen betreffend – und von diesem her erst den Erhalt der Natur als seine Bedingung der Möglichkeit: „The natural laws are the very physical laws of the perpetual reproduction of the goods necessary for the subsistence, for the preservation and for the comfort of men. […] [They] fix the order of the operations of nature, and of the labor of men, who must cooperate with nature in the reproduction of the goods that they need. All this arrangement is physical constitution […].“ 20 Quesnay, Despotism, S. 274.
Dieses Grundprinzip der Nachhaltigkeit macht Quesnay schließlich in einem Bild deutlich, in dem die doppelte Abhängigkeit des Menschen von der Erhaltung seiner eigenen Existenz und der Erhaltung seiner Existenzgrundlage deutlich wird: „The gardener must remove the moss that injures the tree, but he must avoid cutting into the bark through which this tree receives the sap that makes it grow. If a positive law is necessary to prescribe this duty for the gardener, this law, dictated by nature, should not extend beyond he duty that nature prescribes. The constitution of the tree is the natural order itself […].“ 21 Quesnay, Despotism, S. 274-275.
Adam Smith und die physiokratische Ethik
Die »Theory of Moral Sentiments« von Adam Smith steht, 22 Smith, Adam: Theorie der ethischen Gefühle, übers. v. Walther Eckstein, Hamburg 1977. hinsichtlich ihrer Rezeption, deutlich im Schatten der »Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations«. 23 Smith, Adam: Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, übers. v. Horst Claus Recktenwald, München 112005. Das liegt auch daran, dass sie, im Gegensatz zu der eher zweckrational und objektiv ausgerichteten Perspektive der »Inquiry«, von einer vordergründig subjektiv-psychologischen Untersuchung ausgeht. Diese Perspektivendifferenz führte in der Rezeption zum ‚Adam-Smith-Problem‘, 24 Die Formulierung stammt von August Oncken in einem gleichnamigen Aufsatz von 1898; vgl. dazu und im Folgenden Graf Ballestrem, Karl: Adam Smith, München 2001, S. 195-198. also der Frage, ob das Verhältnis der beiden Hauptwerke eher unter einem integrativen Konzept von Sozialphilosophie oder doch eher unter dem Aspekt einer Umwendung weg vom gemeinschaftlichen hin zum Eigeninteresse zu interpretieren sei. 25 Insbesondere letztere Perspektive wurde entscheidend von Buckles History of Civilisation in England mitge- prägt, vgl. Ballestrem, Adam Smith, S. 196: „Ihm fällt auf […]: Der homo oeconomicus ist ein konsequenter Egoist, der stets seinen privaten Nutzen zu vergrößern sucht; der homo moralis ein geselliges Wesen, das den Mitmenschen durch Mitgefühl und Wohlwollen verbunden ist […].“
Im vorliegenden Aufsatz vertrete ich diesbezüglich die These, dass die »Theory« und die »Inquiry« durchaus einander ähnliche ethische Prinzipien versammeln, dass aber das Verhältnis sich in dieser Hinsicht als Erweiterung der Perspektive und nicht als Verengung derselben fassen lässt. 26 Ich folge diesbezüglich Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, übers. v. Ulrich Köppen, Frankfurt a. M. 1974, S. 274-278, 310. Smith veröffentlichte die »Theory« 1759 und überarbeitete sie bis zu seinem Tod 1790 mehrfach, ohne ihre Grundausrichtung wesentlich zu ändern. Auf einer Bildungsreise 1764 bis zum abrupten Abbruch der Reise 1766 kam er in Kontakt mit Quesnay und Turgot und begann, an der »Inquiry« zu schreiben, die er schließlich 1776 veröffentlichte.
In der »Theory« gibt Smith ein sehr differenziertes Bild des Menschen. Hinter der moralphilosophischen Abhandlung verbirgt sich oft eine klug beobachtete psychologische Studie, die auch mit Ironie nicht sparsam umgeht. 27 Smith macht selbst deutlich, dass es ihm um eine Studie de facto und nicht de jure geht, vgl. Smith, Theorie, S. 113. Dennoch spielt im Hintergrund stets ein normatives Moment mit, auf das der vorliegende Aufsatz aufmerksam machen will. Im ersten Kapitel des vierten Teils der »Theory« etwa erscheint das mit Smith oft verbundene, aber in der »Inquiry« in einem gänzlich anderen Kontext stehende, 28 Vgl. Smith, Wohlstand, S. 369-371. In der »Inquiry« erscheint das Konzept nicht – wie oft kolportiert – im Zusammenhang der eigennützig handelnden Teilnehmer am Binnenmarkt einer Nation als eine Art seltsamer ‚Eingriff von oben‘, sondern, ganz pragmatisch, in der Diskussion des Verhältnisses von Zwischenhandel, Außenhandel und Binnenhandel. Vorausgesetzt ist, dass der größte Nutzen einer Investition stets darin liegt, in der „nächsten Umgebung“ und entsprechend in das „einheimische Gewerbe“ (369) zu investieren – was in Smiths Zeitalter der hohen Handelszölle auch Sinn macht. Weitere Voraussetzungen für die ‚unsichtbare Hand‘ in der »Inquiry« sind die bessere Kontrollierbarkeit des investierten Kapitals, persönliche Bekanntschaft mit den Handelspartnern und Vertrautheit mit den geltenden Gesetzen – kurz: niedrigere Risiken bei (fast) gleichbleibend hohen Gewinnen: „Bei […] nahezu gleichen Gewinnen neigt demnach der einzelne ganz von selbst dazu, sein Kapital so einzusetzen, daß es der einheimischen Wirtschaft die größten Dienste zu leisten vermag […].“ (370) Ist diese Voraussetzung wiederum gegeben, dann folgt daraus, dass „jeder, der sein Kapital zur Unterstützung der eigenen Volkswirtschaft investiert, notwendigerweise bestrebt sein [wird], die wirtschaftliche Aktivität so zu lenken, daß ihr Ertrag den größtmöglichen Wert erzielen kann.“ (Ebd.) So wird die Förderung des eigenen Kapitalertrags zur Förderung des Gemeinwohls: „Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewußt das Allgemeinwohl […]. [E]r wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat.“ (371) – Es ist klar, dass im Zeitalter der globalen Märkte Smiths Voraussetzungen hinfällig sind. Konzept der ‚unsichtbaren Hand‘ in einem ironischen Beispiel, das zugleich ganz im Geiste physiokratischer Überlegungen abgefasst ist: „Es ist vergebens“, so Smith, „daß der stolze und gefühllose Grundherr seinen Blick über die ausgedehnten Felder schweifen läßt und ohne einen Gedanken an die Bedürfnisse seiner Brüder in seiner Phantasie die ganze Ernte, die auf diesen Feldern wächst, selbst verzehrt. […] Das Fassungsvermögen seines Magens steht in keinem Verhältnis zu der maßlosen Größe seiner Begierden, ja sein Magen wird nicht mehr aufnehmen können als der des geringsten Bauern.“ 29 Smith, Theorie, S. 316. Die Begierde des Grundherrn täuscht ihn ebenso wie die Begierde der Bauern, die seinen Reichtum bewundern, sie zur Arbeit anhält; 30 Vgl. Smith, Theorie, S. 315. er bleibt ein normaler Mensch, selbst wenn seine Vorstellungskraft ihm etwas anderes vorgaukelt.
Die Menschen, die für ihn seinen Reichtum erarbeiten, „beziehen […] von seinem Luxus und seiner Launenhaftigkeit ihren Teil an lebensnotwendigen Gütern, den sie sonst vergebens von seiner Menschlichkeit oder von seiner Gerechtigkeit erwartet hätten.“ 31 Smith, Theorie, S. 316. Hier gilt es, den Bezug auf ‚Menschlichkeit‘ (humanity) und ‚Gerechtigkeit‘ (justice) im Kopf zu behalten. Obwohl die Reichen, so Smith weiter, als einzigen Zweck „die Befriedigung ihrer eigenen eitlen und unersättlichen Begierden“ verfolgen, werden sie „[v]on einer unsichtbaren Hand […] dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustandegekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre; und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen […] das Interesse der Gesellschaft und gewähren die Mittel zur Vermehrung der Gattung.“ 32 Smith, Theorie, S. 316-317. Es ist, so Smith, die Schöpfungskraft der Natur und die natürliche Begrenztheit des Menschen, die den Überfluss ermöglicht, so dass auch diejenigen, die keine Grundherren sind, „ihren Teil von allem, was die Erde hervorbringt“ 33 Smith, Theorie, S. 317. genießen können.
Das ist die ‚unsichtbare Hand‘ – und sie scheint eine zynische Denkfigur zu sein, wenn sie in dem, was vom Tisch der Reichen abfällt, eine Funktion der Selbsterhaltung des Bauern sehen wollte, der es angebaut und geerntet hat. In der Tat handelt es sich hier weniger um ein ethisches als um ein karikierendes Argument, wie der fortlaufende Bezug auf die Selbsttäuschung der Reichen zeigt. Das eigentliche Argument verbirgt sich an einer anderen Stelle, gleich nach diesem etwas zynischen Beispiel vom gierigen Gutsherrn.
Smith macht zunächst deutlich, dass die Förderung des Gemeinwohls nichts mit der moralisch im Zentrum stehenden ‚Sympathie‘ zu tun haben muss: „Es hat Menschen gegeben, die vom höchsten Gemeingeist beseelt waren, und die sich doch in anderer Beziehung den Gefühlen der Menschlichkeit nicht sehr zugänglich gezeigt haben. Und umgekehrt hat es Menschen gegeben, die von der edelsten Menschenfreundlichkeit erfüllt waren, und die doch […] gänzlich jedes Gemeingeistes bar waren.“ 34 Smith, Theorie, S. 318. Die Ironie dieser Passagen ist bemerkenswert, entwertet sie reflexiv doch glatt das Argument der ‚Sympathie‘, das Smith als psychologische Grundlage moralischen Urteilens gibt. Das Argument der ‚Sympathie‘, stellt Smith klar, funktioniert bei den eigentlichen Machthabern überhaupt nicht – es ist sinnlos ihnen „zu erzählen, daß sie im allgemeinen gegen Sonne und Regen geschützt, und daß sie selten hungrig sind […]. Eine noch so beredte Ermahnung dieser Art wird auf [sie] […] wenig Eindruck machen.“ 35 Smith, Theorie, S. 318-319.
»Damit erkennt Smith, in einer Ideologiekritik avant la lettre, die phantasmagorische Form der Dinge, ihren Warencharakter, in dem sich zu jeder Zeit das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst widerspiegelt.«
Stattdessen, so Smith, muss man ihnen „die Bequemlichkeit und die Anordnung der verschiedenen Appartements [in einem Palast, D.P.Z.] beschreiben“; 36 Smith, Theorie, S. 319. man muss also in ihrer Vorstellungswelt denken und ihre Begierden antizipieren, um eine Veränderung herbeizuführen, die dem Gemeinwohl dient. Natürlich ist all das, wovon man so spricht – die Paläste und Appartements – „nur bestimmt, Sonne und Regen abzuhalten, und ihre Besitzer gegen Hunger und Kälte, gegen Mangel und Ermüdung zu schützen.“ 37 Ebd. Denn „[w]enn wir die wirkliche Befriedigung, die alle diese Dinge zu gewähren imstande sind, an und für sich […] in Betracht ziehen, […] so wird sie uns immer im höchsten Grade verächtlich und geringfügig erscheinen.“ 38 Smith, Theorie, S. 315. Damit erkennt Smith, in einer Ideologiekritik avant la lettre, die „phantasmagorische Form“ der Dinge, ihren Warencharakter, in dem sich zu jeder Zeit „das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst“ 39 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band Buch I. Der Produktionsprozeß des Kapitals (MEW 23), Berlin 171988, S. 86. widerspiegelt.
Welchen Schluss zieht er aus dieser Erkenntnis? Smith macht ein paar Abschnitte vorher auf eine ästhetische Empfindung aufmerksam, darauf, dass „die […] Liebe zum geordneten Ganzen, die […] Rücksicht auf die Schönheit der Ordnung, der Kunst und wohl ersonnener Pläne […] sehr viel dazu bei[trägt], uns jene Einrichtungen zu empfehlen, die […] die allgemeine Wohlfahrt […] befördern.“ 40 Smith, Theorie, S. 317. In diesem Vergnügen am Funktionierenden, am Einbringen von Ordnung in Unordnung liegt ein Moment der Lust: „Es macht uns Vergnügen, die Vervollkommnung eines […] schönen und großartigen Systems zu betrachten […].“ Der leitende Antrieb dieser Lust ist nicht etwa der Wille zur Förderung der Glückseligkeit des Mitmenschen, sondern ein „gewisse[r] Systemgeist und ein[e] gewiss[e] Liebe zur Kunst und zu Erfindungen überhaupt“. 41 Smith, Theorie, S. 318. Und so formuliert Smith die Aufgabe desjenigen, der sich anschickt, den Machthaber von etwas zu überzeugen, das seinen ‚Systemgeist‘ anregt, aber jenseits des ideologischen Verblendungszusammenhangs zugleich das Gemeinwohl befördert: „Ihr werdet […] viel eher imstande sein, ihn zu überzeugen, wenn ihr ihm das große System der öffentlichen Verwaltung beschreibt, welches diese günstigen Lebensbedingungen zuwege bringt, wenn ihr ihm die Zusammenhänge […] und ihre allgemeine Eignung, die Glückseligkeit der Menschen zu befördern, auseinandersetzt, wenn ihr ihm zeigt, […] wie alle die einzelnen Räder der Regierungsmaschine dahin gebracht werden könnten, daß sie mit größerer Harmonie und Reibungslosigkeit laufen […]. Es ist kaum möglich, daß ein Mensch einen solchen Vortrag anhören sollte, ohne dadurch einen gewissen Gemeingeist in sich erweckt zu fühlen.“ 42 Smith, Theorie, S. 319-320. Und in aller Deutlichkeit fügt Smith hinzu: „Nichts wirkt so sehr dahin, den Gemeingeist zu befördern, als das Studium der […] verschiedenen Systeme der […] Regierung, der Verfassung unseres eigenen Landes, […] seines Handels […]. Aus diesem Grunde sind politische Untersuchungen, wenn ihre Vorschläge richtig, vernünftig und ausführbar sind, die nützlichsten [!] von allen Betätigungen spekulativen Nachdenkens.“ 43 Smith, Theorie, S. 320.
Die ‚unsichtbare Hand‘ – sie besteht in dieser Form politischer Manipulation: Dem Machthaber in einem idealtypischen Entwurf den Eindruck umfassender und vor allem umfassend wohltätiger Kontrolle zu geben, seine Begierde nach Anerkennung durch seine Untertanen und nach der Mehrung seines Prestiges zu nähren, um auf diesem Umweg seines Eigennutzes das Gemeinwohl zu befördern. Damit steht Smith viel eher in der Tradition von Machiavellis »Il Principe« und Brunos »De vinculis« als in der klassischer englischer Moralphilosophie – und legt 1776 mit der »Inquiry« einen ebensolchen umfassenden Entwurf vor. 44 Smith hat den wesentlichen Grundriss der »Inquiry« bereits in einer seiner Glasgower Vorlesung von 1763 vorgetragen, also noch vor seiner Frankreichreise, vgl. die Einleitung von Walther Eckstein in Smith, Theorie, S. XI-LXXXI: XIX-XX.
Dieser Entwurf vollzieht nun im Hinblick auf die Ethik des Aus-sich-heraus-Schaffens der Physiokraten, die diese an die Natur und die landwirtschaftliche Arbeit geknüpft hatten, eine bemerkenswerte Wendung. Das Konzept des Aus-sich-heraus-Schaffens bleibt erhalten – aber Smith macht mit Quesnays Überlegung ernst, dass „these laws should not be attributed simply to the one part of the universe, for they are the general laws of all of its parts“ 45 Quesnay, Despotism, S. 178 : Er knüpft die reflexive Wertschöpfung nicht mehr an die Natur, sondern an den Menschen und seine Arbeitskraft. Damit verändert sich das gesamte konzeptuelle Gefüge: „Mit einem Schlag stellen die Reichtümer die innere Ordnung ihrer Äquivalenzen nicht mehr durch einen Vergleich der auszutauschenden Gegenstände […] her“, sondern „sie werden nach den Arbeitseinheiten zerlegt, durch die sie wirklich hergestellt worden sind.“ Was die Reichtümer „schließlich repräsentieren, ist nicht mehr der Gegenstand des Verlangens, sondern die Arbeit.“ 46 Foucault, Ordnung der Dinge, S. 275-276.
Bei Quesnay ist nur die Natur produktiv – Handel und Handwerk „[verzehren] gerade so viel Wert […] wie sie hervorbringen.“ 47 Immler, Hans: Natur in der ökonomischen Theorie. Wiesbaden 1985, S. 335. Aus physiokratischer Sicht bestimmen „die Produktionskosten […] eines Produkts seinen Wert“ 48 Immler, Natur, S. 334. , aber gerade das führt dazu, dass die herstellende menschliche Arbeit im Grunde nur bereits bestehenden Wert von einer in eine andere Gestalt umwandelt: „[D]er Tauschwert dieser Waren [besteht] aus nichts anderem […] als aus eben dem Wert des Rohmaterials und der Subsistenzmittel, welche der Arbeitsmann während des Arbeitsprozesses verbraucht hat […].“ 49 Quesnay, François: Über die Arbeiten der Handwerker, zit. nach Immler, Natur, S. 335. In gleicher Weise verteilen Händler nur bestehenden Wert, indem sie für Lagerung und Transport wiederum Wert erhalten. Der bestehende Wert kann sich also durchaus auf verschiedenen Ebenen verteilen – aus sich heraus Wert erschaffen können diese Umwandlungs- und Umverteilungstätigkeiten aber nicht.
Smith stellt dem zunächst sein quantitativ argumentierendes Modell der Arbeitsteilung gegenüber: Wenn durch die bloße industrielle Organisation der Arbeitsschritte die Produktion von 20 Stecknadeln pro Arbeiter und Tag auf bis zu 4800 Stecknadeln pro Arbeiter und Tag erhöht werden kann, macht es keinen Sinn, den Wert an die bloß umgewandelte Materie zu knüpfen: „Die Produktivkraft der Arbeit ist [durch Arbeitsteilung] vervielfacht worden; in der gleichen Einheit […] hat sich die Zahl der geschaffenen Gegenstände erhöht. […] Die Arbeit hat in Beziehung zu den Dingen nicht abgenommen. Die Dinge haben sich in Beziehung zur Arbeitseinheit gewissermaßen zusammengezogen.“ 50 Foucault, Ordnung der Dinge, S. 277. Der Wert liegt nicht in dieser Materie, sondern er liegt in der Zeit, in der ein Arbeiter seine Arbeitskraft für die Produktion eingesetzt hat, derjenigen Arbeitszeit, die zugleich, für diesen Arbeiter, dessen Lebenszeit ist. 51 Smith entdeckt damit, so Foucault, „eine irreduzible, unüberschreitbare und absolute Maßeinheit“, vgl. ders., Ordnung der Dinge, S. 275. Wer Wertschöpfung betreiben will, der muss die Arbeitskraft des Arbeiters nach allen Mitteln befördern. Denn die von ihr geleistete Arbeit – und darin liegt die Pointe von Smiths Universalisierung des physiokratischen Prinzips – sorgt zugleich für ihre Selbsterhaltung ebenso, wie für ihre Selbststeigerung: „Die jährliche Arbeit eines Volkes ist die Quelle, aus der es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird […].“ 52 Smith, Wohlstand, S. 3. Es ist also richtig, dass Smith im vielzitierten ersten Buch der »Inquiry« die „Ursachen [der] […] Verbesserung in den produktiven Kräften der Arbeit“ 53 Ebd. schildert. Diese Schilderung ist oft auf ihren bloß quantitativen Aspekt der Arbeitsteilung reduziert worden. Doch wie bereits angedeutet wurde, bedeutet der Fokus auf die Arbeitskraft nicht nur die Steigerung ihrer quantitativen Effizienz. 54 Im Gegenteil sieht Smith die Reduktion auf diese quantitative Steigerung der Arbeitsleistung äußerst kritisch, wie er im ersten Kapitel des Fünften Buches (Zu den Finanzen des Staates) deutlich macht. Entsprechend führt ihn die Kritik des quantitativen Reduktionismus zu der Forderung, in Schule und Bildung zu investieren, vgl. Smith, Wohlstand, S. 662-662, 664-668.
Smith beginnt mit dem physiokratischen Selbstversorger als Modell: Dieser sorgt ausschließlich für seinen Selbstunterhalt und kümmert sich nicht um die anderen. Ab einem bestimmten Punkt aber produziert er mehr, als er für seinen Selbstunterhalt braucht und beginnt damit, die „natürlich[e] Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen“ 55 Smith, Wohlstand, S. 16. zu entwickeln: „Sobald nun der Mensch sicher sein kann, daß er alle Dinge, die er weit über den Eigenbedarf hinaus durch eigene Arbeit herzustellen vermag, wiederum gegen überschüssige Produkte anderer […] eintauschen kann, fühlt er sich ermutigt, sich auf eine bestimmte Tätigkeit zu spezialisieren.“ 56 Smith, Wohlstand, S. 18. Die Arbeitsteilung entsteht also aus dem natürlichen Überfluss, den die eigene Arbeitskraft über das Lebensnotwendige hinaus zu leisten imstande ist. Diese zwei Schritte sind zentral und gehören zusammen: „Ein Mensch ist arm oder reich, je nachdem in welchem Ausmaß er sich die zum Leben notwendigen und annehmlichen Dinge leisten und die Vergnügungen des Daseins genießen kann.“ Übersteigt dieses Ausmaß seine eigene Selbsterhaltung, dann ist er „arm oder reich, je nach der Menge Arbeit, über die er verfügen oder deren Kauf er sich leisten kann.“ Der Überfluss ist gewissermaßen ein Rest Arbeitskraft, gespeichert in den durch sie geschaffenen Produkten – und so „ist der Wert einer Ware für seinen Besitzer […] gleich der Menge Arbeit, die ihm ermöglicht, sie zu kaufen oder darüber zu verfügen. Arbeit ist demnach das wahre oder tatsächliche Maß für den Tauschwert aller Güter.“ 57 Smith, Wohlstand, S. 28.

Adam Smith
Adam Smith wurde 1723 in der schottischen Hafenstadt Kirkcaldy geboren und starb 1790 in der Hauptstadt Edinburgh. Er lehrte Logik und Moralphilosophie in Glasgow und hielt seine Vorlesungen auch in englischer Sprache ab, nicht nur in lateinischer. Über den Inhalt seiner Vorlesungen ist heute kaum mehr etwas bekannt, da sie nur über Mitschriften von Studenten rekonstruierbar sind. Später legte er seine Professur nieder und begab sich auf Bildungsreisen. Er pflegte eine Freundschaft mit François Quesnay und rezensierte u.a. den »Diskurs über die Ungleichheit« von Jean-Jacques Rousseau.
Die Pointe dieser Darstellung liegt nicht etwa in dem Versuch, einen idealtypischen Tauschmarkt als Ursprungserzählung einzuführen. Sie liegt, gegenüber der physiokratischen Argumentation, in dem Schritt, den ökonomischen Tausch als Logistik des Überflusses aus der Produktion der eigenen Arbeitskraft und nicht mehr aus der Produktion der natürlichen Schöpfungskraft zu etablieren. Entsprechend wird der Bezug hier reflexiv, nimmt der Genitiv einen doppelten Sinn an: Nicht mehr nur das, was die eigene Arbeitskraft über das für die Selbsterhaltung Notwendige hinaus produziert, unterliegt dieser Logistik, sondern auch noch die Arbeitskraft selbst, insofern sie anderen zur Verfügung gestellt werden kann. Weil aber die Arbeitskraft selbst das ist, was Wert schöpft und weil die Ökonomie als Logistik des Überflusses ihrer Schöpfung angelegt ist, gewinnt sie den Status einer Bedingung der Möglichkeit von Wertschöpfung.
»Kann der Arbeiter sein Existenzminimum nicht sichern, dann schwindet seine Arbeitskraft und damit auch in letzter Konsequenz der Reichtum, den sie produziert und der allen zugutekommt. Der Reichtum der Nationen, dessen Natur und Ursachen Smith untersuchen will, liegt nicht in dem durch Geld ausgedrückten Wert. Er liegt in der Arbeitskraft, in den Menschen selbst.«
Was daraus folgt, macht Smith im Folgenden sehr deutlich: „Der Mensch ist darauf angewiesen, von seiner Arbeit zu leben und sein Lohn muß mindestens [!] so hoch sein, daß er davon existieren kann. Meistens muß er sogar noch höher sein, da es dem Arbeiter sonst nicht möglich wäre, eine Familie zu gründen […].“ 58 Smith, Wohlstand, S. 59. Das bedeutet, führt Smith weiter aus, „daß, wenn eine ganze Familie davon leben soll, ein Ehepaar auch der untersten Schicht in der Lage sein muß, mit seiner Arbeit mehr zu verdienen, als es selbst zum Unterhalt benötigt […].“ Vgl. auch S. 69. Der Grund dafür liegt auf der Hand und er ergibt sich für Smith aus einer einfachen Überlegung: Kann der Arbeiter sein Existenzminimum nicht sichern, dann schwindet seine Arbeitskraft und damit auch in letzter Konsequenz der Reichtum, den sie produziert und der allen zugutekommt. Der Reichtum der Nationen, dessen Natur und Ursachen Smith untersuchen will, liegt nicht in dem durch Geld ausgedrückten Wert. Er liegt in der Arbeitskraft, in den Menschen selbst: „Nicht in den Gegenständen liegt der Reichtum, sondern in uns, die sie produziert haben und ihren Gebrauchswert genießen.“ 59 Schällibaum, Urs: Macht und Möglichkeit. Konzeptionen von Sein-Können im Ausgang von Hölderlin und Novalis, Wien 2013, S. 169-173: 171. Es ist entsprechend, so Smith, „nicht mehr als recht und billig, wenn diejenigen, die alle ernähren, kleiden und mit Wohnung versorgen, soviel vom Ertrag der eigenen Arbeit bekommen sollen, daß sie sich selbst richtig ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen können.“ 60 Smith, Wohlstand, S. 68.
Für den Unternehmer bedeutet das entsprechend, dass mindestens der Erhalt, darüber hinaus aber möglichst auch die – personen- und generationenbezogene – Erweiterung der Arbeitskraft zunächst ein Imperativ der ökonomischen Vernunft ist – denn wer seinem eigenen Gewinn nicht schaden will, der zerstört auch nicht die Bedingung der Möglichkeit dieses Gewinns: „Würden die Unternehmer stets die Gesetze der Vernunft und der Menschlichkeit [humanity] beachten, müßten sie oftmals den Einsatz ihrer Arbeiter eher mäßigen als animieren.“ 61 Smith, Wohlstand, S. 71. Wer nicht auf die Gesundheit seiner Arbeiter achtet, riskiert Berufskrankheiten und damit den längerfristigen Ausfall von Arbeitskraft. Wer aber beachtet, „daß, wer so maßvoll arbeitet, daß er es regelmäßig tun kann, […] nicht nur seine Gesundheit am längsten bewahrt, sondern auch im Laufe des Jahres am meisten arbeitet“ 62 Smith, Wohlstand, S. 72. , der sorgt aus Eigeninteresse stets auch für den Anderen und seine Bedürfnisse. Der Unternehmer, der Produktionsausfall wegen der Erholung seiner Arbeiter oder hohe Lohnkosten beklagt, versteht also nicht, dass er die Bedingungen der Möglichkeit seines eigenen Gewinns beklagt: „Eine großzügige Entlohnung ist also auf der einen Seite die Folge des zunehmenden Wohlstandes, auf der anderen ist sie wiederum die Bedingung für eine wachsende Bevölkerung. Über hohe Löhne klagen, heißt daher nichts anderes, als über die notwendige Folge und Ursache [!] höchster Prosperität des Landes jammern.“ 63 Smith, Wohlstand, S. 70. – Vgl. auch S. 71: „Reichlicher Unterhalt erhöht den körperlichen Einsatz des Arbeiters. Er wird sich bis zum äußersten anstrengen, wenn er wirklich hoffen kann, daß sich seine Lage verbessert und er im Alter sorgenfrei, vielleicht sogar gut leben kann.“
Die Ursache des Wohlstandes der Nationen – sie liegt auch ganz konkret in nichts anderem als dem Erhalt und der Erweiterung dieses Wohlstandes in Gestalt der Arbeitskraft der Menschen. Wer darüber klagt, hat nicht verstanden, wie Wirtschaft als Zusammenschluss von Ei- geninteresse und Gemeinwohl funktioniert. Inwiefern diese ökonomische Erwägung zugleich eine ethische ist, die mit dem gerade gefallenen Begriff ‚humanity‘ zu tun hat, darauf werde ich weiter unten noch einmal eingehen.
Die Ethik des Konfuzianismus
Im ersten Teil dieses Aufsatzes wurde deutlich gemacht, dass Quesnay vor allem die Betonung der Landwirtschaft in der von ihm rezipierten Idealversion des chinesischen Reiches nutzt, um seine eigenen physiokratischen Thesen zu untermauern. 64 Vgl. Jacobsen, Physiocracy, S. 18. Zugleich findet bei ihm aber auch ein Übersetzungsprozess von konfuzianischen Theoremen in das physiokratische Schema statt. Das bemerkt auch Mirabeau in seiner Grabrede für Quesnay, wenn er zur Verbindung von ‚Himmel‘ (tian) und menschlicher Natur und zur Betonung der Vernunft im Konfuzianismus hinzufügt: „[D]as Wesentliche blieb noch zu tun; sie auf der Erde zu befestigen; und dies war das Werk unseres Meisters [i. e. Quesnay, D.P.Z.], der von unserer gemeinsamen Mutter Natur das Geheimnis des ‚Reinertrags‘ erlauschte.“ 65 Zit. nach Louven, Erhard: Wirtschaftsreformen nach ausländischen Vorbildern. Die Physiokraten in Frankreich und die Pragmatiker in der VR China, in: Woll, Artur u. a. (Hgg.): Nationale Entwicklung und Internationale Zusammenarbeit. Herausforderung ökonomischer Forschung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Willy Kraus, Berlin u. a. 1983, S. 99-109: 100.
Nun bezieht sich Quesnay natürlich nicht direkt auf Konfuzius, sondern vielmehr auf eine breitere Chinarezeption, in der konfuzianische Texte, neokonfuzianische und daoistische Lehren und Reiseberichte ein idealisiertes Bild von China zeichnen. Trotzdem lassen sich einige grundlegende konfuzianische Gedanken identifizieren, die sich durchaus mit dem von der Stoa herstammenden reflexiven Schöpfungsdenken der Physiokraten vergleichen lassen. Das muss dann gerade nicht heißen, dass Quesnay – und mit ihm Smith – vom Konfuzianismus direkt beeinflusst sind. Aber es kann heißen, dass Quesnay – und mit ihm Smith, gerade in seiner Erweiterung des Gedankens von der Natur auf den Menschen – sich gerade deswegen auf China berufen kann, weil er dort wesentliche Aspekte seines eigenen Gedankens wiederfindet.
Bereits Maverick 66 Vgl. Maverick, China, S. 111. Mengzi war zu Quesnays Zeit durch mehrere Veröffentlichungen bekannt, vgl. S. 64. weist darauf hin, dass viele Passagen aus dem Werk des Konfuzianers Mengzi (370-290 v. Chr.) der physiokratischen Lehre in vielen Punkten ähneln: der Auszeichnung der Landwirtschaft, den Anweisungen zum Aufbau einer guten und funktionierenden Gesellschaft 67 Vgl. Quesnay, Despotism, S. 189. und der Betonung der Erziehung 68 Vgl. Quesnay, Despotism, S. 194. als Grundlage für die Einrichtung und Erhaltung einer an die menschliche Natur 69 Vgl. Roetz, Heiner: Der konfuzianische Humanismus und sein Ursprung aus dem Geist der Traditionskritik, in: Ders./Henningsen, Lena (Hgg.): Menschenbilder in China, Wiesbaden 2009, S. 59-60. – Diese menschliche Natur basiert auf einer – Smiths »Theory of Moral Sentiments« verblüffend ähnelnden – moralischen Psychologie, die allerdings mit einem entscheidenden Imperativ verbunden wird, vgl. Mengzi zit. nach Roetz, Heiner: Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des Durchbruchs zu postkonventionellem Denken, Frankfurt a. M. 1992, S. 322-323: „Das Gefühl des Mitleids ist Ausgangspunkt der Menschlichkeit. Das Gefühl der Scham und des Abscheus ist der Ausgangspunkt der Gerechtigkeit. Das Gefühl der Höflichkeit […] der Etikette. Und das Gefühl von richtig und falsch […] der Ausgangspunkt des Wissens. […] Im Allgemeinen gilt, daß jeder, der diese vier Ausgangspunkte in sich hat, sie auch alle zu erweitern und zur Fülle zu bringen weiß, genau so wie ein gerade angezündetes Feuer oder eine gerade angebohrte Quelle [Hervorh. v. mir, D.P.Z.].“ In allen diesen Gefühlen – Mitleid, Scham, Etikette, Gefühl von richtig und falsch – liegen zwei wesentliche Momente: Erstens der Bezug auf das eigene Handeln, das den Menschen von den Tieren unterscheidet (vgl. Roetz, Ethik, S. 340 Anm. 27); zweitens aber der Bezug – in diesem ersten Bezug – auf alle anderen Menschen. geknüpften Ordnung.
Wirft man einen Blick in das Buch »Mengzi«, offenbart sich allerdings eine praktische Vernunft, die sich vor allem auf die Momente der Selbsterhaltung und Erweiterung bzw. Verbesserung der eigenen Möglichkeiten bezieht. Das betrifft sowohl die Selbsterhaltung und -verbesserung der Möglichkeiten des einzelnen Bauern als auch – im Gewähren, Erhalten und Garantieren dieser Selbsterhaltung und -verbesserung – die Selbsterhaltung des Souveräns: „If the seasons of husbandry [Landwirtschaft] are not interfered with, there will be more grain than can be eaten; if close-mesh nets are not permitted in the rivers and lakes, there will be more fish and turtles than can be eaten; if axes enter the hills and forests only in season and under rules, there will be more wood than can be used […].“ Wenn dieser Überfluss nicht durch Profitgier 70 Vgl. Maverick, China, S. 65. gestört wird, „the people will be able to feed the living and to bury the dead without feeling a grudge against anyone.“ 71 Ebd. Der Souverän ist der Adressat: Wenn jedem Hof der Anbau einer bestimmten Fläche mit Maulbeerbäumen (auf denen Seidenraupen leben) gestattet ist und in den natürlichen Ablauf der bäuerlichen Fleischproduktion nicht eingegriffen wird,„[w]hen men of seventy wear silk and eat meat, and the black-haired [die Jüngeren, D.P.Z] suffer neither from hunger nor cold, their lord will not fail to become king.“ 72 Maverick, China, S. 66.
Die Botschaft ist deutlich: Derjenige Herrscher, der für das Gemeinwohl sorgt, indem er jedem Bauern nicht nur dessen Auskommen sichert, sondern ihm auch die Freiheit gewährt, seine eigenen Möglichkeiten zu steigern, nützt nicht nur seinen Untertanen, sondern am Ende auch sich selbst: „The way of the people is this: If they have a secure living, they have stable hearts. If they have not a secure living they have not stable hearts.“ 73 Maverick, China, S. 68. Wer sich seines eigenen Lebens erfreuen kann, wird diese Freude auch mit anderen und am Ende – im übertragenen Sinn – auch mit dem Herrscher teilen: „Lead the people on the way which will secure their ease, and they will not grumble at hard work.“ 74 Maverick, China, S. 77. Entsprechend wird auch bereits von Mengzi der Handel als Austausch des Überflusses und in eins damit das Konzept der Arbeitsteilung eingeführt: „[…] if you do not exchange products and services, making use in this way of what is over to supply what is wanting, the husbandman will be left with spare grain and the weaving woman will have spare cloth. By exchanging products, carpenters and cartwrights get food.“ 75 Maverick, China, S. 74, vgl. S. 72.
Die Nützlichkeit, die diesen Überlegungen zugrundeliegt, ist kein Utilitarismus – sie ergibt sich aus der Annahme wechselseitiger Abhängigkeit auf der Grundlage einer Natur des Menschen 76 Vgl. Mengzi zit. nach Roetz, Ethik, S. 343: „Wenn man sein Wesen bejaht, dann kann man damit Gutes tun. Dies meine ich, wenn ich sage, (die Natur ist) gut.“ Die Betonung liegt auf „kann man … tun“: Das Wesen des Menschen ist, dass er anderes wollen kann, vgl. Roetz, Ethik, S. 335: „Mengzi sagt nicht etwa, das Gute sei das Begehrte […], sondern spricht von dem Guten als dem, was […] man ‚wollen kann‘ […].“ Diese Betonung der Möglichkeit ist der Bestimmung des ‚Guten‘ nicht etwa äußerlich – sie ist das ‚Gute‘ selbst: dass man wollen – anders wollen – kann, als man es bisher getan hat. Dieses Können, als Wesen des Menschen, die Grundlage seiner moralischen Natur, verbindet Mengzis Ethik mit derjenigen Spinozas und noch Kants. , die zu unterschreiten 77 Vgl. Roetz, Ethik, S. 320 zur Möglichkeit des ‚Bösen‘: „Mengzi verweist wiederholt auf die miserablen Lebensumstände, die das Volk der Existenzgrundlage berauben, ohne die es keine ‚feste Gesinnung‘ haben kann […]. So ist also die unmenschliche Politik als eine Quelle des Bösen identifiziert.“ Dieser Schwäche des Herrschers entspricht die Schwäche des Einzelnen: „Zu den Umweltbedingungen tritt […] eine innere Anfälligkeit des Menschen hinzu. Sie besteht in seiner Verleitbarkeit durch sinnliche, materielle Begierden […].“ am Ende allen Beteiligten schadet: „Mengzis moralische Anthropologie richtet sich an jeden Menschen, doch ist sie vor allem ein Mittel, die Mächtigen unter Druck zu setzen. Sie sind als Mitglieder der Gattung Mensch zur Humanität befähigt […] Mengzi begründet damit zunächst eine Verpflichtung der Entscheidungsträger, sich wie Menschen zu benehmen. Sie würden andernfalls aber nicht nur gegen ihre eigene Natur verstoßen, sondern auch gegen die Natur der von ihrem Handeln Betroffenen.“ 78 Roetz, Humanismus, S. 59. Es geht – anders als in utilitaristischen Überlegungen westlicher Philosophie – keineswegs darum, die ‚Lust‘ einer ‚größtmöglichen Menge‘ von Menschen zu erhöhen und die ‚Unlust‘ zu verringern. Sondern es geht darum, allen Menschen – und zwar per Postulat – das Wesen oder die Natur (die essentia) zuzusprechen, aus sich selbst heraus nicht nur sich selbst versorgen zu können, sondern über diese Selbstversorgung hinaus einen Mehrwert zu produzieren – der den Handel antreibt, der diejenigen satt macht, die aus bestimmten Gründen nicht für sich sorgen können, und der am Ende nicht nur den Wohlstand des Reiches, sondern auch sein Wachstum sichert.

Konfuzius
Konfuzius wurde vermutlich 551 v. Chr. in der ostchinesischen Stadt Qufu geboren und starb vermutlich 479 v. Chr. ebendort. Sein Name leitet sich aus dem chinesischen Kǒng Zǐ (Meister Kong) ab. Die Familie Kǒng besteht bis heute und dürfte damit eine der ältesten nachgewiesenen Familien der Welt sein. Von Konfuzius selbst sind keine Schriften überliefert. Seine Lehren wurden erst ca. 100 Jahre später von Anhängern derselben niedergeschrieben
»Diese Form der reflexiven Gerechtigkeit – der Gleichberechtigung aller Menschen, ihrem eigenen Wesen folgen zu dürfen und es zum Wohle aller zu entfalten – findet auch bei dem Konfuzianer Xunzi einen entscheidenden Ausdruck.«
Diese Form der reflexiven Gerechtigkeit – der Gleichberechtigung aller Menschen, ihrem eigenen Wesen folgen zu dürfen und es zum Wohle aller zu entfalten – findet auch bei dem Konfuzianer Xunzi (289-220 v. Chr.) einen entscheidenden Ausdruck. Anders als Mengzi bezweifelt Xunzi eine dem Menschen angeborene Natur und betrachtet, darin Konfuzius näher, die menschliche Ethik als kulturelle Schöpfung, die eine von Grund auf ‚schlechte‘ Natur korrigiert und in richtige Bahnen lenkt. 79 Vgl. Roetz, Ethik, S. 344-346, 351. Entsprechend wichtig ist für Xunzi eine (möglicherweise legalistisch inspirierte) Betonung der gerechten Ordnung als Ausgangspunkt der vernünftigen Staatsführung: „Für Xunzi ist ein direktes Ergebnis gerechter Staatsführung der ‚gemeinsame Nutzen‘ tong lì bzw. der ‚Mitnutzen‘ jian lì […].“ 80 Roetz, Ethik, S. 188. Anders als bei Mengzi ergibt sich die Etikette nicht aus einer Erinnerung an das, was dem Menschen immer schon mitgegeben ist – sie ist Ergebnis eines Kulturbildungsprozesses, einer Selbsterhebung aus den Niederungen natürlicher Triebe hin zur vernünftigen Lebensführung. 81 Vgl. Roetz, Ethik, S. 360.
Doch auch für diese vernünftige Lebensführung geht es keineswegs nur um die Rechtfertigung des Status quo der chinesischen Ständegesellschaft. Vielmehr verbindet Xunzi „in einer raffinierten dialektischen Gesellschaftstheorie […] die konventionelle Lesart der Gerechtigkeit mit der allgemeinen Gerechtigkeitsidee im Sinne des öffentlichen Wohls bzw. des ‚gemeinsamen Nutzens‘ aller. […] Es geht vor allem darum, einen geordneten Zugang zu den begrenzten Ressourcen sicherzustellen.“ Auch Xunzi fundiert das Gemeinwohl also auf einer genuin ethischen Idee – hier: ‚Gerechtigkeit‘ statt moralischer Psychologie –, argumentiert aber zugleich, dass eine gerechte Herrschaft die Selbsterhaltung der Einzelnen und die Erhaltung und Erweiterung der Gesellschaft im Ganzen ermöglicht.
Im Hintergrund steht hier die jeweilige Möglichkeit des Einzelnen, sich selbst erhalten. Wichtig ist aber: Es geht um die Gleichheit hinsichtlich dieser Möglichkeit, um die Gleichberechtigung der Menschen also, nicht um ihre Gleichheit: „Die raison d’être der gerechten Ordnung liegt […] nicht darin, einige wenige auf Kosten der anderen zu privilegieren, sondern umgekehrt darin, allen ihren je unterschiedlichen Anteil zu sichern.“ 82 Ebd. Die Gerechtigkeit ist nicht dem Nutzen entgegengesetzt oder korrigiert ihn; vielmehr geht es darum, wie Konfuzius im »Daxue« sagt, „die Gerechtigkeit yi als Nutzen lì‘ anzusehen […] [Hervorh. v. mir, D.P.Z.].“ 83 Roetz, Ethik, S. 190. Ebenso wie Mengzi, der die Möglichkeit an das Können knüpft – das Wollenkönnen, Sicherhaltenkönnen, Andere Mit-Erhalten-Können –, bindet Xunzi die Gerechtigkeit an die Gleichberechtigung des Einzelnen, die eigenen Möglichkeiten ausschöpfen zu können und die Verpflichtung, diese umgekehrt nicht zu beschneiden: „Die soziale Differenz soll den Streit verhindern, der alle miteinander ins Elend stürzen würde, und dient zugleich als Anreiz, etwas zu leisten.“ 84 Roetz, Ethik, S. 188. Vgl. Smith, Theorie, S. 315. Die Ungleichheit der sozialen Differenz und die Forderung der Gleichberechtigung aller hinsichtlich ihrer Möglichkeiten ist kein Widerspruch, sondern vielmehr Konsequenz einer reflexiven Ethik: „Alle haben das gleiche Recht, in gleicher Weise ihre (gemäß ihrer Natur ungleichen) Möglichkeiten in ungleicher Weise zu entfalten. Und alle haben in gleicher Weise die Pflicht, mit ihren je eigenen Möglichkeiten allen in gleicher Weise ihre eigenen Möglichkeiten entfalten zu helfen.“ 85 Schällibaum, Macht, S. 170.
Im Hintergrund dieser durchwegs reziproken – von der eigenen Möglichkeit-zu-… auf diejenige aller anderen schließende und von diesen her Verpflichtungen rückschließende – Denkfigur, die sich zugleich immer wieder auf das Argument der größeren Nützlichkeit stützt, steht das Konzept der ‚goldenen Regel‘ als Kern der konfuzianischen Ethik. Im »Lunyu« formuliert Konfuzius sie wie folgt: „Was man selber nicht wünscht, das tue man anderen nicht an.“ 86 Roetz, Ethik, S. 221. Diese goldene Regel, die als „typisches Erkennungszeichen der antiken Aufklärungskulturen“ 87 Roetz, Ethik. S. 219. gelten kann, hat es in sich. Aufgeschlüsselt besteht sie aus einem komplexen reflexiven Schlussverhältnis: Der Bezug auf etwas und der Bezug auf diesen Bezug, z. B. als ‚Handlung‘ – der Bezug auf das, was man für das eigene Sich-Beziehen-Können wünscht und auf die Konsequenz einer Handlung, die dieses Erwünschte einschränkt oder verunmöglicht – der Bezug auf andere, die mir selber gleich sind und die sich von da her in bestimmten Hinsichten das Gleiche wünschen: die Projektion also meines komplexen dreifachen Bezug-Zusammenhangs von Handlung, Handlungsreflexion und Handlungsabgleich auf Andere – der Schluss daraus, dass man selbst an der Stelle des Anderen das eigene Handeln als Einschränkung des Wünschenswerten sehen würde – schließlich der Schluss daraus, dass das eigene Handeln bezüglich dieser Konsequenz eingeschränkt werden soll. Kurz: ‚Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu’ bzw. ‚Behandle andere stets so, wie Du selbst behandelt werden möchtest‘.
Die Pointe dieser Regel besteht in ihrer Mehrdeutigkeit, die immer mal wieder als ‚Formalismus‘ missverstanden wird. Versteht man die Regel allzu subjektivistisch und bindet sie an einen platt inhaltlich verstandenen ‚guten Willen‘ oder eben ein subjektives ‚Wünschenswertes‘, verliert sie ihre reflexive Pointe. Sie wird dann zu einem Projektionsargument, in dem man sich selbst als Betroffenen der eigenen Handlung simuliert und diese von dieser Simulation aus bewertet. So scheint das Kriterium am Ende in einem subjektiv ‚Wünschenswerten‘ zu liegen – was in der Diskussion dieser Regel zur Wahrnehmung von allerlei Aporien (Sadisten als Anwender der Regel, infinite Regresse und Zirkelschlüsse usw.) führt.
Die Pointe der ‚goldenen Regel‘ liegt allerdings gerade nicht darin, von dem auszugehen, was man hedonistisch für ‚wünschenswert‘ hält, sondern von dem, was wünschenswert ist, insofern es Bedingung der Möglichkeit des eigenen Lebens-, Seins- oder Handlungsvollzugs ist. Damit wird das Kriterium transzendental: Es betrifft nicht mehr diese oder jene subjektive Einstellung des Menschen, sondern das, was das Haben von solchen Einstellungen und das freie Sich-dazu-Verhalten noch möglich macht. Die Formulierung des Konfuzius – ‚Was man selber nicht wünscht, das tue man anderen nicht an‘ – und die im Westen bekannte Formulierung – ‚Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu‘ – ist, ohne diese reflexive Pointe, wie Kant richtig feststellt, „trivial“, weil es „nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst [enthält] […].“ 88 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Ders.: Kritik der praktischen Vernunft, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M. 1974, S. 62 (BA 69 Anm.).

Immanuel Kant
Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg geboren und starb 1804 ebendort. Er lehrte Logik und Metaphysik an der Universität Königsberg und war wenige Jahre auch dessen Rektor. In späteren Jahren häuften sich Konflikte mit der preußischen Zensurbehörde. Kant verbrachte sein ganzes Leben in Königsberg und starb fast 80-jährig. Anders als oft behauptet wird, führte er kein steifes Professorenleben. Zeitgenossen beschreiben ihn als überaus gewitzten und geselligen Zeitgenossen, der Wert auf ein galantes Äußeres legte und viele Freundschaften pflegte.
»Dieser reflexive Doppelbezug – auf die eigenen Bedingungen von Möglichkeiten, die zugleich diejenigen aller anderen sind – ist entscheidend, um die transzendentale Auslegung der ‚goldenen Regel‘ zu verstehen.«
Versteht man die ‚goldene Regel‘ aber transzendental, dann betrifft die Bedingung der Möglichkeit als Kriterium einen selbst nicht mehr hinsichtlich der jeweils bestimmten Manifestation subjektiver Auslegung, sondern hinsichtlich dessen, was einen immer schon dazu befähigt hat, sich auf dieses oder jenes beziehen, dieses oder jenes tun, diese oder jene Möglichkeiten verwirklichen zu können. Dieses Können betrifft den Menschen insofern er Mensch ist. Es kann nicht ohne Selbstwiderspruch verneint werden, weil genau diese Verneinung das Können in Anspruch genommen haben wird – und es kann auch nicht an anderen Menschen verneint werden, weil jeder Bezug auf diesen oder jenen Menschen sich auf ihn als bestimmten bezieht, also auf einen, der eben so-und-so sein kann. Dieser reflexive Doppelbezug – auf die eigenen Bedingungen von Möglichkeiten, die zugleich diejenigen aller anderen sind – ist entscheidend, um die transzendentale Auslegung der ‚goldenen Regel‘ zu verstehen.
Sofern ich mich also in der goldenen Regel auf eine Bedingung der Möglichkeit jedes Bezuges (jeder Handlung, jeder Verwirklichung) meiner selbst beziehe, beziehe ich mich zugleich – in diesem Bezug – auf die Bedingung der Möglichkeit jedes Bezugs (jeder Handlung, jeder Verwirklichung) jedes anderen Menschen. Diese Menschen können in jeder anderen Hinsicht vollkommen verschieden von mir sein, aber in dieser einen Hinsicht nicht: dass sie es sein können. Entsprechend ergibt sich die ‚Verpflichtung‘ der goldenen Regel nicht aus einem Zirkelschluss, sondern aus einem zu vermeidenden Selbstwiderspruch: Wenn ich die Bedingungen der Möglichkeit eines Anderen – die in dieser Annahme derselben zugleich die Bedingungen der Möglichkeit meiner selbst sind –, einschränke, widerspreche ich mir selbst. Ich kann Freiheit oder Toleranz als Postulate nur in Anspruch nehmen, weil ich mit ihnen etwas in Anspruch nehme, was ich – in dieser Inanspruchnahme – für alle anderen bestätige. Wenn ich sie in Anspruch nehme, um dem Anderen seine Freiheit oder Toleranz abzusprechen, widerspreche ich mir selbst. Ich bestätige ihm das Recht auf dieselbe Bedingung der Möglichkeit, dieselbe Freiheit, dieselbe Toleranz – und spreche sie ihm in derselben Bewegung ab. Und deswegen kann ich vor mir selbst nicht mehr vernünftigerweise die Inanspruchnahme einer Handlungsmaxime rechtfertigen, die dem Anderen hinsichtlich dessen, was er mit mir a priori teilt – dieses Sein-Können als Mensch – eben dieses Sein-Können zugleich und in derselben Hinsicht zu- und abspricht.
Wie aber kommt man von dieser ethischen Maxime zu einer Nützlichkeitserwägung? – Der idealtypische Gegner transzendental-ethischer Argumentationen ist der zweckrationale Nutzenmaximierer, der sich um performative Widersprüche und ähnliche dialektische Logeleien nicht schert: ‚Was geht mich die Vernunft an? Ich will meinen Nutzen maximieren.‘ Diesen Nutzenmaximierer interessiert der performative Widerspruch nicht, denn, so argumentiert er, Menschen würden sich ja andauernd widersprechen und kämen trotzdem irgendwo an und überhaupt sei dieses vernunftlogische Argument in der Theorie ja ganz schön, tauge aber nichts in der Praxis.
Der Schritt von der transzendental-ethischen zur transzendental-utilitären Regel geschieht entsprechend dadurch, dass man den auftretenden Widerspruch, also den verpflichtenden Aspekt der ‚goldenen Regel‘, in seiner konsequentialistischen Repetition, als konkrete Folge des eigenen Handelns, betrachtet. Ausgangspunkt ist wieder der Mensch als einer, der irgendwie sein kann, hier: als einer, der Nutzen maximiert und als einer, der für andere nützlich ist. Die goldene Regel ‚Was man selber nicht wünscht, das tue man anderen nicht an‘ kann nun wie folgt ausgelegt werden: Der Nutzenmaximierer wünscht die Maximierung seines Nutzens. Andere Menschen sind nützlich für ihn, weil sie bestimmte Dinge können und weil sie auf eine bestimmte Weise sein können – ein Hammer kann nur hämmern, ein Schraubenzieher vor allem Schrauben drehen, aber ein Mensch kann einen Hammer oder einen Schraubenzieher bedienen, einen Balken tragen und zuschneiden, ein Haus bauen oder eine Maschine zusammenbauen usw. Der Mensch kann – und deswegen ist er für den Nutzenmaximierer nützlich. Aber der Mensch kann nur dann, wenn dieses Können nicht dadurch eingeschränkt ist, dass er sich z. B. nicht am Leben halten kann. Ein toter Mensch ist nutzlos; ein hungernder und schwacher Mensch ist viel weniger nützlich als einer, der satt und zufrieden ist; ein glücklicher Mensch, der sich selbst und darüber hinaus noch eine Familie am Leben erhalten kann, der seine eigenen Möglichkeiten – und seien sie noch so gering – zumindest nicht eingeschränkt sieht und der sie erweitern kann, ein solcher Arbeiter ist dem Nutzenmaximierer am nützlichsten.
Warum also soll der Nutzenmaximierer etwas ‚anderen nicht antun‘, also: anderen Menschen die Möglichkeiten, die sie haben, beschneiden oder vernichten? Weil das dem, was der Nutzenmaximierer wünscht, diametral widerspricht. In diesem erweiterten, den Widerspruch potenzierenden Verständnis lautete die goldene Regel dann etwa so: ‚Tue anderen das nicht an, was zu dem führt, was man selber nicht wünscht‘ oder kürzer, wenngleich elliptisch: ‚Tue anderen nicht an, was man selber nicht wünscht‘. – In beiden Formulierungen der ‚goldenen Regel‘ – ‚Was man selber nicht wünscht, tue anderen nicht an‘ als transzendental-ethische Regel, wie sie oben verstanden wurde und ‚Tue anderen nicht an, was man selber nicht wünscht‘ als transzendental-utilitäre Regel für den Nutzenmaximierer – muss die Begründung ergänzt werden: ‚…weil das, was man Anderen antut und das, was man für sich selber wünscht, sich widerspricht.‘
»Wer Bedingungen der Möglichkeit in Anspruch nimmt, die zugleich diejenigen aller anderen sind, um diesen Anderen dieselben abzusprechen, widerspricht sich selbst.«
In der transzendental-ethischen Perspektive bedeutet das: Wer Bedingungen der Möglichkeit in Anspruch nimmt, die zugleich diejenigen aller anderen sind, um diesen Anderen dieselben abzusprechen, widerspricht sich selbst. Und in der transzendental-utilitären Perspektive bedeutet es: Wer die Möglichkeiten anderer in Anspruch nehmen will, um die eigenen Möglichkeiten zu mehren und wer zugleich anderen eben diese Möglichkeiten (oder ihre Bedingungen) abspricht, verweigert oder verunmöglicht, der widerspricht sich selbst. Wer die Inanspruchnahme von Möglichkeiten allen anderen in der Inanspruchnahme dieser Möglichkeiten zuspricht und sie ihnen zugleich abspricht, widerspricht sich. Und wer die Inanspruchnahme von Möglichkeiten anderer für sich nutzbar machen will und sie ihnen zugleich verunmöglicht, der widerspricht sich ebenfalls. Der reflexive Doppelbezug, in dem der Bezug auf sich hinsichtlich dessen, dass man Mensch ist, zugleich der Bezug auf alle anderen Menschen ist, ermöglicht noch die Wiederholung der ‚goldenen Regel‘ selbst: bezüglich der Inanspruchnahme von (Bedingungen von) Möglichkeiten auf der reflexiven – das ‚Dass‘ betreffenden – und bezüglich der Inanspruchnahme von (Bedingungen von) Möglichkeiten auf der gegenständlichen bzw. thematischen – das ‚Was‘, die anderen Menschen betreffenden – Ebene. Auch wenn die chinesische Philosophie stets ethische Erwägungen gegen bloßes Profit- und Nutzenstreben abgegrenzt hat und letzterem oft sehr polemisch gegenüberstand, kann man vielleicht diesen Doppelsinn der ‚goldenen Regel‘ in einer, auf den zweiten Blick äußerst tiefsinnigen, Bemerkung von Konfuzius erahnen: „Ein Edler hört auf das Argument der Gerechtigkeit, ein Gemeiner auf das des Nutzens.‘ (»Lunyu« 4.16).“ 89 Roetz, Ethik, S. 189-190.
Smith und die Menschlichkeit
Die Konzepte der ‚goldenen Regel‘, der ‚Gerechtigkeit‘ und der ‚Harmonie‘ mit der natürli- chen Ordnung des Menschen sind in der chinesischen Philosophie mit dem Konzept der ‚Menschlichkeit‘ (ren) verbunden. Auch wenn sie bei Konfuzius, Mengzi und Xunzi unterschiedlich verstanden wird, bleibt die Betonung der asymmetrischen Wechselseitigkeit, der gegenseitigen Erweiterung von Möglichkeiten und die vernunftgemäße Erhaltung einer solchen Ordnung der wesentliche Zug dieser ‚Menschlichkeit‘. 90 Vgl. Roetz, Ethik, S. 195-241: 240.
Weiter oben wurde deutlich gemacht, dass Smith schon aus systematischen Gründen (und aus Gründen der Abgrenzung von der physiokratischen Lehre) durch die Übertragung der Schöpferkraft auf die Arbeit bei der ‚goldenen Regel‘ im transzendental-utilitären Sinne ankommt: Wer als Unternehmer den eigenen Gewinn steigern und den Nutzen maximieren will, der muss nicht nur dafür sorgen, dass die Arbeitskraft seines Arbeiters erhalten bleibt, sondern dass er sie auch selbst erhalten und – im Sinne einer Familie und im Sinne von Freizeitgestaltung – erweitern kann. Smith hat selbst in der »Theory« darauf hingewiesen, dass moralische Erwägungen und Gemeinwohl auseinanderfallen und dass eine Ethik des Letzteren nur über die Imaginationskraft des über die entsprechenden Mittel verfügenden Herrschenden funktioniert: Wer den Eigennutzen des Herrschers adressiert, bewegt ihn dazu, über diese Illusion, vor allem für sich selbst etwas zu tun, gleichwohl dem Gemeinwohl zu nutzen.
»Es kommt darauf an, in der Thematisierung dessen, was der Eigenliebe zuträglich ist, zugleich das mit zu adressieren, was durch die Verfolgung des der Eigenliebe Zuträglichen zugleich dem Gemeinwohl nützt.«
Diese Version der ‚unsichtbaren Hand‘ – die Smith für das eigene Werk, die »Inquiry«, auch operativ in Anspruch zu nehmen scheint – taucht nun an einer berühmten Stelle wieder auf: Wer Hilfe von anderen Menschen benötigt, „[kann] kaum erwarten […], dass er sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, daß es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht.“ 91 Smith, Wohlstand, S. 17. Was in der Rezeption meistens als Beweis für Smiths zweckrationale Gesinnung genommen wird, gewinnt vor dem Hintergrund der oben dargestellten Argumentation aus dem ersten Kapitel des vierten Teils der »Theory« eine andere Bedeutung: Das Adressieren des Eigennutzes ist nicht der Ursprung des Gemeinwohls, das sich gleichsam automatisch einstellen würde; es ist vielmehr der notwendige Umweg, den die Argumentation nehmen muss, um genau den Effekt zu erreichen, der zum Gemeinwohl führt. Ebenso wie der Hilfesuchende in Smiths berühmtem Beispiel nicht das Wohlwollen, sondern das Eigeninteresse „des Metzgers, Brauers und Bäckers“ 92 Ebd. anspricht und ebenso wie der, der den Herrschenden zu einer Investition in das Gemeinwohl überzeugen will, dessen Eigeninteresse und ‚Systemgeist‘ anspricht, spricht Smith – nun auf der operativen Ebene, im Vollzug seines eigenen Arguments – in der »Inquiry« das Eigeninteresse des Herrschenden an, indem er an dessen ‚Systemgeist‘ appelliert. Das Argument, das Smith selbst vollzieht, wiederholt sich auf der thematischen Ebene – und so muss die strategische Ebene in Smiths Darstellung betont werden: „Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, daß es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht.“ Der Passus „in ihrem eigenen Interesse“ ist hier der zentrale Punkt: Es kommt darauf an, in der Thematisierung dessen, was der Eigenliebe zuträglich ist, zugleich das mit zu adressieren, was durch die Verfolgung des der Eigenliebe Zuträglichen zugleich dem Gemeinwohl nützt. Genau so funktionieren aber Smiths Argumente für den Unternehmer bezüglich der Arbeitskraft: Wo der Unternehmer, aus seinem Eigeninteresse heraus, nur Argumente erkennen kann, die die Maximierung seines Nutzens betreffen, sind die Konsequenzen seiner Handlungen zugleich im ethischen Sinne gut. Denn sie sorgen dafür, dass alle „in gleicher Weise ihre (gemäß ihrer Natur ungleichen) Möglichkeiten in ungleicher Weise […] entfalten“ können – und verpflichten zugleich den Unternehmer darauf, „mit [seinen] […] je eigenen Möglichkeiten allen in gleicher Weise ihre eigenen Möglichkeiten entfalten zu helfen.“ 93 Schällibaum, Macht, S. 170.
Liegt also in dem transzendental-utilitären Argument Smiths, das auf der Erhaltung und der Erweiterung der Arbeitskraft beruht, zugleich ein transzendental-ethisches verborgen? Wendet Smith die ‚goldene Regel‘, die die (Bedingungen der) Möglichkeiten auf der thematischen Ebene betrifft, zurück auf die ‚goldene Regel‘, die die (Bedingungen der) Möglichkeiten auf der reflexiven Ebene betrifft?
Weiter oben wurde bereits ein Abschnitt zitiert, in dem Smith auf die ‚humanity‘ zu sprechen kommt und sie direkt mit der sonst durchwegs utilitär begründeten unternehmerischen Vernunft verbindet: „Würden die Unternehmer stets die Gesetze der Vernunft und der Menschlichkeit [humanity] beachten, müßten sie oftmals den Einsatz ihrer Arbeiter eher mäßigen als animieren.“ 94 Smith, Wohlstand, S. 71. Vor dem Hintergrund seines ‚social engineering‘-Arguments muss diese Bezugnahme aufhorchen lassen: Hier wird das auf Gemeinwohl zielende, aber das Eigeninteresse adressierende, Argument in die doppelte Hinsicht „die Gesetze der Vernunft und der Menschlichkeit“ betreffend gestellt. Dass die „Gesetze der Vernunft“ die transzendental-utilitäre Ebene betreffen, ist klar – worauf aber beziehen sich die „Gesetze der Menschlichkeit“?
Verfolgt man Smiths Begriffsgebrauch von ‚humanity‘ in der »Inquiry« weiter, dann taucht der Begriff überall dort auf, wo es um solche Entscheidungen seitens des Unternehmers oder des Herrschenden geht: Ein Lohn, „der beträchtlich über [der] […] Höhe des Existenzminimums liegt“, der liegt „über dem offensichtlich niedrigsten Satz, der eben noch mit unserer Vorstellung von Humanität [humanity] vereinbar ist.“ 95 Smith, Wohlstand, S. 60. Die Formel „[was] sich mit unserer Vorstellungen über Menschlichkeit [humanity] […] noch vereinbaren läßt“, kommt in diesem Zusammenhang noch zwei Mal vor. 96 Smith, Wohlstand, S. 62, 64. Wo es einige Kapitel weiter, im Kontext der Diskussion um Außenhandelszölle und Freihandelszonen, um den heimischen Arbeitsmarkt geht, bemerkt Smith: „Aus humanitären Gründen mag es eher angebracht sein, die Handelsfreiheit nur schrittweise […] wieder einzuführen. Denn eine schlagartige Aufhebung der hohen Zölle […] könnte zu einer so raschen Überflutung des Inlandsmarktes durch gleiche, aber billigere Auslandswaren führen, daß sich von heute auf morgen tausende unserer Landsleute ihres Arbeitsplatzes und damit ihres Lebensunterhaltes beraubt sähen.“ 97 Smith, Wohlstand, S. 383.
Explizit verbunden werden die beiden Hinsichten der ethischen und der utilitären Begründung aber dort, wo Smith mit der Gründung einer Kolonie quasi eine In-Vitro-Studie seines idealen Gesellschaftsentwurfes reflektiert. Denn dort findet der Verantwortliche ja kein historisch gewachsenes Gesellschaftsmodell vor, in das er intervenieren müsste, sondern kann den Entwurf einer Gesellschaft sozusagen am Reißbrett planen: „Was […] zur Bevölkerungsvermehrung und zur Bodenkultur beiträgt, fördert zugleich die Entwicklung zu wirklichem Reichtum und wirklicher Größe“ 98 Smith, Wohlstand, S. 474. – und so „[zwingt] [i]n neuen Kolonien […] schon das Eigeninteresse beide [oberen] Stände, die Unterschicht großzügiger und menschlicher zu behandeln […].“ 99 Ebd. – Die Einschränkung „…zumindest dort, wo diese nicht mehr im Stand der Sklaverei lebt“ wird von Smith einige Seiten später mit genau demselben Argument etwas entschärft, vgl. Smith, Wohlstand, S. 493: „[E]ine freundliche Behandlung führt letztlich dazu, daß der Sklave nicht nur anhänglicher, sondern auch umsichtiger und folglich in doppelter Hinsicht nützlicher wird.“ Das kann – vor dem Hintergrund der hier gegebenen Darstellung – durchaus mit einem ironischen Haken gelesen werden: Wenn schon die Berufung auf das, was „sich mit unseren Vorstellungen über Menschlichkeit […] vereinbaren lässt“, nicht ausreicht, um die Unterschicht großzügiger und menschlicher zu behandeln, dann zwingt schon das Eigeninteresse dazu, es zu tun. „Ein Edler hört auf das Argument der Gerechtigkeit, ein Gemeiner auf das des Nutzens.“ 100 Roetz, Ethik, S. 189-190.
In der »Theory« knüpft Smith die ‚humanity‘ enger an die ‚Sympathie‘ bzw. ‚sympathy‘: „Menschlichkeit besteht nur in dem äußerst feinen Mitgefühl, welches der Zuschauer gegenüber den Empfindungen der zunächst Betroffenen hegt […] Ihr Wesen [der Handlungen, die von größter Menschlichkeit getragen sind, D.P.Z.] liegt nur darin, daß wir das tun, was dieses äußerst feine Sympathiegefühl uns von selbst zu tun antreiben würde.“ 101 Smith, Theorie, S. 327. Vgl. S. 1-9 zur Charakterisierung der ‚Sympathie‘. Statt dem transzendental-ethischen Verständnis der ‚goldenen Regel‘ scheint es also auf der ‚Rückseite‘ des transzendental-utilitären Arguments von Smith nur die ‚triviale‘ Auslegung zu geben: „[D]aß wir erst dann, wenn wir mit dem Leidenden in der Phantasie den Platz tauschen, dazu gelangen, seine Gefühle nachzuempfinden […].“ 102 Smith, Theorie, S. 3. Auch das Konzept des ‚unbeteiligten Zuschauers‘ scheint das zu bestätigen: „Wir stellen uns selbst als die Zuschauer unseres eigenen Verhaltens vor und trachten nun, uns auszudenken, welche Wirkung es in diesem Lichte auf uns machen würde.“ 103 Smith, Theorie, S. 170.
»Das letzte Kriterium des ‚unbeteiligten Zuschauers‘ ist nicht das moralische Gefühl, das sich einstellt, wenn ich mich in den anderen ‚einfühle‘. Es ist die Vernunft, die uns befähigt „auch die entfernteren Folgen aller unserer Handlungen zu erkennen und die Vorteile oder Schäden vorauszusehen, die vermutlich aus ihnen entstehen werden […].“«
Doch der Eindruck täuscht. Das letzte Kriterium des ‚unbeteiligten Zuschauers‘ ist nicht das moralische Gefühl, das sich einstellt, wenn ich mich in den anderen ‚einfühle‘. Es ist die Vernunft, die uns befähigt „auch die entfernteren Folgen aller unserer Handlungen zu erkennen und die Vorteile oder Schäden vorauszusehen, die vermutlich aus ihnen entstehen werden […].“ 104 Smith, Theorie, S. 323. Sie stellt uns zurück in die Gemeinschaft mit allen anderen, denn sie „ist es, [die] […] uns, so oft wir im Begriffe stehen, so zu handeln, daß wir die Glückseligkeit anderer in Mitleidenschaft ziehen, […] zuruft, daß wir nur einer aus der Menge sind und in keiner Hinsicht besser als irgendein anderer dieser Menge. […] [N]ur durch das Auge dieses unparteiischen Zuschauers können die natürlichen Täuschungen der Selbstliebe richtiggestellt werden.“ 105 Smith, Theorie, S. 203. – Auch die Vernunft stellt Smith noch einmal in eine Verbindung mit der Lust, die mit der oben zitierten Stelle zur Manipulation des Herrschers korrespondiert, vgl. noch einmal Smith, Theorie, S. 318: „Es macht uns Vergnügen, die Vervollkommnung eines […] schönen und großartigen Systems zu betrachten“ und S. 203: „Es ist eine stärkere Liebe […] die in solchen Fällen [der Vernunft] im allgemeinen eingreift: die Liebe zu allem, was ehrenwert und edel ist, das Verlangen nach Größe, Würde und Erhabenheit unseres Charakters.“ Wer von vornherein davon ausgeht, – mit Orwell gesprochen – ‚gleicher‘ als alle anderen zu sein, der wird durch seine Vernunft daran erinnert, dass ihm diese Einsicht nur dadurch ermöglicht wird, dass er von vornherein einer unter anderen ist; dass er, bevor er sich selbst als verschieden von anderen versteht, sich als einen verstehen muss, der sich selbst in Bezug auf alle anderen verstehen kann. Der „Vergleich zwischen unseren eigenen Interessen und denen anderer Menschen“ 106 Smith, Theorie, S. 200. , den der ‚unbeteiligte Zuschauer‘, die Vernunft, ermöglicht, basiert stets auf der Voraussetzung, dass Menschen Interessen haben.
Diese Überlegungen spielen freilich in Smiths »Theory« nur am Rande eine Rolle – und doch zeigen sie an, dass neben dem deskriptiven moralpsychologischen Ausgangspunkt auch ein starkes reflexives Prinzip am Werk ist. Es zeigt sich in der sich selbst begehrenden 107 Vgl. Smith, Theorie, S. 203. Vernunft ebenso, wie in dem teilweise zur Reziprozität erstarrten Konzept der ‚Gerechtigkeit’,dem Verlangen nach „Selbsterhaltung und Fortpflanzung“ oder dem „Verlangen nach beständiger Fortdauer der Art und [der] […] Abneigung gegen den Gedanken ihres völligen Erlöschens.“ 108 Smith, Theorie, S. 113-114. Diese „‚Lieblingszwecke‘ der Natur“ 109 Smith, Theorie, S. 113. geben so den Hintergrund für ein Argument ab, das zumindest im Ansatz eine ethische Interpretation der transzendental-utilitären Auslegung der ‚goldenen Regel‘ entwickelt. So wie Smith die physiokratische Schöpferkraft der Natur auf die menschliche Arbeitskraft umgewendet hat, so fehlt zu einem transzendental-ethischen Argument nur eine Umdrehung, die in der (hier biologischen) ‚Selbsterhaltung‘ vor allen auch die Selbsterhaltung und -erweiterung der eigenen reflexiven Möglichkeiten sieht. Mithin macht also Smiths »Theory of Moral Sentiments« – in ihrer Berufung auf die egalitäre reflexive Vernunft wie auf das ‚social engineering‘ der utilitären unternehmerischen Vernunft – den entscheidenden Schritt zur Überwindung der psychologischen Moraltheorie, die sie zunächst sein will. Dieser Schritt führt hin zu einer transzendentalen Ethik, wie sie sich vor Smith bei Spinoza und nach ihm bei Kant entfaltet und er verweist auf einen doppelten ethisch-utilitären Sinn der ‚goldenen Regel‘, der es ermöglichen kann, nicht Wirtschaftsethik, sondern Wirtschaft als Ethik zu denken.
Kapitalismus als Postulat. Adam Smith und der Konfuzianismus, in: Schweidler, Walter (Hg.): Transcending Boundaries. Practical Philosophy from Intercultural Perspectives, Sankt Augustin 2015, S. 179-202
 Lesezeit 66 Minuten
Lesezeit 66 Minuten




François Quesnay
François Quesnay wurde 1694 in Versailles geboren und starb 1774 ebenfalls dort. Er war ein französischer Arzt und Ökonom. Als Arzt sprach er sich gegen die damals weit verbreitete Routine des Aderlasses zur Behandlung von Krankheiten aus. Als Ökonom entwickelte er ein Modell vom wirtschaftlichen Kreislauf und dessen Gesetzmäßigkeiten, das Tableau économique. Er wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der physiokratischen Schule der Ökonomie. Wegen seiner Bewunderung für Konfuzius wird Quesnay außerdem als „Konfuzius Europas“ bezeichnet.