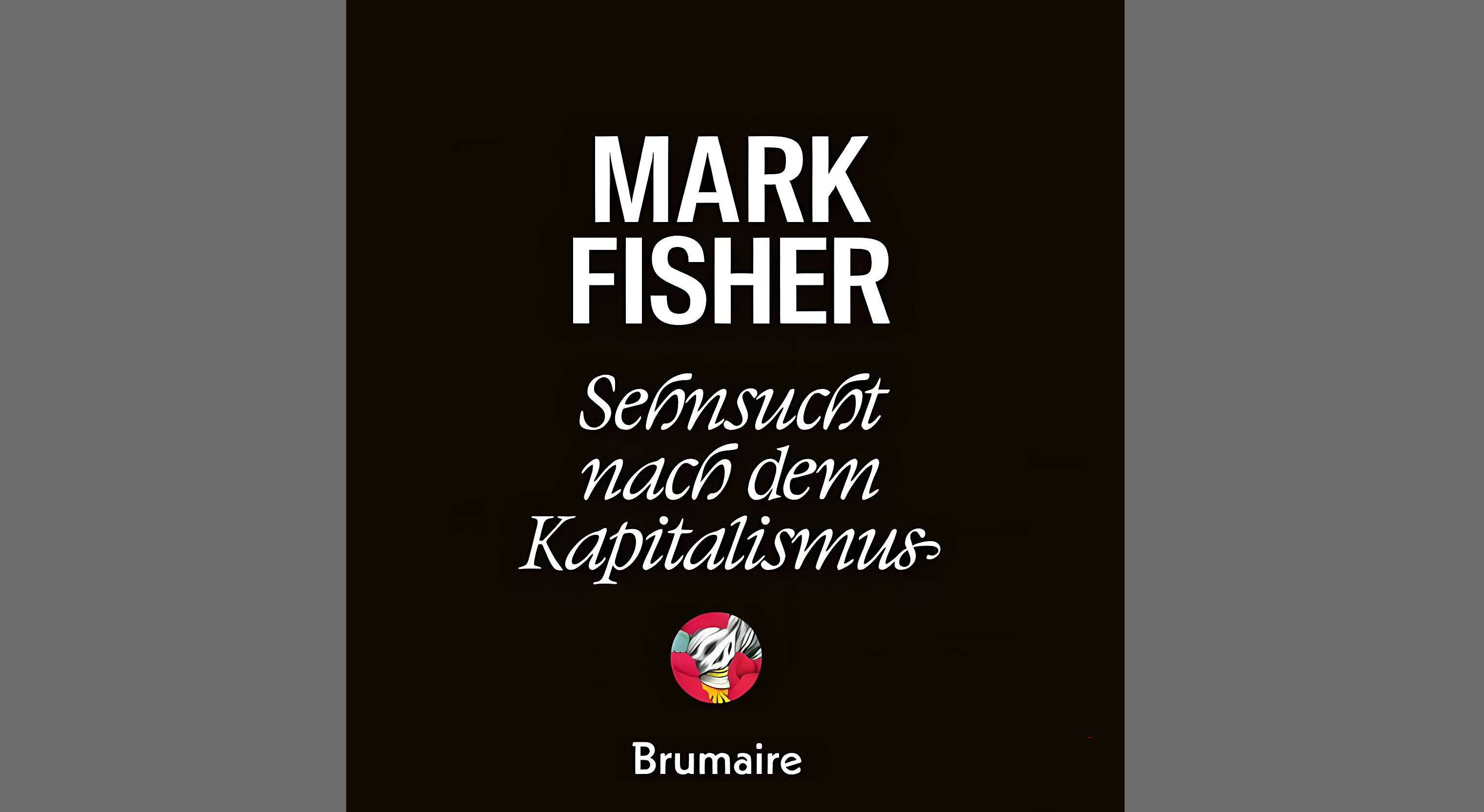
Das (Un-)Behagen mit dem Kapitalismus
Nach seinem tragischen Tod sind die letzten Vorlesungen von Mark Fisher in Buchform erschienen. Damit eine linke Transformation des Kapitalismus gelingt, so diagnostizierte Fisher, muss das kapitalistische Begehren der Arbeiterklasse verstanden werden. Laila Riedmiller bespricht das auf Deutsch übersetzte Buch und weist auf die Aktualität von Fishers Gedanken in Bezug auf den Umgang mit der AfD hin.
Der plötzliche Tod des Kulturtheoretikers Mark Fisher am 13. Januar 2017 machte diesen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, hatte dieser sich in seinem Denken doch explizit gegen die kapitalistische Privatisierung und Individualisierung mentalen Leidens gestellt, dem er schließlich selbst erlag. Bereits in seinem Essayband Capitalist Realism (2009) hat Fisher die Verbindung von kapitalistischem System und seinen gesundheitlichen Auswirkungen hergestellt. Dabei betonte er die Gefahr einer Individualisierung psychischer Erkrankungen und auch die Unfähigkeit kapitalismuskritischer Bewegungen, sich eine Alternative zum Kapitalismus überhaupt nur vorzustellen. 2014 veröffentlichte er mit Ghosts of my Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures noch einen Essayband, der sich unter Bezugnahme auf Jacques Derridas Konzept der Hauntology mit politischer Melancholie und Nostalgie auseinandersetzte. Auf seinem Blog k-punk übte er harsche Kritik an der Counter Culture der 1960er Jahre.
Vom Kapitalistischen Realismus zum Postkapitalismus
Vor diesem Hintergrund mag es verblüffen, dass Fisher in den Wochen vor seinem Tod ein Seminar unterrichtete, in dem er sich mit einer postkapitalistischen Zukunft befasste und sich dabei ausgerechnet von der US-amerikanischen Counter Culture inspirieren ließ. Der Seminartitel Postcapitalist Desire geht auf einen Aufsatz von 2012 zurück, in welchem Fisher die unauflösbare Verbindung von Kapitalismus und Begehren thematisiert. Das im November 2016 dann an der University of London begonnene Seminar gliedert sich in fünfzehn Sitzungen, von denen bis zu Fishers Suizid fünf stattfanden. Nach seinem Tod entstand ein Lesekreis aus Studierenden, Freund*innen und Kolleg*innen, die auch die restlichen von Fisher geplanten Texte diskutierten. Die ersten fünf Seminarsitzungen wurden von Studierenden per Tonaufnahmen aufgezeichnet. 2021 gab Blogger*in und Autor*in Matt Colquhoun diese Seminarsitzungen, ergänzt um ein Vorwort und den Syllabus des Seminars als Postcapitalist Desire: The Final Lectures heraus. Nun ist das Buch auch auf Deutsch unter dem Titel Sehnsucht nach dem Kapitalismus beim Brumaire Verlag erschienen.

Laila Riedmiller
Im Seminar laufen akzelerationistische Denk- und Suchbewegungen zusammen. Fisher selbst versteht das Seminar als Ergebnis seiner langen Auseinandersetzungen mit dieser Theorieströmung. Akzelerationismus, so formuliert er in der ersten Sitzung, erkenne an, dass ein Rückzug aus der kapitalistischen Moderne keine Option sei, sondern man durch sie ‚hindurchgehen‘ müsse. Daraus ergibt sich für ihn die Frage (S. 59): »Ist Postkapitalismus überhaupt vorstellbar? Ist es möglich, Teile der libidinalen, technologischen Infrastruktur des Kapitals zu erhalten, aber das Kapital selbst hinter sich zu lassen?« Mit Herbert Marcuse, Gilles Deleuze und Félix Guattari geht Fisher davon aus, dass das menschliche Begehren im Kapitalismus durch Konsum scheinbefriedigt wird. Ein Postkapitalismus, der das Begehren nicht ernstnimmt und auf Verzicht setzt, kann aus diesem Verständnis heraus nicht erfolgreich sein – auch deshalb, weil er nicht in der Lage ist, den Erfolg des Kapitalismus zu verstehen.
So leitet Fisher die zweite Sitzung mit Marcuses Triebstruktur und Gesellschaft ein: Da sich moderne Unfreiheit und Repression auf künstliche Ressourcenverknappung und den Zwang zur Arbeit zurückführen ließen, sei die Überwindung der Arbeit für das postkapitalistische Projekt zentral (S. 134). Fisher bettet die US-amerikanische Counter Culture in ihren historischen Kontext ein, in dem materielle Sicherheit und realistische Arbeitszeiten für Teile der amerikanischen Gesellschaft zu dem Gedanken führen, »dass es möglich ist, weniger zu arbeiten und die eigenen Bedürfnisse und Befriedigungen selbst festzulegen« (S. 135). Dabei seien die feministische Auseinandersetzung mit der Institution Familie und die Suche nach Alternativen zu dieser prägend gewesen. Fisher unterstreicht die kapitalistische Bedeutung der Kernfamilie (S. 141) und der künstlichen Verknappung von Zeit (S. 148) als Hindernisse für die Emanzipation von kapitalistischen Zwängen. Dass die Ästhetik der Counter Culture bis heute Kunst, Mode und Musik beeinflusst, führt Fisher auf das Scheitern der von der Counter Culture angestrebten Ziele zurück und resümiert, »dass es nie wahrer war als heute, dass wir von einer Welt heimgesucht werden, die frei sein könnte« (S. 147-148). Dabei handle es sich jedoch um kein materielles, sondern ein politisches Problem.
Die dritte Sitzung steht im Zeichen des ‚Gruppenbewusstseins‘. Ausgehend von Georg Lukács‘ Auseinandersetzung mit Totalität und Unmittelbarkeit legt Fisher seinen Studierenden die Relevanz der Entwicklung eines Klassenbewusstseins nahe und verbindet dies mit Nancy Hartsocks feministischer Standpunkttheorie. Sei ‚Klasse´ bis in die 1970er Jahre eine zentrale Kategorie des Sozialen gewesen, so sei diese nun zugunsten der Identifikation mit einer nicht näher bestimmten Mittelklasse verschwunden (S. 176). Fisher unterscheidet zwischen Klasse als Bewusstsein und Klasse als Herrschaft: »Klasse als Form der Herrschaft dauert fort, aber Klasse als Form des Bewusstseins ist zerstört worden« (S. 177). Die kapitalistische Individualisierung von Zeitknappheit und Erschöpfung und die zunehmende technologische Durchdringung des Alltags, so konstatiert Fisher, verhindere die Herausbildung eines gemeinsamen politischen Bewusstseins.
»Ohne ein Verständnis des kapitalistischen Begehrens der Arbeiterklasse lässt sich keine linke Transformation gestalten.«
In der vierten Sitzung vertieft Fisher die Frage nach einem politischen Gruppenbewusstsein. Im Zentrum steht die Geschichte der Arbeiterbewegung sowie die Entwicklung einer antiautoritären Linken. Sei die globale Arbeiterbewegung in den 1930ern noch durch Militanz und starke Gewerkschaften gekennzeichnet gewesen, so habe deren scheinbare Integration in die bürgerliche Gesellschaft über das verbindende Element des Antikommunismus im Kalten Krieg zum Verlust dieses Klassenbewusstseins beigetragen. Die Bürgerrechtler*innen und die Counter Culture der 1960er seien kaum von der traditionellen Arbeiterklasse gestützt worden. Der aufkommende Neoliberalismus und die Gegenreaktion hätten diesen Konflikt genutzt, um Ressentiments zu schüren und die Bildung eines Gruppenbewusstseins von Arbeiter*innen, rassifizierten Menschen und Frauen zu verhindern: »Ressentiment ist meiner Ansicht nach die Haltung, dass mir selbst etwas verwehrt wird, was jemand anderes bekommen soll, nicht, dass wir alle mehr bekommen sollen, was man als Basis des Klassenbewusstseins bezeichnen könnte« (S. 211, Herv. i. O.). Er plädiert dafür, »an der Möglichkeit einer intersektionalen Klassenpolitik festzuhalten« (S. 212) – also die Kämpfe aus Arbeiter*innenbewegung und Bürger*innenrechtsbewegung zusammenzuführen, da der Fokus auf Identitätspolitik ein Hindernis für das Verständnis anderer sozialer Kämpfe sein könne (S. 223). Statt auf (kollektive) Identität müsse man auf ein Gruppenbewusstsein setzen, da dieses eine transformative Dimension habe (S. 221). Dieses Bewusstsein zu verhindern, sei das Ziel rechter Politik, weshalb die Rechte eine Mischung aus Rassismus und Ressentiment gegen Expert*innen mobilisiere, um eine identitäre »weiße Arbeiterklasse« (S. 226) zu schaffen und gleichzeitig nicht gegen den Kapitalismus als Ursache von Problemen vorgehen zu müssen. Der Kapitalismus habe das revolutionäre Potential »verstoffwechselt« (S. 235) – mit dieser Diagnose ist Fisher wieder nah am Postulat eines Kapitalistischen Realismus.
Die letzte stattgefundene Sitzung befasst sich mit Jean-François Lyotards Ökonomie des Wunsches und mit dem Verhältnis von Begehren und Kapitalismus. Lyotard zufolge werde Kapitalismus dem Proletariat nicht einfach aufgezwungen, sondern von diesem auch lustvoll affirmiert. Wie auch Marcuse, Deleuze und Guattari versuche Lyotard, das Verhältnis von Libido und Politik neu zu formulieren und stelle sich dabei explizit gegen die Annahme, es gäbe einen vom Kapitalismus unberührten Bereich, auf den linke Bewegungen zugreifen könnten (S. 245, 251). Daraus folge für ihn, und aus diesem Grund versteht Fisher Lyotard explizit als akzelerationistisch, »dass wir uns eine Transformation aus dem jetzigen Zustand heraus [Herv. i. O.] vorstellen müssen« (S. 258). Lyotards Kritik an linken Transformationsprojekten in seiner Zeit sei relevant, weil diese das Begehren durch Moralismus zu bekämpfen suchten und dadurch »immer wieder diese Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen dem Bereich des Kapitals und einem Bereich außerhalb dessen, welcher rein und frei davon ist« hervorriefen (S. 269). Ohne ein Verständnis des kapitalistischen Begehrens der Arbeiterklasse lasse sich aber keine linke Transformation gestalten. Mit dieser ernüchternden Diagnose bricht das Seminar ab.
Das Seminar als akzelerationistisches Labor
Der von Colquhoun einleitend formulierte Anspruch, Fisher durch die Veröffentlichung seines letzten Seminars für sich selbst sprechen zu lassen, gelingt: In der Verbindung aus Seminarlektüre, Fishers Überlegungen und seinen Diskussionen mit Studierenden lässt sich ein Begriff des linken Akzelerationismus herausschälen, der die von Kritiker*innen oft bemühte Formel ‚Kapitalismus durch die Beschleunigung ökonomischer Prozesse (zu) überwinden´ als falsch entlarvt. Fisher macht mit seiner Literaturauswahl einen Vorschlag für einen entsprechenden Kanon und verdeutlicht die Heterogenität einer Denkströmung, die einem kapitalistischen Realismus gerade nicht nachgeben will. Irritationen, die angesichts des vermeintlichen Sprungs von deprimierend realistischer Gesellschaftsdiagnose zu hoffnungsvollen Zukunftsüberlegungen aufkommen, legen sich schnell, da Sehnsucht nach dem Kapitalismus sich als logische Konsequenz von Fishers bisherigen Arbeiten entpuppt. So erhalten Leser*innen des Buchs Einblick in eine offene Seminargestaltung, bei welcher Fisher die Grundlagen seines Denkens mit dem Ziel aufbereitet, Wege zum Postkapitalismus zu diskutieren. Dementsprechend handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Projekt, sondern den Versuch, die Studierende an kapitalismuskritische Theoretiker*innen und kulturwissenschaftliche Autor*innen heranzuführen und die Counter Culture als Ausgangspunkt für ein postkapitalistisches Projekt zu verstehen.
Der Mark Fisher, den man in Sehnsucht nach dem Kapitalismus kennenlernt, versteht das Seminar als Labor und entwickelt seine Gedanken in Diskussion mit den Seminarteilnehmer*innen. Zugleich schärft er Gedanken, die er bereits in früheren Texten formuliert hat, und überführt diese von einer Kritik an bestehenden Strukturen und Sackgassen linker Politik in produktive Überlegungen darüber, wie eine emanzipatorische gesellschaftliche Transformation gelingen kann. Das unterscheidet sein Denken in Sehnsucht nach dem Kapitalismus am stärksten von seinen früheren Arbeiten. Dass Fisher einen alltagskulturellen Zugang wählt, indem er nicht nur politiktheoretische Texte, sondern auch kulturjournalistische Auseinandersetzungen mit der Counter Culture (Ellen Willis) und aktivistische Texte (Naomi Klein, Shulamith Firestone) zur Pflichtlektüre macht, stärkt die Anschlussfähigkeit seiner Überlegungen und verdeutlicht die Breite und Vielschichtigkeit seines Denkens.
Ein ungewöhnliches und überzeugendes, aber auch ein herausforderndes Format für die Übersetzung
Da das vorliegende Buch der Seminarstruktur folgt und notwendigerweise unabgeschlossen bleibt, lässt sich nur schwer eine Kritik formulieren oder nach Leerstellen suchen. Schließlich ist nicht mehr zu beantworten, wie die übrigen Sitzungen sich gestaltet hätten. Die editorische Entscheidung, den Syllabus anzufügen, ermöglicht ein tiefgehendes Eintauchen in Fishers Seminar und zumindest einen Ausblick auf die geplanten Sitzungen. Das Vorwort ordnet die Seminarinhalte auch für Leser*innen, die mit Mark Fisher bisher wenige Berührungspunkte hatten, verständlich ein. Dass die Transkription auch die Verständnisfragen und Diskussionen mit den Studierenden übernimmt und sich bemüht, die mündliche Sprache möglichst wenig zu verändern, schafft eine Unmittelbarkeit, die zum geistigen Mitdiskutieren einlädt. Besonders an diesen Stellen zeigt sich Fishers Fähigkeit, den Studierenden die Angst auch vor komplizierten Textstellen zu nehmen, indem er (mitunter auch drastische) umgangssprachliche Formulierungen verwendet. So legt er den Brüdern, die den Freud’schen Vatermord begehen, zur Veranschaulichung den Satz »Wir sind viele, aber der fette Bastard ist allein« (S. 125) in den Mund und nutzt die daraus entstehende Irritation oder geht mit der sprachlichen Komplexität des Lukács’schen Werks scharf ins Gericht: »Dieser ganze Text trieft nur so vor Hegel. Deshalb macht es beim Lesen so wütend. Hegel und Heidegger haben sich darauf spezialisiert… Es ist in ihren Augen ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Text extrem schwierig zu lesen ist« (S.155). Immer wieder lockert er die Seminaratmosphäre mit Witzen auf und ermuntert die Studierenden, auch unvollständige Gedanken zu äußern. Sehnsucht nach dem Kapitalismus könnte daher auch für ein weniger theorieaffines Publikum spannende Einsichten bereithalten.
Deutlich wird aber die Herausforderung, die mit der Übersetzung eines derart ungewöhnlichen Formats einhergeht. So erschließt sich die doppelte Bedeutung des für die deutsche Ausgabe gewählten Titels möglicherweise erst im Lauf des Lesens – dies kann intendiert sein, es stellt sich aber die Frage, warum vom ursprünglichen, sehr eingängigen Seminartitel derart abgewichen wurde. Eine Übersetzung riskiert immer auch die Bedeutungsverschiebung einzelner Begriffe, was in der vorliegenden Ausgabe besonders an zwei Beispielen deutlich wird. So verweist Colquhoun im Vorwort der Originalausgabe auf den Begriff der »frenzied stasis« (S. 25), den Fisher zur Beschreibung akzelerationistischen Denkens genutzt habe. In der deutschen Ausgabe wird der Begriff des »rasenden Stillstands« (S. 35) eingeführt, der zumindest in der deutschsprachigen Kulturtheorie eng verbunden ist mit dem Medienphilosophen Paul Virilio. Zwar wird dies in einer Fußnote auch benannt, allerdings entsteht so der Eindruck, Fisher habe diese Nähe gesucht – eine Insinuation, die so im Original zumindest nicht getätigt wird. Auch an anderer Stelle wäre eine präzisere Begriffsarbeit wünschenswert gewesen. So wird zu Beginn der von Alex Williams und Nick Srnicek 1 Srnicek, Nick und Williams, Alex (2015): Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, London: Verso. geprägte Begriff der Folk Politics ohne Verweis auf dessen Herkunft mit »volkstümliche Politik« (S. 43) übersetzt; später wechselt die Übersetzung zu »Folk-Politik« (S. 83). Wer den Begriff verorten kann, stolpert über diese Inkonsequenz; wer ihn nicht kennt, kann ihn durch die deutsche Übersetzung nicht unbedingt zurückverfolgen oder als feststehenden Terminus erkennen.
Die Unabgeschlossenheit als Ausgangspunkt
Die Unabgeschlossenheit des Seminars wird damit auch zu einem Appell an ein sich als links und kapitalismuskritisch verstehendes Publikum, das Projekt des Postkapitalismus aufzugreifen. Laut Syllabus plante Fisher eine Sitzung zur neoliberalen Transformation Chiles, was bereits darauf verweist, dass das postkapitalistische Projekt für Fisher trotz des Fokus auf die US-amerikanische Counter Culture nicht auf Länder des globalen Nordens beschränkt sein muss. Die gemeinsame Klammer bildet der Neoliberalismus. Dennoch muss ein postkapitalistisches Projekt historische und regionale Spezifika ebenso beachten wie transnationale Gemeinsamkeiten. Sehnsucht nach dem Kapitalismus kann als Ausgangspunkt und Orientierungsfolie dienen, um sich im globalen Archiv der Gegen- und Subkulturen inspirieren zu lassen, denn Fishers Suche nach Lösungen innerhalb kapitalistischer Strukturen ist auch eine ideengeschichtliche: Der Weg zum Postkapitalismus führt durch die Auseinandersetzung mit der Genese linker und emanzipatorischer Bewegungen, welche durch unauflösbare Widersprüche charakterisiert sind. Fisher verdeutlicht, dass ein emanzipatorisches Projekt sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen und das Scheitern früherer Transformationsversuche ebenso analysieren muss wie deren Erfolge – und dass auch vermeintliches Scheitern Inspiration für eine künftige gesellschaftliche Transformation bieten kann.
Fishers Auseinandersetzungen mit feministischer Standpunkttheorie und der Versuch, Klassenbewusstsein mit intersektionalem Denken anzuregen, zeigen sein ehrliches Interesse an der Entwicklung eines universalistischen politischen Kollektivbewusstseins. Deutlich wird dabei auch Fishers Anspruch, bei seiner im Essay Exiting the Vampire Castle formulierten scharfzüngigen Kritik an einer den Kapitalismus ausblendenden und auf klaren Zuschreibungen aufbauenden linken Identitätspolitik nicht stehenzubleiben. Anders als beispielsweise Nancy Fraser kommt er jedoch ohne Vorwürfe aus und bietet mit Sehnsucht nach dem Kapitalismus ein Diskussionsangebot, auf das einzugehen auch für identitätspolitische Projekte gewinnbringend ist – vor allem, wenn sie bei ereignishaften Folk Politics nicht stehenbleiben wollen.
Neben der von Colquhoun geäußerten Aufforderung an die Leser*innen, Mark Fishers letztes Seminar zum Ausgangspunkt zu nehmen, um Wege in den Postkapitalismus zu entwickeln, lassen sich die Inhalte der einzelnen Sitzungen auch auf gegenwärtige Diskussionen übertragen. Die dritte und vierte Sitzung etwa fordern im Kontext der bereits wieder abnehmenden Großdemonstrationen gegen die AfD zu Fragen auf: Wie lässt sich das zivilgesellschaftliche Bedürfnis nach Solidarität in ein Gruppenbewusstsein überführen, das die unterschiedlichen Kämpfe um Anerkennung nicht gegeneinander ausspielt und zugleich die ökonomische Dimension ins Zentrum der Kritik rückt? Wie lässt sich ein gesamtgesellschaftliches oder über die betroffenen Gruppen hinausgehendes Bewusstsein für die gegenwärtige Zunahme von Antisemitismus und Rassismus sowie die bestehenden ökonomischen Ungleichheiten schaffen und verstetigen, das statt von Ressentiment von Solidarität angetrieben wird? Diese Fragen sind hochpolitisch, aber gerade deshalb scheint es geboten, dass die Diskussion auch aus wissenschaftlicher Perspektive verfolgt wird.
 Lesezeit 14 Minuten
Lesezeit 14 Minuten





