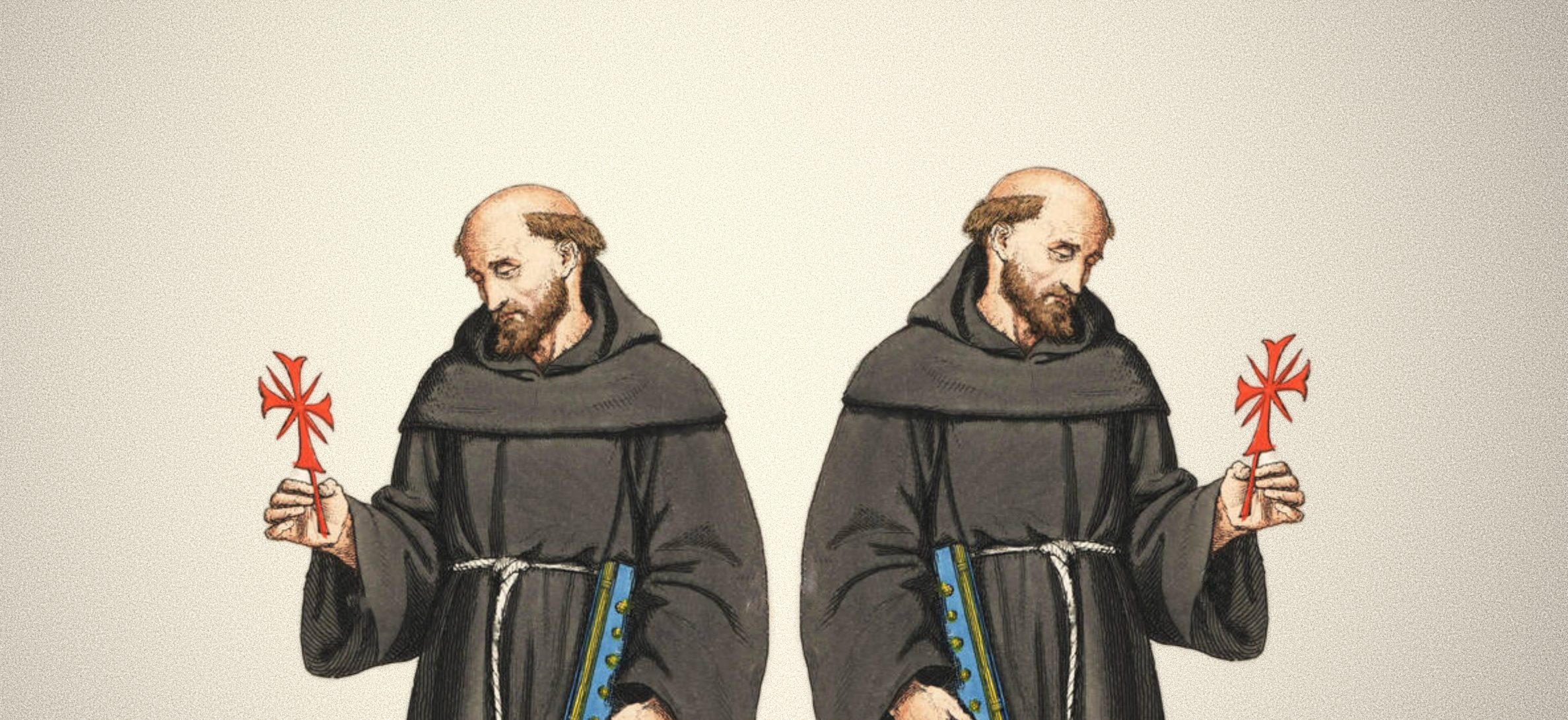Die tausend Köpfe des Staates
Jahrhundertealten Demokratien droht eine Dauerkrise, gerade weil alle Gruppen den Staat attackieren, ohne sich ernsthaft für eine Alternative einzusetzen – diesen paradoxen Zustand beschreibt Benjamin Studebaker in seinem neuen Buch. Doch zeigt sich nicht langsam, wie ein Weg aus der Misere aussehen könnte?
Warum gab es in den USA in den letzten Jahren eigentlich keine Revolution – oder zumindest einen (kleinen) Bürgerkrieg? Angesichts der Polarisierung der US-amerikanischen Bürgerschaft wird in Deutschland schon länger darüber diskutiert, ob die politischen Kämpfe nicht irgendwann die Grenzen der rein parlamentarischen Auseinandersetzung überschreiten müssen: »Kommt nach der Wahl in Amerika ein Bürgerkrieg?«, fragte die FAZ im Oktober 2024, »Droht ein Bürgerkrieg in den USA?« der Bayerische Rundfunk einige Monate zuvor. Schon im Juli 2022 titelte die Frankfurter Rundschau selbstbewusster: »Fachleute sehen USA kurz vor einem Bürgerkrieg«, und auch im Januar 2020 sahen die Blätter »Aussichten auf den Bürgerkrieg«. Gekommen ist es dazu bisher nicht.
Eine mögliche Erklärung liefert der Politikwissenschaftler Benjamin Studebaker, der auch den hörenswerten Podcast Political Theory 101 betreibt, in seinem neuen Buch »Legitimacy in Liberal Democracies« 1 Benjamin M. Studebaker: Legitimacy in Liberal Democracies, Edinburgh University Press 2024. . Bereits in seinem Vorgängerbuch hat er ein zentrales Merkmal der aktuellen politischen Legitimationskrise des US-amerikanischen Staates herausgearbeitet: Sie sei, so beschrieb er sie in »The Chronic Crisis of American Democracy«, vor allem darauf zurückzuführen, dass ein wachsender Teil der Bürger sich im Rahmen des bestehenden Systems keine Verbesserungen mehr erhoffe – es aber kein grundlegend anderes, alternatives politisches Angebot gebe, dem die Bürger stattdessen den Vorzug geben würden. Das Ergebnis sei eine chronische Systemkrise, in der weder Reformen noch ein grundsätzlicher Bruch mit dem Staat mehr zur Option stünden. »The Way is Shut« lautete der pessimistische Untertitel.

Nils Schniederjann
Auch in seinem zweiten Werk geht Studebaker von dieser Deutung der politischen Verhältnisse aus. Er untermauert sie mit einer Reihe von Begriffen, die erklären sollen, warum sich ein Staat wie die USA mit seinen historisch gewachsenen Institutionen trotz recht weitreichender Legitimationsprobleme relativ problemlos halten kann. Studebaker geht dabei deutlich über die gängigen Polarisierungs- und Krisendiagnosen hinaus – Polarisierung wird bei ihm nicht zur Gefahr, sondern zum Garanten für den Fortbestand der liberalen Demokratie.
Die Erstarrung der US-Demokratie
Der wichtigste Begriff, den Studebaker einführt, ist die »Embeddedness« einer Demokratie. Man könnte ihn frei, jedoch nicht völlig treffend, mit der Verwurzelung eines politischen Systems übersetzen. Studebaker will damit den Unterschied hervorheben zwischen einer jungen Demokratie, die ihre Problemlösungsfähigkeit und Krisenfestigkeit noch unter Beweis stellen muss, und einem politischen System, das bereits eine Vielzahl von Krisen und anderen Systemkonkurrenzen überstanden hat, sodass es allein dadurch schon eine gewisse Legitimität besitzt. Wenn also ein Großteil der Bürger eines Staates noch die Herrschaft eines anderen Systems erlebt hat, ist die Idee eines alternativen Systems leichter zu vermitteln, als wenn schon die Urgroßeltern unter den gleichen Institutionen gelebt, gekämpft und gelitten haben – ohne, dass das System jemals zusammengebrochen wäre.
Dass dies in Demokratien wie Deutschland, die bislang nicht oder nur mäßig verwurzelt sind, durchaus eine Rolle im Selbstverständnis der Gegner dieser Demokratien spielt, zeigt sich etwa in der neurechten Szene. So erzählt der Netzwerker und Vordenker Götz Kubitschek in einem Video, dass die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen ihn immer mit einem Spruch necke, wenn er sich zu sehr aufrege. »Götz, entspann dich«, sage sie, die in der DDR aufgewachsen ist, dann. »Es ist deine erste Diktatur.« Der Verweis auf die Erfahrung mit anderen politischen Systemen wirkt hier wie eine Ermutigung an den, der selbst nur die liberale Demokratie der Bundesrepublik kennt: Die werde man auch noch überkommen. Was in Schnellroda mit einem kleinen Lacher quittiert wird, wäre in den USA oder Großbritannien undenkbar – ein anderes politisches System liegt dort mehrere Jahrhunderte zurück; lebendige Erinnerung daran ist nicht vorhanden.
Nun könnte man die von Studebaker beschriebene Verwurzelung grundsätzlich für einen politischen Segen halten. Vielleicht schleppt die solchermaßen verwurzelte Bürgerschaft ein paar überholte Verfahren mit sich herum (wie etwa das aus deutscher Sicht notorisch unverständliche Electoral College), die ihren historischen Zweck überlebt haben – aber dafür muss man sich nicht mehr um die Gefahr einer Revolution oder gar eines Bürgerkriegs sorgen. Studebaker macht aber im Gegenteil darauf aufmerksam, dass gerade »Embededdness« zur Gefahr für liberale Demokratien werden kann. Die solchermaßen erreichte Stabilität – das ist seine These – hat ihren Preis.
Denn wenn die Revolution keine Option mehr ist, wird der Staat fundamentalen Dissens in seiner Bürgerschaft tolerieren können – er muss nicht befürchten, dass dieser Dissens seine Bürger irgendwann dazu verleitet, den Staat abzuschaffen. Diese können also ihren radikalen politischen Vorstellungen frönen. Die Stabilität des Systems erlaubt dem sensus communis eine Radikalität, die in jüngeren, instabileren Demokratien nicht möglich wäre. Das Ergebnis ist eine »enorme Vermehrung von Werten und Konzeptualisierungen bestehender Werte«. Studebaker bezeichnet dies als »deep pluralism«. Dieser tiefe Pluralismus beschreibt also nicht nur eine Vielfalt von politischen Meinungen und Einzelinteressen, wie sie in jeder freiheitlichen Gesellschaft vorkommt (und normativ gar als Ziel vorgegeben ist), sondern eine grundsätzliche und unversöhnliche Zersplitterung von Weltanschauungen.
Statt wie im 20. Jahrhundert die Interessen und Ansprüche organisierter Interessengruppen zu moderieren, kann der Staat auf diesen tiefgreifenden Pluralismus nur reagieren, indem er neue Legitimationserzählungen über sich schafft. Wenn beispielsweise Klimaaktivisten auf der einen und Klimaleugner auf der anderen Seite ihre Ansprüche an den Staat herantragen, kann eine Regierung nicht so leicht einen Kompromiss aushandeln. Er kann nicht die eine Legitimationserzählung finden, die sein Handeln beschreibt und rechtfertigt. Stattdessen muss er mehrere Erzählungen über sein Handeln anbieten – etwa indem die Regierung ein Umweltministerium schafft, das aber in ständigem Konflikt mit dem Wirtschafts- oder Energieministerium steht. Wichtig ist, dass der Staat keine kohärente, eindeutige Linie verfolgt: Damit würde er einen Teil der Bürger verprellen. 2 Für Studebaker erklärt das sogar den Fokus auf Symbolpolitik, der die amerikanische Politik seit mindestens 15 Jahren geprägt hat. Da der Staat sich nicht durch etwaige Ergebnisse seiner Politik legitimieren kann – zum Beispiel eine geringere Vermögensungleichheit zu schaffen –, versucht er sich über vermeintlich »demokratischere« Prozesse zu legitimieren: »As the state leans more on legitimation stories focused around equality of political input, it will also tend to draw more on storiesthat feature ‘standing for’ conceptualisations of representation. Both kinds of stories are strong fits for a gridlocked state that has limited policy dynamism. And so, if there is a shift towards equality conceptualised in terms of political input, it will also come alongside the cultural conflicts associated with descriptive and symbolic representation.«, Benjamin M. Studebaker: Legitimacy in Liberal Democracies, S. 124.
Am Ende mündet selbst eine staatliche Vertrauenskrise für Studebaker nur in einer weiteren Legitimationserzählung. Denn sobald die Bürger am Staat verzweifeln, weil sie seine sich widersprechenden Legitimationserzählungen als absurd entlarven, sich aber keine Alternative vorstellen können, wenden sie sich eskapistisch anderen Bereichen zu. In Studebakers Analyse sind dies die 4 F’s: Faith, Family, Fandoms, Futurism. »So wird die Wut verzweifelter Bürger verarbeitet«, schreibt Studebaker. »Statt sich in einer Revolution oder Revolte zu äußern, kann sich ihr Unmut in einer Reihe von Kämpfen um Produkte oder Persönlichkeiten entladen, bei denen weniger auf dem Spiel steht.« 3 »This becomes a way of processing the resentment that despairing subjects feel. Instead of pouring this resentment into revolution or revolt, it can be let off in a series of lower-stakes struggles over corporate products and personalities.« Benjamin M. Studebaker: Legitimacy in Liberal Democracies, S. 148 Anstatt nun die Wut seiner Bürger durch Reformen aufzulösen, macht der Staat sich die Existenz dieser kleineren Austragungsorte von Konflikten als Argument für seine Legitimität zu eigen. Auf diese Weise erlangt er zwar nicht seine volle Legitimität zurück, er verhindert aber durch die Verlagerung der Verantwortung für Problemlösung in private Sphären weiterhin, dass seine Legitimationskrise akut wird.
Das Ergebnis ist ein Staat, der nicht scheitert, sondern erstarrt. Statt großer Umbrüche erleben wir ein System, das sich stets mit neuen Narrativen stützt, aber gerade dadurch seinen Handlungsspielraum immer weiter einengt. Dieser Staat ist so stabil, dass er sich selbst blockiert.
Revolution im Spätliberalismus?
Studebaker erkennt also in der gesellschaftlichen Polarisierung, die als Schlagwort in kaum einer Krisendiagnostik noch fehlt, ein subtiles systemisches Phänomen: eine Form der politischen Lähmung, die sich gerade durch ihre scheinbare Dynamik auszeichnet. Polarisierung wird zur systemstützenden Kraft.
Studebaker sieht zwei Wege aus dieser Lage: Der wahrscheinlichere ist, dass der Staat aufgrund seiner Lähmung die Fähigkeit verliert, auf etwaige Katastrophen adäquat zu reagieren. Dabei ist nicht nur an die Möglichkeit eines Krieges zu denken, sondern auch an die periodischen Krisen, die die kapitalistische Ökonomie notwendigerweise mit sich bringt und die eigentlich ein regelmäßiges, beherztes Eingreifen des Staates erfordern. Je nach Ausmaß einer solchen Krise könnte sie sogar einen jahrhundertealten Staat entwurzeln.
Die zweite Alternative, die Studebaker nur andeutet, ist seit dem Erscheinen des Buches im November 2024 immer plausibler geworden. Damit die Möglichkeit entsteht, über die liberale Demokratie hinauszudenken, damit eine Art »revolutionärer Druck« entsteht, müssten die Anhänger eines politischen Ideals laut Studebaker bereit sein, bis zum Äußersten zu gehen: Sie müssten sich auflehnen gegen das Gebot, »das Überleben an sich zu priorisieren«.
Studebakers Analyse gipfelt in der Schlussfolgerung, dass politischer Wandel nur möglich wird, wenn Bürger bereit sind, dafür existenzielle Risiken auf sich zu nehmen. Die Bereitschaft, für seine politischen Ideale zu sterben, wird damit zur strukturellen Voraussetzung substanzieller Transformation erklärt: »Sobald erkennbar ist, dass die Revolutionäre zu sterben bereit sind«, schreibt Studebaker, »wird es für den Staat möglich, eine wirklich disruptive Politik zu verfolgen, die erhebliche wirtschaftliche Kosten verursacht, weil die politischen Kosten des Ignorierens der Situation höher erscheinen als die wirtschaftlichen Kosten von Zugeständnissen. Erst an diesem Punkt und nicht vorher können Staaten echte Reformen durchführen.« 4 »When it is clear that the revolutionaries are willing to die, it becomes possible for the state to pursue policies that are genuinely disruptive, that have substantial economic costs, on the grounds that the political costs of ignoring the situation appear greater than the economic costs of the concessions. It is only at this point that states may deliver real reforms, and not before.«, Benjamin M. Studebaker: Legitimacy in Liberal Democracies, S. 160
Studebaker deutet diese These am Schluss seines Buches leider bloß an, ohne handfeste Gründe für ihre Richtigkeit zu nennen. Doch könnte man sagen, dass seine These seit der Veröffentlichung seines Buches auf unrühmliche Weise bestätigt wurde – zumindest in den USA. Die übliche Erklärung dafür, dass die zweite Trump-Administration so radikal durchregieren konnte, ist der Verweis auf die fleißige Arbeit an Plänen wie dem Project 2025, die in den vergangenen Jahren von der Republikanischen Partei und dem Trump‘schen Vorfeld vorangetrieben wurden. Doch mit Studebaker kann man über diese faktische Dimension hinausgehen und stattdessen die Legitimationsstruktur hinterfragen, die diese Vereinnahmung nahezu aller staatlichen Strukturen erst ermöglicht hat. Man könnte also sagen: Vielleicht haben erst der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und das Attentat auf Trump im Wahlkampf 2024 das politische Gefüge derart erschüttert, dass sich ein Riss auftat, durch den sich die unbändige Reformlust der Trump-Regierung Bahn brechen konnte. Trumps mit blutigem Ohr geschriener Schlachtruf »Fight, fight!« kommunizierte jedenfalls schon vor der Wahl, dass er sein politisches Projekt mit einer Entschlossenheit vertrat, die bislang von keiner Seite so vorgetragen wurde.
Der Gedanke, dass politischer Wandel nicht nur intellektuelle Kritik, sondern existenzielle Opfer erfordern könnte, ist heute schwer zu ertragen. Die emotional aufgeladenen Debatten um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht haben aber jüngst gezeigt, dass gerade der Einsatz des eigenen Lebens für die Gestaltung eines Gemeinwesens – und der deutlich artikulierte Unwille dazu – uns herausfordert, über grundsätzliche Fragen nachzudenken.
Man muss nicht dabei mitgehen, dass eine ernstzunehmende Alternative zur liberalen Demokratie ihren Anhängern das Leben kosten muss. Im Gegenteil gibt es, wie Ady Zymberi kürzlich argumentiert hat, gute Gründe, genau die Verhinderung dessen zum politischen Ideal progressiver Politik zu erheben. Dass es jedoch Menschen braucht, die bereit sind, einen Teil ihres persönlichen Komforts zu riskieren, um die Gesellschaft als politischen Akteur in Stellung gegen den Staat zu bringen, dürfte in der Tat richtig sein. Allein das ist im Spätliberalismus aber schon schwer genug.
 Lesezeit 11 Minuten
Lesezeit 11 Minuten