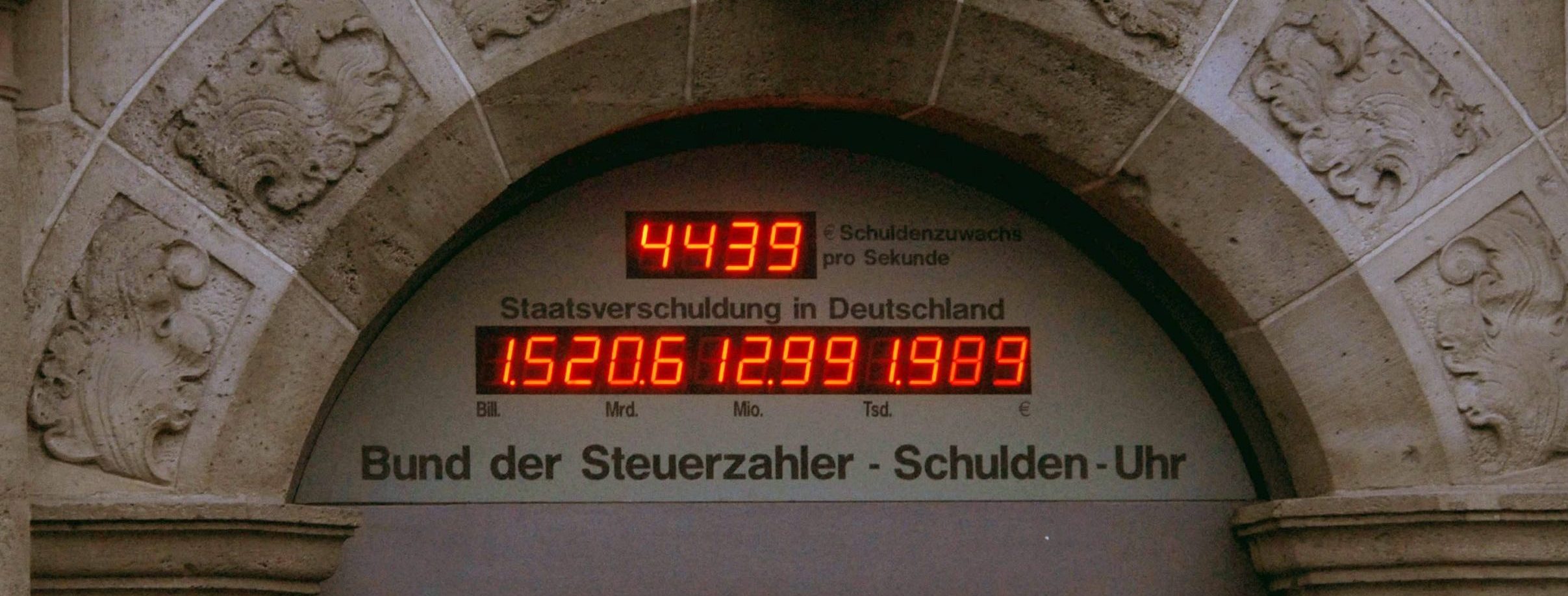Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Wandel als Dogma
Wer am Dogma des ständigen Wandels zweifelt, gilt schnell als Ewiggestriger, kritisiert Hans Rusinek. Dabei wird fast nie hinterfragt, ob das, was vorher war, auch wirklich änderungsbedürftig ist.
„Wir leben in der Ära des beispiellosen Wandels, nichts darf mehr beim Alten bleiben, adapt or die“. Pass dich an oder geh unter – wie oft haben Sie das schon gehört?
Wenn wir im Sinne Kants den eigenen Verstand bedienen sollen, um die großen Dogmen der Zeit zu hinterfragen, stehen wir heute vor der Beschwörung eines beispiellosen Wandels. Dieses Dogma ist so tief ideologisch, dass wir es nicht als Ideologie erkennen, sondern einfach einstimmen, wie der Soziologe Chris Grey untersucht hat.
Diese Tirade der disruptiven Zukunft ist etwa in der Arbeitswelt so allgegenwärtig, wird ehrfürchtig wie ein gesegneter Gegenstand herumgereicht und hat so eine Strahlkraft auf uns, dass es Zeit ist, sie ins richtige Licht zu rücken – in das der Theologie.
Wie die Religion hat der Wandeldiskurs seine eigene Geschichtsverklärung: Um die aktuelle Vehemenz deutlich zu machen, verweist er gern auf eine große Nachkriegsstabilität, aber blendet aus, was dort alles passierte: atomare Abschreckung, Koreakrieg, Entkolonialisierung, Frauenbewegung, Migration und Terrorismus.

Hans Rusinek
Üppig im Prunk und streng zu den Ketzern sind die Liturgien des Wandels: Wenn wer von der Dreifaltigkeit Transformation, Revolution, Disruption predigt, dann wird verehrt, nicht diskutiert. Dann gibt es im frommen Eifer noch gottesfürchtigere Deutungen, dann wird aus Arbeit 2.0 schon 4.7, dann ist die Bürokratie schon lange tot und die vollautomatisierte Cyberökonomie eigentlich schon da. Weist ein kritischer Geist darauf hin, dass trotz aller Fanfaren Hierarchie, Bürokratie und Management bemerkenswert stabil sind, wird er reflexhaft als ewiggestrig, ahnungslos und sonderbar abgestempelt.
Wandel durch Einschüchterung
Paradoxerweise ist die Rede vom Wandel selbst ziemlich alt: Schon vor einem halben Jahrhundert schrieben Managementbücher von „unprecendeted rates of change“, also den beispiellosen Änderungsraten.
Vor allem aber hat auch diese Religion ihren Klerus und der seine Macht: Wenn die Predigt des unerhörten Wandels auf uns schallt, bleibt kein Gehör mehr für alle, die kurz noch mal über gemeinsame Ziele und Werte sprechen wollen. Dann erleben wir in Politik und Wirtschaft, dass Krisenmanager jahrzehntelang einfach nur fürs Krisenmanagen bewundert werden. Dann erleben wir den Typ Changemanager, der unhinterfragt so ziemlich alles um- und abstellen kann, was vielleicht noch gut war: klare Karrierepfade, stabile Arbeitsorte, ein gemeinsames Anliegen. Das Hohelied des Wandels erzeugt ängstliche Nachgiebigkeit.
Hin zu einer gemeinsamen Zukunftsgestaltung
Natürlich hat dieses Gerede vom Wandel einen sehr realen Kern, etwa in Form von Digitalisierung oder Klimawandel. Wenn wir aber verstehen, dass die daraus resultierenden Krisen zu einem massiven Teil Beziehungskrisen sind, wird uns klar, dass dieser sehr reale Kern des Wandels mehr gemeinschaftliche Diskursräume braucht und nicht Einschüchterung:
Wie ließe sich dieser sakralisierte Wandel für eine gemeinsame Zukunftsgestaltung vom Sockel holen und so profanisieren? Wie nicht mehr manchen eine rhetorische Macht geben und anderen nehmen, sodass am Ende nur die notorische Alternativlosigkeit bleibt?
Vielleicht steht uns wirklich eine disruptiv andere Zeit bevor. Nämlich eine, in der wir uns fragen werden, warum wir diesem Wandeldogma so blind gefolgt sind, statt an einer gemeinsamen Vision zu arbeiten, warum wir Bedürfnisse wie Stabilität und Nachvollziehbarkeit so vernachlässigt haben, warum wir dabei so viele nicht beteiligt, sondern abgewertet haben. Das wäre dann eine Zukunft, die uns echt eiskalt erwischen würde.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf DLF Kultur.
 Lesezeit 3 Minuten
Lesezeit 3 Minuten