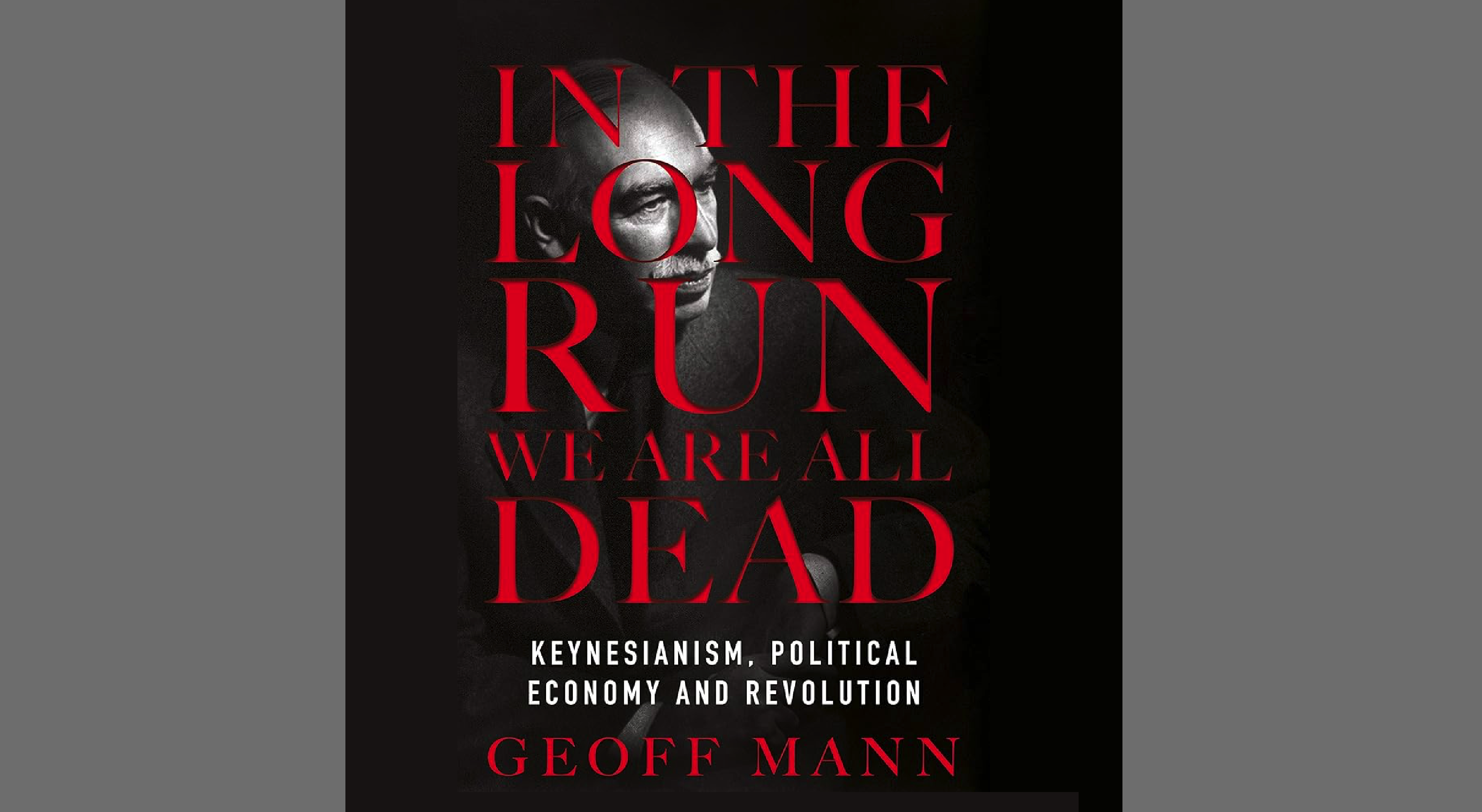
Geoff Mann revisited: Mit Keynes und Hegel gegen den Faschismus
Geoff Mann’s Deutung des Keynesianismus wird von Jahr zu Jahr nur noch aktueller. Wie wir in Keynes einen Antifaschisten und Hegelianer lesen und was selbst revolutionäre Marxisten von dem britischen Ökonomen lernen können, diskutiert Jan Frohn.
Der Keynesianismus löst innerhalb der Linken ambivalente Gefühle aus. Die einen zelebrieren das »goldene Zeitalter des Keynesianismus« als einen der wenigen Momente in der Geschichte des Kapitalismus, in dem die Ungleichheit abnahm, relative wirtschaftliche Stabilität herrschte und sich die Lebensverhältnisse der Arbeiter real verbesserten. In anderen, marxistischen Kreisen werden genau diese Tatsachen zu einer Kritik gemünzt. Die dem Keynesianismus zu verdankende Stabilität verhinderte mit der Krise demzufolge auch die Revolution. Die Great Depression hatte der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, wie schnell Wirtschaftskrisen revolutionäre Tendenzen hervorbringen können. Den politischen Eliten wurde daraus klar: Wer die Macht- und Eigentumsverhältnisse sichern will, muss den entfesselten Kapitalismus bändigen und sogar Zugeständnisse an die Arbeiterschaft machen. Keynes lieferte das wissenschaftliche Fundament für diesen sozialen Kapitalismus und war – nach dem berühmten Ausspruch von Eric Hobsbawm – gekommen, um den Kapitalismus vor sich selbst zu retten. 1 Eric Hobsbawm, »Goodbye to All That«, Marxism Today, October 1990, 20.
Hinter dieser Kritik steckt nicht nur die zynische Logik, dass jegliche Form der Verbesserung der Lebensumstände im Kapitalismus eine sedierende Wirkung auf die Arbeiterschaft hat und dass, wer auf eine bessere Welt hofft, eher die Verelendung intensivieren sollte. Die marxistische Kritik greift tiefer und hinterfragt unsere verfestigten Denkmuster. Sie unterstellt dem Keynesianismus zum hegemonialen Krisendiskurs geworden zu sein. In Policymaker-Kreisen gilt, spätestens wenn die Wirtschaftskrise eintrifft: »We are all Keynesians now«. Damit schränkt der Keynesianismus unseren politischen Werkzeugkasten und unsere Vorstellungskraft über eine alternative Wirtschaftsordnung ein. Mit dieser diskursiven Macht ist der Keynesianimus »one of the toughest obstacles any project of more-than-trivial social transformation will face« (S. 389).
Geoff Mann hat sein Buch ursprünglich als Marxistisch-Gramscianistische Kritik am Keynesianismus geplant, die genau hier ansetzen wollte: An der Hegemonie des Keynesianismus, die in Folge der Finanzkrise von 2008 wiedererstarkte. Während des Schreibprozesses begann Mann sich jedoch zunehmend mit dem Opfer seiner Kritik zu identifizieren, sodass sich das Endprodukt eher als eine sympathisierende Verteidigung des Keynesianismus als eine Kritik liest. Der Perspektivwechsel, den das Buch vollzieht und der aus manchen Marxisten glühende Keynesianer zu machen vermag, ist die Abkehr von der geläufigen Darstellung von Keynes als Retter des Kapitalismus. Mann stellt zwei zentrale Fragen: Was genau ist das Objekt, das Keynes retten wollte? Und warum bzw. wovor wollte er es retten?

Jan Frohn
Was Keynes »wirklich« retten wollte
Die Auseinandersetzung mit der ersten Frage führt zu der Einsicht, dass Keynes keineswegs ein überzeugter Verfechter des Kapitalismus war. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass Keynes ein Kapitalismus-Gegner war. Vielmehr hatte er ein ambivalentes Verhältnis: Keynes-Schülerin Joan Robinson beschrieb, dass Keynes zwischen »moods when capitalism enraged him, and others when he sang its praises« (S. 387) wechselte. Es gibt keine dem Kapitalismus inhärente Eigenschaft, die Keynes für schützenswert hielt. Vielmehr ging es ihm um etwas anderes, als dessen Retter er sich begriff: »the thin and precarious crust« der Zivilisation (S. 9). Denn auch wenn Keynes kein überzeugter Kapitalist war, verkörperte er durchweg den klassischen Liberalen, den bürgerlichen Gentleman, gehörte zur in Eton und Cambridge geschulten britischen Elite und genoss damit die Privilegien der zivilisierten Gesellschaft wie nur wenige. Diese Zivilisation zu wahren ist »the single most important premise of all things Keynesian« (S. 9).
Vor welcher Gefahr gilt es also die Zivilisation zu beschützen? In den Augen vieler Marxisten richtet sich die keynesianische Wirtschaftspolitik gegen die kommunistische Revolution. Zu Keynes‘ Zeiten war das Gespenst der Russischen Revolution von 1917 in vielen Köpfen noch sehr präsent. Mann argumentiert allerdings gegen diese Sichtweise: Das historische Ereignis, vor dessen Hintergrund Keynes seine Theorie formulierte, war nicht die Russische Revolution, sondern der Erste Weltkrieg und deren Nachspiel. Wovor Keynes die Zivilisation retten wollte, war nicht der Kommunismus, sondern Terror, Totalitarismus und allen voran der Faschismus.
Ob Keynes‘ politische Prioritäten darauf basierten, dass er dem Kommunismus etwas abgewann, ist natürlich äußerst fraglich. Wahrscheinlich wird Keynes als klassischer Sozialliberaler den Kommunismus schon als kleineres Übel gegenüber dem Faschismus betrachtet haben. Keynes‘ Kritik am Kommunismus als »confused stirrings of a great religion« wirkt nahezu freundlich verglichen damit, dass er in den Faschisten »enemies of the human race« sah (S. 67). Hinter dem anderen Grund, wieso Keynes sich weniger auf den Kommunismus und mehr auf den Faschismus als Gefahr fokussierte, steckt allerdings keine politische Präferenz, sondern sein pragmatischer Realismus: Der Faschismus ist in westlichen Demokratien um einiges wahrscheinlicher als der Kommunismus. Diese, für Linke schwer zu verdauende Einschätzung bewahrheitet sich heute sogar mehr als damals. Aufgrund der Gefahr von rechts gilt es, die Zivilisation zu wahren, selbst wenn das den Fortbestand des Kapitalismus bedeutet. Denn an jenem Tag, an dem das kapitalistische System zusammenbricht, werden die Kommunisten, die sich die Krise herbeigesehnt haben, plötzlich wundern, dass nicht sie, sondern andere siegreich sind. Ob direkt oder nach einer Konterrevolution: Am Ende des Tages wird höchstwahrscheinlich keine rote Flagge, sondern eine mit Hakenkreuz wehen.
Diese Dringlichkeit zwingt selbst Marxisten dazu, Reformisten oder Keynesianer zu sein – zumindest bis zu dem Punkt, an dem die Gefahr von rechts gebannt ist. Der Keynesianismus ist damit post-revolutionär. Eine anfängliche Revolution war notwendig, um die liberale Moderne zu ermöglichen, in welcher der Keynesianismus operiert. Diese Moderne ist allerdings instabil und birgt die inhärente Gefahr des Faschismus, weswegen eine zweite Revolution, dessen Ausgang offen ist, ein zu hohes Risiko darstellt. Stattdessen lassen sich ein Leben in Würde oder sogar »economic bliss« auch auf reformistischen Weg ermöglichen, solange man Keynes‘ Policy-Empfehlungen befolgt. Die Revolution ist daher nur die Hebamme der modernen Gesellschaft: »essential at birth, but no longer necessary« (S. 91).
Keynes und Hegel
Um den Kern des Keynesianismus, dessen Verständnis der Moderne und Einstellung zur Revolution zu verstehen, lohnt es sich, einen weiteren Denker heranzuziehen: Hegel. Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Mann den Keynesianismus von der realen Figur John Maynard loslöst, um den -ismus als ein breiteres, ideologisches Phänomen der Moderne zu verstehen. Er verwendet den Begriff dabei anachronistisch und bezieht ihn sowohl auf Denker nach Keynes als auch auf welche vor ihm. So bezeichnet er Keynes nicht nur als unseren Hegel, sondern charakterisiert Hegel als Keynesianer avant la lettre.
Erfrischend an Manns Hegel-Lektüre ist, dass sie mit vielen geläufigen Missverständnissen über Hegel aufräumt. So stellt sich Mann gegen die Karikatur, in der Hegel einem anti-empirischen, fast mystischen Idealisten gleicht, der die Welt als organisches Ganzes betrachtet und sämtliche Unterschiede ausblendet. Genauso entschieden verteidigt er Hegel und seine politische Philosophie gegen diejenigen, die in ihm einen reaktionären Denker, Philosoph der preußischen Restauration oder sogar Wegbereiter des Faschismus sehen. Erstens war Hegel im Gegensatz zum radikalen Idealisten durchaus am empirischen Inhalt, dem Positiven oder wie Keynes an »the world we actually live in« interessiert und dadurch eher weltlich als mystisch orientiert. Gegen das zweite Missverständnis argumentiert Mann, dass Hegels Werk nur im Kontext der Französischen Revolution gelesen werden kann. 2 Diese Argumentation ist keineswegs neu und findet sich z. B. auch in Joachim Ritter, »Hegel und die Französische Revolution«, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1965 Anstelle eines Reaktionärs finden wir jemanden, der die Französische Revolution rückblickend sogar legitimiert, aber ähnlich wie Keynes die Notwendigkeit einer zweiten Revolution abstreitet. Zudem wäre dem Liberalismus geholfen, wenn er Hegels Kritik am Liberalismus nicht als anti-liberale Tendenz auffasst, sondern als wohlwollende Diagnose, um den Liberalismus vor seinen immanenten selbstzerstörerischen Kräften zu bewahren.
Hegel und Keynes ähneln sich laut Mann zunächst in ihrer Erkenntnistheorie. Keynes stellt sich gegen die neoklassische Ökonomik, die mit formalen, mathematischen Gleichgewichtsmodellen einen idealen Markt beschreibt. Anstelle der neoklassischen Traumwelt platziert Keynes seine General Theory in der Welt, in der wir wirklich leben, samt ihrer Unreinheiten. Statt Gleichgewicht, Vollbeschäftigung und Wachstum herrschen hier Dynamik, Unterbeschäftigung und wiederkehrende Krisen, solange man den Markt sich selbst überlässt. Analog zu Keynes Kritik an der neoklassischen Ökonomik steht Hegels Kritik an Kant. Dieser sah in Kant ebenfalls einen leeren Formalismus ohne Bezug zur echten Welt. So lehnt Hegel Kants Moral ab, ein universelles Prinzip, das wir ungebunden von Ort und Zeit erkennen und befolgen können, indem wir uns unserer reinen Vernunft bedienen. Stattdessen argumentiert Hegel für eine Sittlichkeit, die im Gegensatz zu Kant die ortsgebundenen, sozialen Gegebenheiten als Input nimmt und damit die Welt berücksichtigt, wie sie tatsächlich ist und nicht wie sie sein sollte. Wenn Hegel den Terror der Französischen Revolution verurteilt, dann weil der Terror kantianisch war. Wer seine Moral auf nichts, was sich in der echten Welt befindet, aufbaut, dessen Handlungen werden diese Welt negieren und zerstören, anstatt sie positiv zu transformieren.
Der zweite Fehlschluss, dem die neoklassische wie kantianische Weltanschauung aufsetzen, ist, dass sie Notwendigkeiten des Lebens in ihrem abstrakt-formalen Denken ignorieren. Sie versteifen sich auf die Freiheit, obwohl eine Befriedigung der Grundbedürfnisse ein noch fundamentaleres Recht darstellt, welches Hegel das Notrecht nennt. Ohne Anerkennung dieser Not kann auch keine Freiheit gedeihen. Im Gegenteil: In einer Gesellschaft, die sich Freiheit auf die Fahne schreibt, in der aber akute Armut herrscht, werden bald anti-liberale Tendenzen laut. Hegels Antagonist, der Pöbel, formiert sich genau dann, wenn das ökonomische Problem der Armut nicht innerhalb der ökonomischen Sphäre gelöst werden kann und in die politische überspringt. In der politischen Arena ist der Pöbel stets destruktiv. Da er ausgeschlossen von der liberalen Gesellschaft ist, steht für ihn nichts auf dem Spiel. Es gibt nichts, was er bei der Beseitigung dieser Ordnung verlieren könnte.
Das Ende der Armut
In dieser Problembeschreibung steckt aber schon die Lösung. Das Problem der Armut muss innerhalb der ökonomischen Sphäre begrenzt werden. Das bedeutet auch eine Depolitisierung der Armut und den Ausschluss des Demos. Statt Bürgerräten oder Wahlvolk liegt das Management der Ökonomie in den Händen von Technokraten, sodass die soziale Frage politisch gar nicht erst aufkommt. Der Pöbel wird dadurch aktiv verhindert. Darin steckt das antidemokratische Moment des Keynesianismus, der sich zumindest gegen Formen der direkten Demokratie wendet. Wir finden die Parallele zu Keynes‘ Experten in Hegels universellen Klasse. Der Staat nimmt auch bei Hegel eine prominente Rolle ein, als Regulativ, der die Partikularinteressen der bürgerlichen Zivilgesellschaft in ein gesellschaftliches Universalinteresse überführt.
Im Glauben, dass ein Ende der Armut überhaupt möglich ist und nicht mal Politik im ernsteren Sinne (z. B. Klassenkampf) erfordert, steckt der optimistische Kern des Keynesianismus. In der General Theory finden wir die wissenschaftlichen Grundlagen, um diese Ambition umzusetzen. Mann wendet den ganzen dritten Teil seines Buches auf, um eine mundgerechte Einführung in Keynes‘ Magnum Opus zu geben. Überraschend stellen wir fest, das vieles von dem, was wir in Makro 101 über keynesianische Theorie (z. B. das IS-LM-Modell) und Praxis (z. B. der Sozialstaat) lernen, dem echten Keynes nur fälschlicherweise zugeschrieben wird. Auch das »goldene Zeitalter des Keynesianismus« war vielleicht gar nicht so keynesianisch, wie wir zunächst angenommen haben. Tatsächlich wurden die eigentlichen Policy-Empfehlungen von John Maynard kaum jemals in die Praxis umgesetzt.
Der Kapitalismus produziert nie dagewesenen Wohlstand, aber leidet laut Keynes unter dem Fluch des Midas, der bittere Armut inmitten der Opulenz produziert. »[T]he richer the community, the wider will tend to be the gap between its actual and its potential production; and therefore the more obvious and outrageous the defects of the economic sytem« (S. 237). Das alles müsste jedoch nicht sein: Keynes betrachtet Mangel, in erster Linie die Knappheit des Kapitals, als sozial produziert. Diese Knappheit hat lediglich die Funktion, den Kapitaleignern eine akzeptable Rendite zu bescheren, damit sich ihre Investition lohnt. Solange die Vergabe des Kapitals in privater Hand organisiert wird, erkrankt der Kapitalismus an einem chronischen Investitionsstau. Keynes Handlungsempfehlung ist deshalb, dass stattdessen der Staat die Investitionen organisiert. Dadurch werden alle Ressourcen ausgereizt, die unfreiwillige Arbeitslosigkeit beseitigt und die Kapitalrendite schrittweise gegen Null gedrückt. Aufgrund letzterem verschwindet als positiver Nebeneffekt auch noch der Rentier, was Keynes berühmter »euthanasia of the rentier« entspricht.
Keynes heute
Mann wendet den Begriff des Keynesianismus nicht nur auf die Denker vor Keynes an, sondern auch auf die während oder nach seiner Zeit. Die Palette an Keynesianern ist bunt und reicht von Kalecki über Piketty bis zu Stiglitz. Im Gegensatz zu deren Anhängern zeigt Mann weniger die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten dieser Subströmungen auf.
Heute ist keynesianisches Denken dringender denn je. Wir erinnern uns an dessen Prämisse, die »thin and precarious crust« der Zivilisation gegen ihre Gegner, den Pöbel, zu schützen. Dass selbstzerstörerische Kräfte der liberalen Zivilisation inhärent sind, wird heute wieder deutlicher. Jüngste Wahlergebnisse der AfD, die sie bundesweit zur zweitstärksten Kraft und auf Lokalebene vielerorts zur stärksten krönen, erschüttern die deutsche Öffentlichkeit und die der Welt. Wiederholen sich etwa in den jetzigen Zwanzigern die 1920er-Jahre, also genau der historische Abschnitt, vor dessen Eindruck Keynes‘ sein Denken formte? Wir können uns traurig schätzen, dass zu einer Zeit, in der wir Keynes am meisten brauchen, dieser von vielen neoklassischen Ökonomen immer noch verhöhnt, nicht gelesen, missinterpretiert und selten in Hörsälen ernsthaft diskutiert wird. Gleiches gilt für Hegel, dessen Abwesenheit die Denkweise, die sich heutzutage »liberal« nennt, geistig verarmt.
Solange die Gefahr von rechts droht, müssen wir unsere marxistischen Träume von der Revolution zur Seite schieben, und den weniger aufregenden, aber friedlichen Weg des Keynesianismus gehen. Die Abwendung der Katastrophe ist jedoch nur eine Seite der keynesianischen Medaille und hat eine spezifische Temporalität: den short run. Zu dem, was Mann die »dialectic of hope and fear« (S. 14) nennt, gehört auch die andere, hoffnungsvollere Seite: »with patient and pragmatic oversight, existing institutions, ideas and social relations have the potential to produce, without rupture, a radically transformed social order« (S. 50). Das heißt, dass wir unsere linken Träumereien doch nicht komplett aufgeben, sondern lediglich hintenanstellen müssen. Die Utopie des »economic bliss« hat allerdings eine andere Zeitdimension: den long run. »In the long run, we are all dead«, lautet das berühmte Keynes-Zitat und der Titel des Buches. Das klingt so, als könnten wir die Utopie niemals miterleben. Aber wir müssen das keynesianische Glas nicht halbleer sehen: »I could have said equally well that it is a great advantage of ‘the short run’ that in the short run we are still alive« (S. 13). Lasst uns durch kluge, keynesianische Maßnahmen dafür sorgen, dass die Zivilisation weiterhin leben wird.
 Lesezeit 13 Minuten
Lesezeit 13 Minuten





