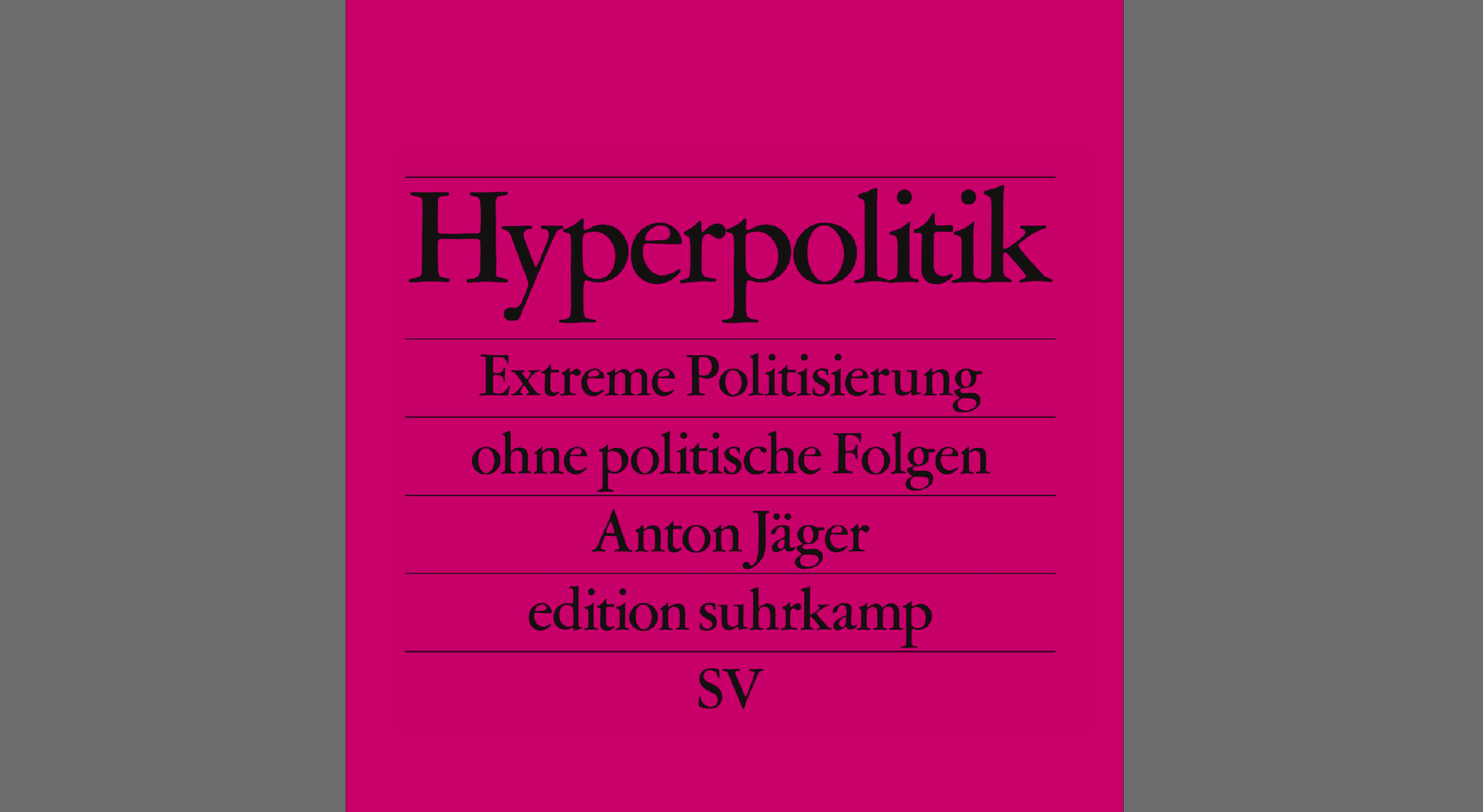
Was kommt nach der Hyperpolitik?
Die Hyperpolitisierung unserer Lebenswelt sorgt dafür, dass so gut wie alles politisiert wird. Allerdings ohne Veränderungen der Lebenswelt herbeizuführen. In seinem Buch »Hyperpolitik« analysiert Anton Jäger, wie es zu diesem paradoxen Zustand kam. Wie der Zustand überwunden werden kann, bleibt jedoch eine offene Frage, schreibt Julia Werthmann.
Man hat sich bereits an den Rhythmus gewöhnt. Etwas passiert: ein grausamer Fall von Polizeigewalt etwa. In Folge werden soziale Medien mit Solidaritätsbekundungen geflutet, vielleicht schwappt der Protest auf die Straße über. Für einen Moment hat es den Anschein, als würde sich etwas bewegen, Gesetze und Abläufe verändert. Aber zwei Wochen später hat sich die Aufregung gelegt und passiert ist: genau nichts. Alles bleibt beim Gleichen. Nach einer kleinen Verschnaufpause rollt die nächste Welle an. Dieser triste Lauf der Politisierungsgezeiten ist so gewöhnlich, dass man ihn kaum zu erkennen vermag. Occupy Wallstreet, Black Lives Matter und auch der Klimabewegung erging es zuletzt so. Um das Gewöhnliche sichtbar zu machen, hat Anton Jäger dem Phänomen ein Buch gewidmet und es Hyperpolitik getauft. Diese ist „dynamisch und intensiv, sie polarisiert, bleibt inhaltlich aber relativ diffus.“ Und allem voran, so Jäger: folgenlos.
Welcome to Postpolitics!
In seinem schmalen, pinken Suhrkamp-Band unternimmt der belgische Ideenhistoriker, sich seiner Kühnheit durchaus bewusst, den Versuch einer Gegenwartsdeutung: „Wie eine Hochgeschwindigkeitskamera läuft auch die Zeitgeschichte Gefahr, der Fluidität und Unbestimmtheit der Situation, die sie einzufangen versucht, zum Opfer zu fallen, eingefroren zwischen impressionistischen Details und zu grober Abstraktion.“ Und dennoch erkennt er durch die Hochgeschwindigkeitskamera ein „Schema politischer Formen“, das die westliche Welt seit dem späten 19. Jahrhundert durchlaufen habe: von der Massenpolitik über die Post- und Antipolitik bis hin zur Hyperpolitik. Diese Geschichte erzählt Jäger mehr oder minder chronologisch in vier Kapiteln, greift auf Zahlen und Theorien zurück, ohne sich zu sehr in Fachdebatten zu verstricken. Ist sein Anliegen doch, ein bigger picture freizulegen. Politisierungsgrad und Organisiertheit seien die zwei Dimensionen des Bildes, die im Verlauf der vier Stadien variieren. Seine Beobachtung ist folgende: Während die Gesellschaft der Massenpolitik gleichermaßen politisiert wie organisiert war, so stecken wir heute in einer Situation permanenten Streits ohne institutionelle Folgen fest. Heraus kommt das Paradox eines beschleunigten Stillstands.

Julia Werthmann
Wie konnte das passieren? Der Ideenhistoriker beginnt seine Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts. Eingewoben in lebensweltlich und ideologisch konsistente Milieus ringen sozialistische Arbeiter und konservative Kapitalisten um die Macht. Ab den 1970er Jahren, spätestens mit dem Ende der Sowjetunion bröckelt diese Konstellation. Nicht nur pluralisieren sich politischen Anliegen. Die Politik, oder um mit Francis Fukuyama zu sprechen die Geschichte, scheint an ihrem Ende angelangt. Anstatt sich in Parteien zu engagieren, wird das Private zentraler: Konsumismus schlägt Kommunismus. Das wird nicht zuletzt davon vorangetrieben, dass ausgetrocknete Parteiapparate sich von der Basis entfremden und neoliberale Politikerinnen wie Margret Thatcher die Gewerkschaften schwächen. An ihre Stelle treten Technokraten und mitgliederarme NGOs. Welcome to postpolitics!
Der progressiv-neoliberale Fortschrittskonsens der „langen Neunziger“ gelangt mit der Finanzkrise 2008 und den ihr folgenden Austeritätspolitiken jedoch an ein jähes Ende und gebiert die populistischen Mobilisierungswellen der 2010er Jahre: von Occupy Wall Street etwa. Damit, so Jäger, ist die Politik jedoch nicht aus ihrem Winterschlaf zurückgekehrt. Zwar wehrte man sich gegen undemokratische Hinterzimmerdeals, ohne aber selbst auf Veränderungen hinzuwirken. Die Wut der 2010er Jahre verlief sich großteils im Sand, lehnten die Bewegungen doch Institutionen an sich ab. „Antipolitik war eine Politik gegen eine Politik, die keine war“, resümiert Jäger. Eine Einschränkung nimmt er jedoch vor: Rechte wie Trump hätten es besser geschafft, die Wut in politische Projekte zu überführen.
Was kommt nach der Hyperpolitik?
Heute, so Jäger, befinden wir uns in der letzten, zentralen Phase der Hyperpolitik. Sie ist die widersprüchlichste. Einerseits ist alles politisiert. Ob in Kunst oder auf der Firmenfeier nirgends findet man noch gänzlich unpolitische Räume. Oder wie Jäger die amerikanische Journalistin Sarah Jones passend zitiert: „Die Leute, die früher Katzenvideos im Internet geteilt haben, teilen jetzt schrille politische Memes“. Und zeitgleich nimmt der Organisationsgrad politischer Kämpfe weiter ab. Wo die 2010er Proteste noch, wenn auch erfolglose, Parteiprojekte wie SYRIZA oder Podemos hervorbrachten, da seien es heute schwarmvernetzte Internetcommunities, die sich eruptiv mobilisieren. Zwar wird versucht, „diese Schwärme vorübergehend zu choreographieren“, stellt Jäger fest. „Doch eine solche Choreografie ist nicht gleichbedeutend mit dauerhafter Organisation.“ Feste Mitgliederlisten, Permanenz und ein gewisses Maß an Anhängerdisziplin – mit all diesen Basics des Organisations-ABC hätten gegenwärtige Bewegung dem Ideenhistoriker zu Folge bereits zu kämpfen.
Jäger zieht folgenden Schluss aus diesem Ritt durch die Geschichte: Die Erosion des Sozialen führt zu politischer Volatilität, die wiederum eine Unmöglichkeit kollektiven Handelns bewirkt. Geraten solcherart verfasste Gesellschaften in Krisen wie die aktuelle Inflation oder die Klimakrise entwickelt sich ein handfestes Dilemma. Namentlich die „Unfähigkeit, kollektiv auf politische und ökologische Herausforderungen zu reagieren.“ Und nun? Jäger meint: Zurück in die Organisationen. Seine Antwort wirkt etwas hilflos, vermag doch auch er nicht zu sagen, wie die Sisyphos-Aufgabe zu bewerkstelligen ist. Hinzu kommt, dass er an vielen Stellen die Gefahren der von ihm vermissten Institutionalisierung anspricht: Etwa die Tendenz von Parteien, sich in Selbstbezüge zu verlieren oder sich gegenüber neuen Impulsen zu immunisieren.
Ratsam wäre deshalb, die Debatte dort weiterzuspinnen, wo der Ideenhistoriker uns ratlos entlässt. Weicht er doch einer Frage aus, auf die seine Analyse schnurstracks zuführt. Und das wohl konsequenterweise, ist es doch keine historisch zu beantwortende Frage, sondern eine offene Frage der politischen Praxis. Sie lautet: Wie müssten Institutionen geformt sein, die Menschen auf eine Weise organisieren, dass sie kollektiv handlungsfähig werden, ohne dabei den Fallstricken der elitären Erlahmung anheimzufallen? Gefragt wird nach einer beweglichen und selbstreflexiven Organisation. Sie muss so organisiert wie nötig und bewegt wie möglich sein. Anton Jäger hat den Boden für die Suche bereitet.
 Lesezeit 5 Minuten
Lesezeit 5 Minuten





