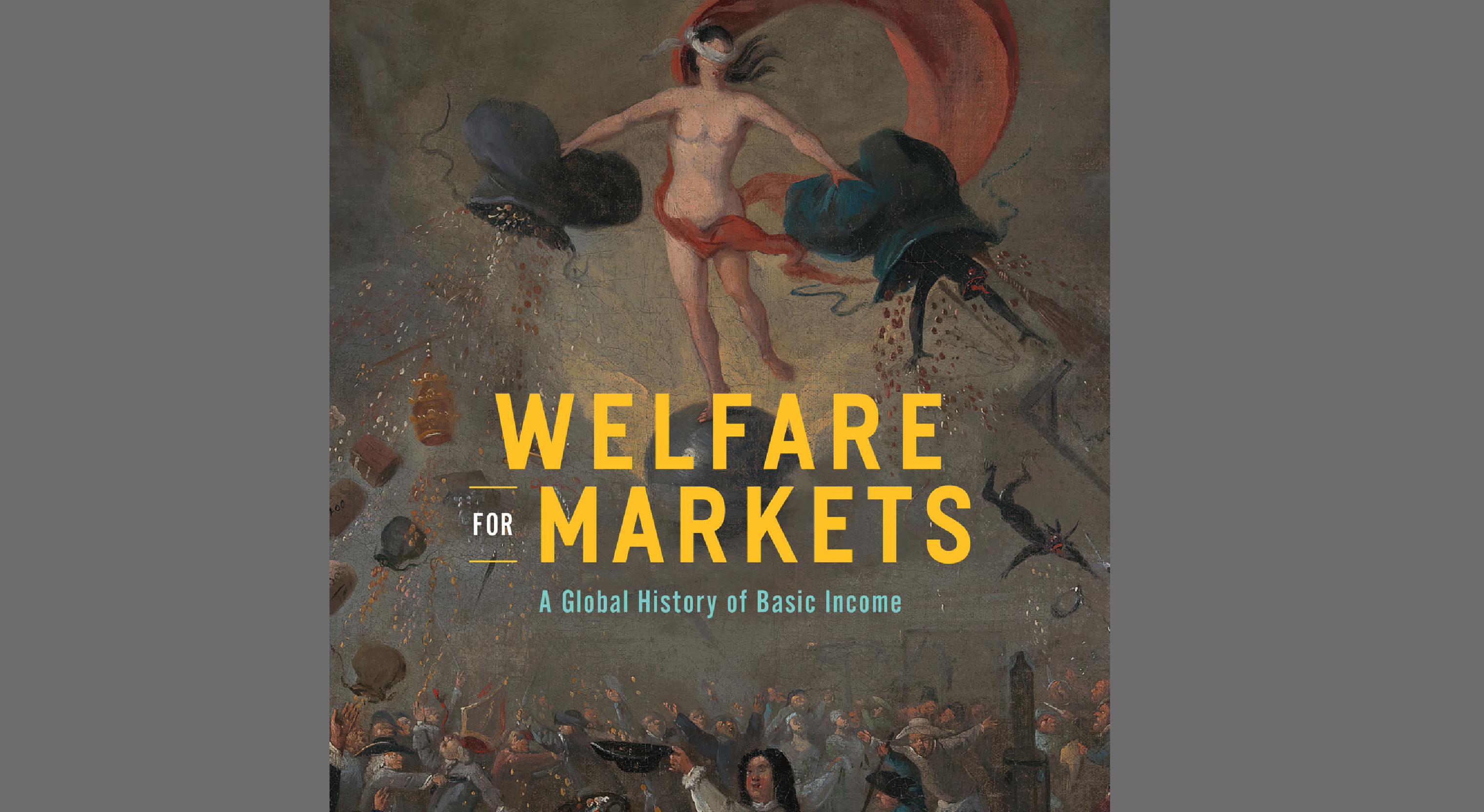
Eine andere Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens
In ihrer globalen Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommen arbeiten Anton Jäger und Daniel Zamora Vargas sich an wohlbekannten Dichotomien ab: Markt und Staat, links und rechts, neoliberal und sozialstaatlich. Das Ergebnis ist eine widersprüchliche Gegenwart mit einer genauso widersprüchlichen Linken – und einem widersprüchlichen Politikvorschlag.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist längst keine Nischenidee mehr. Eine ungewöhnlich durchmischte Koalition von Akteuren propagiert den Vorschlag als nächsten notwendigen Schritt, um den Sozialstaat an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Rechte fokussieren sich auf die Möglichkeit den Sozialstaat zu flexibilisieren und die »aufgeblähte« Bürokratie abzubauen. Linke wollen einer antiquierten Arbeitsmoral den Rücken kehren und durch ein bedingungslose Grundeinkommen – das idealerweise mit einer Automatisierung der Arbeitswelt einhergeht – mehr Freiheit von materiellen Zwängen ermöglichen.
Befürwortende des Grundeinkommens – von Silicon-Valley-Milliardären bis zu Neo-Marxisten – präsentieren ihre Idee oft als unkonventionell und heterodox. Seine Bedingungslosigkeit sei zum Beispiel gegen die meritokratische Vorstellung gerichtet, dass »nichts von nichts kommt«. In ihrer Ideengeschichte Welfare for Markets (erschienen bei University of Chicago Press, 2023) zeigen Anton Jäger und Daniel Zamora Vargas jedoch, dass das bedingungslose Grundeinkommen keineswegs mit dem Status Quo bricht. Ihr Beitrag begreift sich als eine »soziale Ideengeschichte«. Fragestellungen und Ideen von politischen und ökonomischen Denker:innen sind hier in einen größeren sozialen Kontext und dessen materielle Bedingungen eingebettet. Genau diese Übung entlarvt das moderne bedingungslose Grundeinkommen als eine Idee, die einen jahrhundertlangen Trend in der Art und Weise, wie wir über Markt und Staatlichkeit nachdenken, fortsetzt. Zur Abwechslung machen Jäger und Zamora nicht einseitig den Triumph der Neoliberalismus in den 1980ern dafür verantwortlich. Viele entscheidende Ideen sind nicht von außen an die politische Linke herangetragen worden, sondern auch innerhalb ihrer beheimatet. Die Geschichte des Grundeinkommen ist damit auch eine der Linken, die in ihrer Metamorphose zu dem, was wir heute die Neue Linke nennen, ihr Gesicht grundlegend veränderte.

Jan Frohn
Jäger und Zamora erzählen dezidiert eine globale Geschichte. Sie führt uns vom England des 18. Jahrhunderts, über die Vereinigten Staaten, zurück auf den europäischen Kontinent nach Frankreich, Belgien und Holland. Der globale Norden steht dabei im Austausch mit dem globalen Süden, wo das »Cashtransfer-Denken« über neue Ansätze in der Entwicklungsökonomie seine Spuren hinterlässt. Nachdem die Idee einmal um die Welt gereist ist, schlägt sie mit voller Wucht in der Gegenwart ein, welche die beiden Ideenhistoriker das Zeitalter des technopopulism nennen. Wie sich zeigen wird, ist diese Geschichte weniger teleologisch als viele Grundeinkommen-Fans es gerne zeichnen. Stattdessen ist jede Epoche von höchst unterschiedlichen Problemstellungen geprägt. Es mag anzweifelbar sein, ob von einem zusammenhängenden Ideenstrang überhaupt die Rede sein kann.
Die angeblichen Pioniere
Oft wird Thomas Paine (1737-1809) als geistiger Vater des modernen Grundeinkommens bezeichnet. Was dabei aufgrund der »teleologischen Verlockung«, die Erzählung nur vom Gesichtspunkt seines Resultates her zu begreifen, verloren geht, ist, dass Paine und seine Zeitgenossen in einer »politischen Sprache« 1 Dieser Begriff wurde von Quentin Skinner geprägt, berühmter Vertreter der »Cambridge School« der Ideengeschichte. In dessen methodologischer Tradition stehen auch Jäger und Zamora. beheimatet waren, die mit der heutigen Welt wenig gemein hat. Die frühesten »Grundeinkommen«-Vorschläge waren in der römischen Tradition um die Ackergesetze (agrarian law) formuliert. Zentral war der Glaube, dass jeder Mensch ein göttliches Recht auf ein Stück Land hat, um für die eigene Subsistenz zu sorgen. Ein »Grundeinkommen« sollte sie für dieses Recht kompensieren oder den Landerwerb ermöglichen. Damit galt es als gemäßigte Alternative zu der radikalen Forderung einer durch Enteignung vollzogenen Landreform.
Die frühen Vorschläge unterscheiden sich von den heutigen auch dadurch, dass sie selten bedingungslos oder monetär waren. Ob an anfängliche Voraussetzungen oder nachträgliche Erwartungen geknüpft, die »Grundeinkommen« dieser Zeit entsprachen nicht der Vision einer universellen Gabe ohne versteckte Klauseln. In der agrarischen Tradition gehörten zu solchen Bedingungen der Landerwerb und dessen Bewirtschaftung; im anschließenden producerism wurde von den Empfängern industrielle Arbeit gefordert. Den Beginn der Auffassung, dass Rechte auch ohne Pflichten zuteilwerden können, datieren die Ideenhistoriker erst später. Außerdem beschränkten sich die Vorschläge größtenteils auf Sachleistungen anstelle von Geldsummen. Bevor die heutige Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens plausibel erscheinen kann, mussten die alten politischen Sprachen des agrarianism und producerism die eines »souveränen Konsumenten« weichen.
Die Hinwendung zum Konsumenten, rechts wie links
In den Zwischenkriegsjahren vollzog sich eine stille Revolution auf dem Gebiet der Wohlfahrtsökonomie. Über Bedürfnisse und Nutzen wurde fortan ganz anders nachgedacht als einst von den Vätern dieser Disziplin. Für die frühe Generation um Alfred Pigou waren in Wohlfahrt noch normative Vorstellungen enthalten, wie eine gute Gesellschaft auszusehen hat. So gab es Grundbedürfnisse, die Vorrang vor anderen Lüsten hatten, und Güter, die »objektiv« nützlicher als andere waren. Wer gesunde Nahrung, Kultur oder Sport konsumierte, brachte mehr Nutzen ein als jemand, der sein Geld auf Alkohol und Glücksspiel verprasste. In der Idee, ein Ökonom (oder eine Planungsbehörde) könne vorschreiben, was richtig für uns ist, sah die neue Generation jedoch eine gefährliche Hybris. Präferenzen und Nutzen können nur im Nachhinein durch Konsumentscheidungen auf dem Markt »offenbart«, aber niemals schon im Vorhinein gewusst werden. Friedrich Hayek sah ein Unterdrückungspotential in der Anmaßung des Staates, über unsere Präferenzen Bescheid zu wissen, und warnte vor einem »Weg in die Knechtschaft«.
Die Abwendung von der Vorstellung eines planenden Staates, der die Bedürfnisse seiner Bürger:innen ordnete, wurde durch die Socialist Calculation Debate zementiert. Interessanterweise waren sich die Debattierenden in einem ganz entscheidenden Punkt einig. So wurde die Zentralität der Preisbildung auf dem Markt von der sozialistischen Seite um die Marktsozialisten Oskar Lange und Abba Lerner nie angetastet. »The end goal was to be free in the market rather than from the market« (S. 51). Der Paradigmenwechsel griff somit auch im linken Lager um sich. Es überrascht nicht, dass Ökonomen wie Lerner später Grundeinkommens-Vorschläge unterstützen, da diese eine gerechtere Verteilung ohne schwere Eingriffe in den Preisbildungsmechanismus versprachen.
Es dauerte noch bis zur Nachkriegszeit, bis das neue Denken praktische Früchte trug. Erst die Desillusionierung nach der New-Deal-Ära und die »Wiederentdeckung der Armut« durch Publikationen wie Michael Harrington’s The Other America, setzten eine Reform des amerikanischen Wohlfahrtstaats nach oben auf die Agenda. Einen der prominentesten Vorschläge, hinter dem sich rechte wie linke Ökonom:innen versammelten, machte Milton Friedman mit seiner Negative Income Tax. Wenngleich die Höhe der Zahlung noch vom Einkommen abhängt, und damit strenggenommen nicht bedingungslos ist, ist die entscheidende Neuerung zu den historischen Vorschlägen, dass die Leistung monetär erfolgt und an keine Erwartungen geknüpft ist. In anti-paternalistischer Manier können Empfänger:innen mit dieser Summe tun und lassen, was sie wollen. Mit der »Monetisierung der Armut« verliert diese ihre strukturelle Dimension und wird zum konkret überwindbaren Hindernis, wenn man nur genug Geld auf sie wirft.
Auch linke Strömungen trieben die Erosion des Nachkriegs-Wohlfahrtsstaats voran, dessen Paradigma der Vollbeschäftigung genauso überholt galt wie seine Protagonisten: Massenparteien und Gewerkschaften. Jäger und Zamora identifizieren zwei zentrale Entwicklungen innerhalb der Linken, die im Rahmen der 68er-Bewegung vor allem in Europa zu Tage traten. Erstens stellte sich ein linker anti-statism gegen alle Apparate der Herrschaft ein, egal ob in Form des Staates oder seiner parteilichen und gewerkschaftlichen Arme. Die zweite Bewegung um postwork verfolgte den Zweck, die Arbeit zu entheiligen und ein Recht auf Faulheit einzuklagen. Dieser Angriff geht weit über die Lohnarbeit hinaus und zielt auf die Zentralität der Arbeit an sich im westlichen Marxismus: der Mensch als animal laborans, die Arbeitenden als revolutionäres Subjekt. Auf bemerkenswerte Weise spiegeln diese linken Strömungen damit das andere politische Lager, welches sich ebenfalls einen schlanken Staat herbeisehnt und den Arbeitskampf – nicht nur in seiner traditionellen Form – ablehnt. Die Forderung nach einem bedingungslose Grundeinkommen ist nichts anderes als die Konsequenz dieses veränderten Staats- und Arbeitsbegriffs.
Als Vordenker dieser linken Strömungen werden neben André Gorz auch Michel Foucault herangezogen. Bereits in The Last Man Takes LSD: Foucault and the End of Revolution (erschienen bei Verso, 2021) haben Daniel Zamora Vargas und Mitchell Dean sich kritisch mit Foucault und dessen Flirt mit dem Neoliberalismus auseinandergesetzt. Es ist heute weniger bekannt, dass Foucault auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen geliebäugelt hat. Damit unterstreichen die Ideenhistoriker abermals, dass die Cash-Revolution kein Coup von rechts war. Linke Ikonen können deshalb auch nicht minder aus der Verantwortung gezogen werden.
Abschließend findet das neue Denken auch Einzug in die Entwicklungsökonomie. Dort verdrängt es das historisch vorherrschende Paradigma, welches Entwicklung und Armutsbekämpfung nur unter dem Vorzeichen der Industrialisierung und einer Umordnung der globalen Arbeitsteilung möglich sah. Politisch unbequeme Fragen über die Weltwirtschaftsordnung wichen der Auffassung, dass die Armut in den betroffenen Ländern auch isoliert von ihren strukturellen Ursachen lösbar sei. Alles, was es dafür bedurfte, waren generöse Geber (meist aus dem globalen Norden), die den „Armen“ ein Grundeinkommen spendieren.
In the Global North [the cash transfer movement] birthed and stimulated »welfare without the welfare state«; in the South it entrenched »development without development«.
Jäger, Anton / Zamora Vargas, Daniel: Welfare for Markets (2023), University of Chicago Press, S. 174
Anti bedingungsloses Grundeinkommen?
Die Änderung der politischen Sprache auf allen Seiten erklärt die breite Querfront für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie macht es gleichzeitig umso schwerer, dieses Denken wieder aus den Köpfen heraus zu kriegen. Ob so ein unlearning wünschenswert, oder sogar die eigentliche Intention des Buches ist, bleibt offen. Als Ideenhistoriker geben sich Jäger und Zamora große Mühe, keine normativen Wertungen durchdringen zu lassen. Eine tendenzielle Antipathie für das Objekt ihrer Studie können sie zwischen den Zeilen allerdings nicht verbergen. Auch scheint eine Nostalgie für das Zeitalter der Massenpolitik mit starken Gewerkschafen und Volksparteien durch, ähnlich wie in Anton Jägers Hyperpolitik (erschienen bei Suhrkamp, 2023; rezensiert auf diesem Blog von Julia Werthmann).
Der Wohlfahrtsstaat der Nachkriegsordnung war allerdings nicht für alle idyllisch. An mehreren Stellen in der Geschichte des Grundeinkommens kommen auch marginalisierte Gruppen zu Wort. Zu ihnen zählen Frauen, people of color und informell Beschäftigte. Alle haben gemeinsam, dass sie in einer rein auf formeller Arbeit basierenden Sozialordnung unter den Tisch fallen. Für sie stellt ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wirklich allen zugutekommt, einen realen Machtgewinn dar. Somit ist die Hinwendung zum Konsumenten auch eine Geschichte der Ermächtigung all derjenigen, die systematisch von der Sphäre der Produktion ausgeschlossen wurden.
Ein Zurück in die Vergangenheit kann deshalb keine Lösung sein. Wie Linke gerne in hegelianischer Manier entgegnen, kann Geschichte sowieso nie die Fahrtrichtung ändern. Die schwierige Frage, die sich nach der Lektüre dieses Buches stellt, ist wie eine Flucht nach vorn aus den Fängen des »Cashtransfer-Denkens« aussehen kann? Wie kann an den Errungenschaften der linken Bewegungen um anti-statism und postwork, die nicht zuletzt auch Zeugnis einer inklusiveren Linken sind, festgehalten werden, ohne wie Foucault der Verführung des Neoliberalismus oder der »Marktgesellschaft« zu verfallen? Dass für diese Mammutaufgabe eine weitreichende Änderung der politischen Sprache nötig ist, zeigen Anton Jäger und Daniel Zamora Vargas eindrücklich in ihrem Buch.
 Lesezeit 10 Minuten
Lesezeit 10 Minuten





