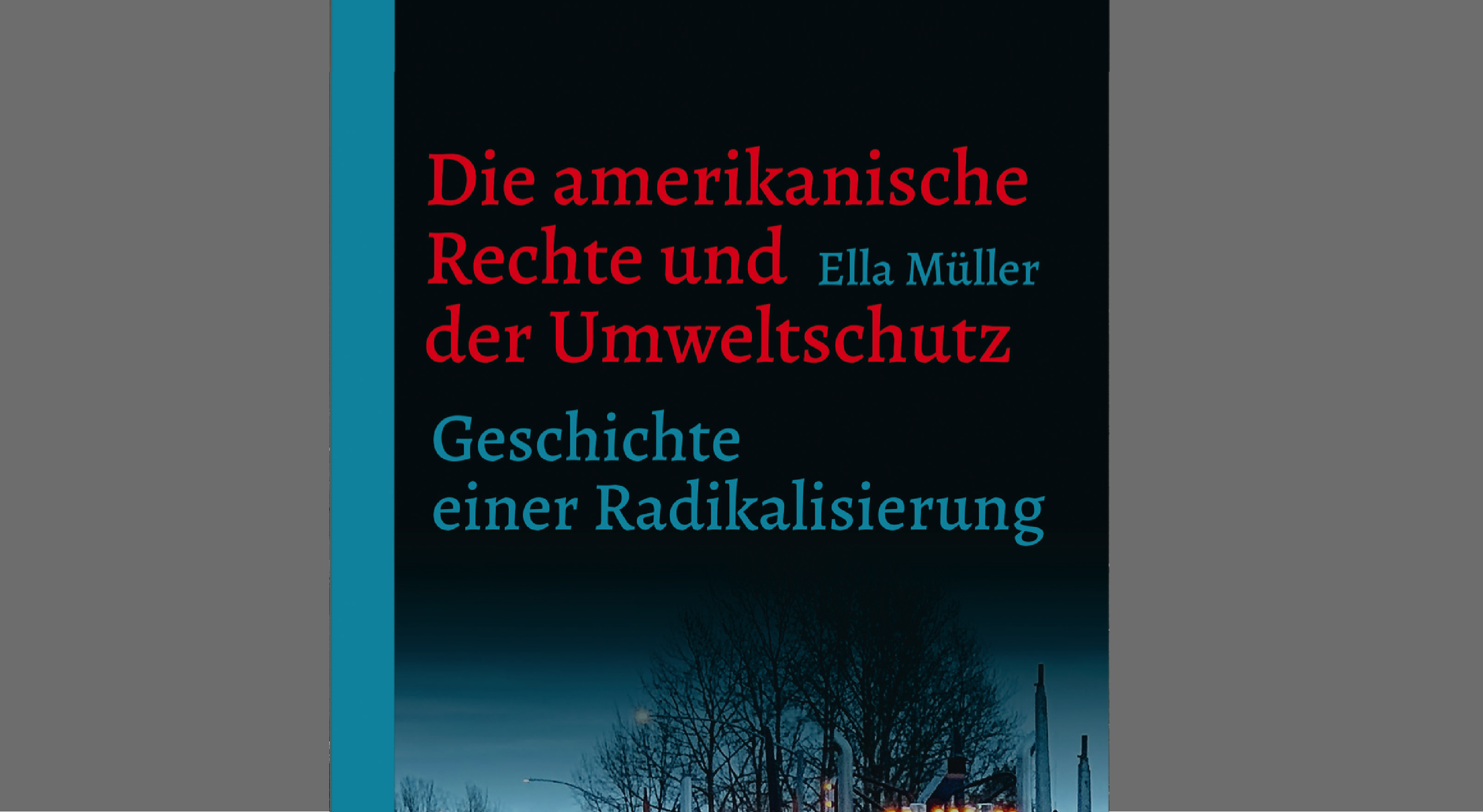Foto Stefan Eich
Stefan Eich: „Uns fehlt das politische Vokabular für eine alternative Geldtheorie“
In seinem neuen Buch »The Currency of Politics« argumentiert Stefan Eich, dass die Auseinandersetzung mit früheren Geldtheorien uns dabei helfen kann, den blinden Flecken unserer Zeit zu entkommen. Unser Herausgeber Otmar Tibes hat mit Stefan Eich über die politischen Geldtheorien von Aristoteles bis zu John Maynard Keynes gesprochen.
Herr Eich, Sie haben gerade ein neues Buch über Geld veröffentlicht. Weshalb interessieren Sie sich als politischer Theoretiker für das Thema?
Geld ist unter anderem deshalb so interessant, weil es aus der politischen Ideengeschichte heute vollkommen herausfällt. Dabei hat es in der Vergangenheit immer eine bedeutende Rolle gespielt. Politische Denker wie Aristoteles, Locke, Fichte oder Marx haben sich intensiv mit Geld auseinandergesetzt. Nicht nur mit der Frage was Geld ist, sondern auch was Geld politisch bewirken kann. So haben sie wiederum auch Vorstellungen und Ideen geschaffen, die uns bis heute prägen. Leider wird aber viel zu wenig davon gesprochen oder diskutiert.
Das heißt, dass die politische Ideengeschichte eigentlich viel zum Thema Geld zu sagen hat?
Genau. Wir gehen heute oft davon aus, dass es verschiedene und voneinander getrennte Institutionen gibt: politische und ökonomische. Diese Teilung wird dann auf die Vergangenheit projiziert, sodass es so aussieht, als sei Geld immer schon eine rein ökonomische Institution gewesen. Das ist jedoch ein Anachronismus. Tatsächlich war Geld nämlich immer beides: sowohl eine ökonomische, wie auch eine politische Institution. Kennt man aber lediglich die Debatten von heute und nicht die politische Ideengeschichte, ist das schwer nachzuvollziehen. Um dem zu entkommen, muss man studieren, wie frühere Denker über Geld nachgedacht haben. Dabei kann man dann feststellen, dass ihnen die Auseinandersetzung mit vergangenen Krisen auch schon dabei half, den blinden Flecken ihrer eigenen Zeit zu entkommen.

Stefan Eich
Was sind die blinden Flecken unserer heutigen Zeit?
Seit der Finanzkrise von 2008 leben wir in einer seltsamen Übergangszeit. Man könnte auch von einem monetären Interregnum sprechen, in welchem die alten Geldvorstellungen als neutrales ökonomisches Mittel jenseits der Politik diskreditiert sind, uns das politische Vokabular für eine alternative Geldtheorie aber weiterhin fehlt. Diese Armut unserer politischen Sprache hat direkte Folgen für den demokratischen Diskurs zur Geldpolitik selber, aber auch für unsere Fähigkeit uns mit den tiefergreifenden Fragen auseinanderzusetzen, wie ein gerechteres Geldsystem aussehen könnte.
Muss man Geld repolitisieren, um sich diesen tiefergreifenden Fragen zu stellen?
Noch produktiver als in Debatten reingezogen zu werden, ob Geld politisiert oder entpolitisiert werden sollte, sollte man sich der Herausforderung stellen, die demokratische Dimension einer gerechteren Geldpolitik klarer zu artikulieren. In meinem Buch unterscheide ich zwischen verschiedenen Arten der monetären Entpolitisierung und verweise darauf, dass Entpolitisierung in erster Linie als Entdemokratisierung verstanden werden sollte. Das setzt natürlich ein Verständnis davon voraus, dass Geld immer eine ökonomische und politische Institution gewesen ist. Die rein ökonomische Auffassung von Geld versuche ich in meinem Buch deshalb zu überkommen.
Wie haben Sie sich dieser Aufgabe genähert?
Ein Weg in das Thema für mich war, Politik sehr breit zu denken und auch Ökonomie als politische Strategie zu lesen. So lassen sich verschiedene Geldtheorien ausmachen und auch Formen der Entpolitisierung als politische Strategien verstehen. Man kann sich dabei folgende Fragen stellen: Welche Politik charakterisiert das Geld? Ist es eine Politik der Entpolitisierung oder eine Politik der Demokratisierung? In beiden Fällen ist Geld politisch, aber die politischen Folgen sind radikal unterschiedlich. Um das historisch aufzuziehen, habe ich mir insbesondere die politischen Denker angeguckt, die einen besonderen Einfluss auf die politische Geldgeschichte hatten und zu deren Texten spätere Denker immer wieder zurückkehrten. Angefangen habe ich bei Marx, der ja in seinen Texten sehr oft auf frühere geldtheoretische Denker verweist, wie zum Beispiel auf Aristoteles und Locke. Ich bin seinen Verweisen nachgegangen und so, wie durch ein Wurmloch, durch die Zeit gereist.
Ein wichtiger Ausgangspunkt in Ihrem Buch ist Aristoteles.
Ja, Aristoteles war zumindest bis ins 19. Jahrhundert ein fundamentaler Denker für alle, die sich mit Geld beschäftigt haben. Bemerkenswerterweise spielt er für zwei konträre Positionen eine große Rolle: Einerseits für orthodoxe Geldtheoretiker, die Geld als rein ökonomische Institution darstellen und dies auf mehrere Passagen im ersten Buch der Politik zurückführen. Andererseits aber auch für Denker, die Geld als konventionelle politische Institution verstanden haben. Dieses Verständnis wird gewöhnlich auf das fünfte Buch der Ethik zurückgeführt. Dort wird Geld als Mittel verstanden, das in politischen Gemeinschaften wechselseitige Verbindungen unter den Bürgern schafft und diese Verbindungen auch stärken kann. Unter anderem weil es ein Regierungsmittel ist, das die Polis nutzen kann, um nach Gerechtigkeit zu streben. Das bloße Anhäufen von Geld gefährdet hingegen dieses Ziel, weshalb man auch kein tugendhafter Bürger sein kann, wenn man Geld bloß um des Geldes willen anhäuft. Diese Position ist zunächst weit einflussreicher als die orthodoxe Lesart. Zumindest in der Antike und dann auch wieder in der Wiederentdeckung von Aristoteles im Mittelalter und in der Renaissance. Die vielen Verweise, die sich dort finden, etwa bei Thomas von Aquin sowie der islamischen Tradition, berufen sich immer wieder auf das fünfte Buch der Ethik.
Interessanterweise hat Aristoteles das Wort „Nomisma“ für Geld verwendet. Das bedeutet gerade nicht Münze, sondern ist eine Derivation von Nomos, also Gesetz. Geld ist also das durch den Gebrauch und die Sitte Anerkannte, könnte man sagen?
Das Wort für Münzgeld — „nomisma“ — verweist in der Tat erst einmal auf eine Institution, die durch unsere kollektive Vorstellungskraft existiert. Wie der neue Rechtsbegriff — „nomos“ — handelt es sich also nicht um eine Institution, die durch einen Gott oder durch die Natur extern gesetzt ist, sondern stattdessen unsere eigene Fähigkeit zum kollektiven Handeln wiederspiegelt. Wie beim Recht beinhaltet diese Sichtweise allerdings auch für das Münzgeld eine fundamentale Ambivalenz: Sind es Sitte und Tradition, die den Wert bestimmen? Oder kann das bewusste kollektive Handeln der politischen Gemeinschaft selber den Wert verändern? Diese Ambivalenz zieht sich durch die gesamte Rezeption des Geldes als konventionelle politische Institution.
Und wann schlägt die Rezeption in die andere Richtung um?
Erst in der frühen Neuzeit, vor allem nach dem 17. Jahrhundert. Hier werden wieder Passagen aus dem ersten Buch der Politik wichtig, in der Geld über lange Zeit als Institution kommerziellen Handels verstanden wird, die eng an Gold oder Silber geknüpft ist. Das ist eine interessante Veränderung, die mit der wirtschaftlichen und kolonialen Expansion der Neuzeit zu tun hat. Aus dieser Konstellation entspringt auch unsere moderne Vorstellung des Geldes und damit auch der Kapitalismus.
In der frühen Neuzeit hat sich der englische Philosoph John Locke mit Währungsfragen auseinandergesetzt. Er gilt als Verfechter des harten Geldes. Also von Geld, das aus reinem Silber oder einem anderen Edelmetall hergestellt wird.
Locke hat einen enormen Einfluss auf die moderne Geldtheorie. Allerdings hat genau dieser Einfluss Lockes tatsächliche Position lange verdeckt. Durch ihn hat sich die Doktrin des ’sound money‘, des harten Geldes, durchgesetzt. Später, im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert, wird Locke von Wirtschaftsliberalen dann als Verfechter des harten Geldes gefeiert. Aus dieser Sicht wird er oft als Vertreter einer rein ökonomischen Sichtweise gepriesen. Also als jemand, der Geld in den Raum des ökonomischen Denkens stellt und den Fängen des Staates entreißt. Für mich verdeckt diese Rezeption aber gerade das, was Locke am interessantesten macht. Er ist aus meiner Sicht ein viel paradoxerer Denker, als die Rezeption einem vor Augen hält.
Inwiefern?
Er selbst versucht gar nicht Geld in den ökonomischen Raum zu verfrachten. Er entwickelt vielmehr eine politische Theorie, die Geld gegenüber dem Souverän isolieren möchte, allerdings weil Geld eine so zentrale politische Rolle für den Staat spielt. Man könnte auch sagen: Geld ist eine so wichtige politische Institution, dass der Staat extrem vorsichtig sein muss, wenn er mit dem Geld oder dem Wert des Geldes herumspielt. Es geht Locke also nicht darum, Geld aus der Politik in die Ökonomie zu überführen. Sein Argument, das weiter auf aristotelischen Prämissen beruht, ist vielmehr, dass Geld eine konventionelle Institution ist, die absolut zentral für den modernen Staat ist. Dann dreht Locke die Konklusion aber um und argumentiert, dass genau aus diesen beiden Gründen — weil Geld eine fragile, konventionelle Institution ist, die aber gleichzeitig essenziell für einen funktionierenden politischen Staat ist — vor dem politischen Zugriff geschützt werden muss.
Locke war also kein Lockianer?
So könnte man das sagen. Erst in der Rezeption wird das Ganze als eine Naturalisierung bzw. eine Ökonomisierung des Geldes verstanden. Und das ist der tatsächliche Effekt der Theorie im 18. und 19. Jahrhundert. Aber die Rezeptionsgeschichte verpasst, dass Locke eine politische Theorie des Geldes entworfen hat. Man könnte auch von einer spezifischen Art der Entpolitisierung sprechen. Nämlich einer Entpolitisierung, die Geld eng an den Staat bindet, aber die Hände des Staates selbst bindet. So hat Locke versucht Geld auf ein vorheriges Versprechen des Staates zurückzuführen: Nämlich darauf, wie viel das Geld wert ist. Das ist zutiefst politisch, und hat gleichzeitig den Effekt einer Politik der Entpolitisierung, die sich gegen die Fähigkeit des Staates stemmt, den Wert arbiträr zu verändern.
In welchem historischen Kontext kam Locke denn zu dieser Einschätzung?
Lockes geldpolitische Schriften stammen vor allem aus der Zeit nach der Glorious Revolution. Also einer hochpolitischen Zeit, in der das parlamentarische Regierungssystem und der neue König noch nicht gefestigt waren. In dieser Zeit herrschte eine dramatische Geldknappheit, weshalb Menschen das Silbergeld an den Rändern heimlich abzuschleifen und abzuknippsen begannen. Die abgeschliffenen Münzen wurden danach wieder in Umlauf gebracht und der gewonnene Silberwert verkauft. In der Mitte der 1690er Jahre hatten die zirkulierenden Münzen dann die Hälfte ihres ursprünglichen Silbergehalts verloren. Jede Transaktion forcierte deshalb die Frage, ob der Wert einer Münze durch das königliche Siegel oder durch den Metallinhalt bestimmt ist. Als die daraus resultierende Unsicherheit zu groß wurde, musste die Regierung einschreiten. Locke argumentierte gegen den Plan, die Münzen einzuschmelzen und sie dann mit einem geringeren Silberanteil neu zu prägen. Stattdessen plädierte er dafür, die Münzen nach ihrem Einschmelzen zum vollen Silbergehalt neu auszugeben. Das Problem lag also nicht in der Geldknappheit für Locke, sondern in der Vertrauensfrage. Er befürchtete, dass die Neuprägung mit geringerem Silbergehalt das Vertrauen in die Regierund und den Staat untergraben würde. Das galt es unter allen Umständen zu verhindern, wie er glaubte. Auch um den Preis einer höheren Geldnot.
Es ging Locke also weniger um hartes Geld, als um die Integrität der Währung bzw. des Staates?
Genau. Generell ist „hartes Geld“ aber auch ein sehr gutes Beispiel für die paradoxe Qualität modernen Geldes. Die Politik des modernen Geldes ist am erfolgreichsten, wenn es ihr gelingt, ihre eigene politische Qualität zu verdecken. Unser Ziel sollte dementsprechend sein, dieser vermeintlichen Naturalisierung zu entkommen. So können wir Locke auch auf Augenhöhe begegnen und ihm politische Argumente entgegenhalten. Wenn wir die Rezeptionsgeschichte allerdings unkritisch übernehmen, sind wir in einer irreführenden Unterscheidung zwischen Geld als politischer Institution im Gegensatz zu Geld als vermeintlich natürlicher, ökonomischer Institution gefangen. Dem müssen wir entkommen, weil auch die Position des harten Geldes eine politische Position ist, die man debattieren kann und in eine andere politische Richtungen lenken kann.
100 Jahre nach Locke hob die britische Regierung die Goldbindung auf und führte Fiatgeld ein. Der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte sah darin eine politische Chance, die alten europäischen Monarchien in stabile Republiken zu verwandeln.
Ja, die lockesche Lösung war eine provisorische. Im Kontext des postrevolutionären Englands stabilisierte sie eine sehr fragile Situation. Aber für viele Denker im 18. Jahrhundert und vor allem für Fichte war klar, dass Lockes Antwort nicht der Weisheit letzter Schluss war. Stattdessen blieb die Frage, wie genau das Verhältnis zwischen Staat und Geld gestaltet werden konnte. Mit anderen Worten: Was kann eine moderne Geldtheorie für einen modernen Staat leisten? Fichte ist da, glaube ich, sehr beeindruckt von den Möglichkeiten des Papiergeldes. Zum ersten Mal wird Papiergeld im Rahmen der Amerikanischen Revolution benutzt. Dann taucht es im Rahmen der Französischen Revolution durch die Assignaten wieder auf. Diese beiden Experimente sind eng mit dem Problem des Preisverfalls verknüpft. Das Beispiel, das deshalb viel relevanter für Fichte ist, ist das englische Experiment zwischen 1797 und 1821. Im Kampf gegen die napoleonischen Truppen setzte England im Frühjahr 1797 die Goldbindung aus und wechselte für 21 Jahre vom Gold- zum Papiergeld. Für Fichte gibt diese Zeit ein positives Beispiel für die unausgenutzten Möglichkeiten des modernen Fiatgeldes ab. Er überlegt deshalb, wie Fiatgeld auch für andere Zwecke eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel für die Republikanisierung des Staates, aber eben auch um einen Sozialvertrag im ökonomischen Raum zu schaffen. Es geht ihm um die Frage, wie man die Geldtheorie und die neuen Technologien des Geldes nutzen kann, um die ökonomische Dimension des Sozialvertrags zu erfüllen und das beinhaltet für ihn auch ein allgemeines Recht auf Arbeit.
Das ist schon sehr modern gedacht.
Absolut. Fichte beschreibt das Handeln des Staates bereits auf eine Art und Weise, die nahezu identisch mit der Vorgehensweise zeitgenössischer Zentralbanken ist. Das Ziel ist hier nicht einfach, inflationär Geld zu drucken und so das Recht auf Arbeit umzusetzen. Vielmehr ist der Staat bei Fichte darum bemüht, den Wert des Geldes stabil zu halten. Fichtes Kritik am Metallgeld ist nämlich, dass Metallgeld nicht in der Lage ist, den Wert des Geldes stabil zu halten. Vielmehr bleibt der Wert dem schwankenden Weltmarkt für Gold und Silber überantwortet. Dieser kann in manchen Zeiten inflationär und in anderen deflationär sein. Fichtes rationaler Staat — genau wie moderne Zentralbanken — hat hingegen den Auftrag, den Wert der Währung stabil zu halten und seine Bürgerinnen und Bürger zu verpflichten, ihre Steuerschulden in eigener Währung zu tilgen. Diese Vorstellung einer modernen Zentralbank taucht erst in den Zwischenkriegsjahren des 20. Jahrhunderts bei Keynes wieder auf.
Bevor wir auf Keynes zu sprechen kommen, wollte ich noch auf Marx eingehen. In der Analyse des Kapitals taucht Geld als Akkumulationsmittel auf. Die Formel der Akkumulation beginnt und endet mit Geld: G-W-P-W-G‘. Eine Reform des Geld- und Kreditwesens stand Marx aber eher kritisch gegenüber. Warum?
Es gibt da eine interessante Linie von Fichte zu Marx: Fichtes Vorschlag zur Republikanisierung des Geldes taucht immer wieder im Laufe des 19. Jahrhunderts auf, zum Beispiel im Kontext der utopischen Sozialisten oder auch in republikanischen Debatten. Diskutiert wird da die Idee — und man darf hier an Proudhon denken —, die Armut und Ausbeutung des Tauschhandels durch eine Reform des Kreditwesens zu überwinden. Letztlich ging es um die Gründung einer neuen Art von Bank, die Geld auf Grundlage eines republikanischen Prinzips zur Verfügung stellt. Marx hält diese Idee für naiv und bleibt skeptisch. Schon in seinem ersten Buch zu Proudhon („Das Elend der Philosophie“), aber dann auch als Journalist in den 1850er Jahren, setzt er sich detailliert mit Fragen zur Geldreform und den Abläufen im englischen Geldwesen auseinander. Gleichzeitig studiert er die Innovationen im französischen Bankwesen und interessiert sich vor allem für die Crédit Mobilier, einer neuen Art von Bank, die man wohl als Hedgefond bezeichnen könnte. Dieses Wissen hat er genutzt, um die Geldreformvorschläge der französischen Utopisten zu kritisieren. Aus seiner Sicht gingen diese der Illusion auf den Leim, dass eine Reform des Geldwesens ausreicht, um die ökonomischen Produktionsverhältnisse zu verändern. Das ist aus Marx‘ Sicht so nicht möglich. Eine Geldreform ohne eine Veränderung der darunterliegenden Produktionsverhältnisse ist deshalb eine Illusion.
Im Manifest der Kommunistischen Partei trat Marx aber selbst für eine Demokratisierung des Kreditsystems ein.
Im Manifest ist eine der Forderungen tatsächlich die Zentralisierung des Kredits durch eine Staatsbank. In seiner Korrespondenz aus den frühen 1850er Jahren finden sich Diskussionen über die Rolle einer solchen Bank in der ersten Phase einer Revolution. In den darauffolgenden Jahren distanziert sich Marx aber von der Nationalisierung des Kredits. Im Laufe der 1850er Jahre arbeitet er seine ganze Geldtheorie um und beruft sich nicht mehr auf Ricardo, sondern auf die sogenannte Banking School und vor allem auf Thomas Tooke. Im Prinzip hat er den Begriff des Kapitals aus dieser Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Geldtheorie entwickelt – als Kritik sowohl an den utopischen Forderungen einer sozialistischen Geldreform, aber auch an der zeitgenössischen britischen Währungsreform, die bewirken sollte, Krisen durch ein besseres Geldsystem abzuschaffen. Genau dort sagt Marx: „Kapitalistische Krisen durch Geldreform abschaffen? Das ist unmöglich!” Es ist die Kehrseite desselben Arguments, das er mobilisiert, um die sozialistischen Reformvorschläge von Robert Owen und den französischen Utopisten zu kritisieren.
Springen wir ein paar Jahrzehnte nach vorne. Rüdiger Dornbusch, ein einflussreicher Ökonom vom MIT, formulierte im Jahr 2000, dass es in den „letzten 20 Jahren, seit dem Aufstieg unabhängiger Zentralbanken, darum ging, die Prioritäten richtig zu setzen, demokratisches Geld loszuwerden, das immer kurzsichtiges, schlechtes Geld ist.“
Das führt uns in die 1970er Jahre und die Debatten über das Fiatgeld, das nach dem Ende von Bretton Woods komplett von Gold oder Silber abgekoppelt ist. Diese Debatten wurden hart ausgefochten, unter anderem weil es um radikal unterschiedliche Optionen ging. Allen Teilnehmern war klar, dass die neue Politik des Fiatgelds nicht nur innenpolitische Herausforderungen brachte, sondern auch global neue demokratische Fragen aufwarf. Auf der einen Seite standen Leute wie Hayek, die eine komplette Privatisierung des Geldes — eine „Entnationalisierung“ des Geldes — forderten. Auf der anderen Seite gab es die Forderung, eine neue geldpolitische Verfassung zu beschließen, um ein gerechteres Geldsystem zu schaffen. In diesem sollten die Risiken und Kosten dann gerecht verteilt werden. Gerade Länder wie Tansania und Jamaika, die gerade IWF-Darlehen mit strukturellen Anpassungspflichten erhalten hatten, forderten in den späten 1970er Jahren eine globale Debatte zum internationalen Geldsystem. Die meisten dieser dekolonisierten Länder hatte es ja zu Zeiten von Bretton Woods noch gar nicht gegeben.
Und wie ist diese Debatte damals ausgegangen?
Die Schuldenkrise zu Beginn der 1980er Jahre hat die Forderung nach einer gerechten internationalen Verteilung radikal untergraben. Das Geldsystem, das sich in den 1980er Jahren stattdessen herauskristallisierte, war geprägt durch eine neue Politik der Entpolitisierung, die durchaus an Locke erinnert. Für die Leute, die das neue System aufgebaut haben, Paul Volcker zum Beispiel, war klar, dass Geld nie schlicht entpolitisiert werden kann in dem Sinne, dass es außerhalb von politischem Handeln steht. Dafür war sich Volcker seiner eigenen Macht viel zu bewusst. Es ging also genau nicht um eine Entpolitisierung, sondern um eine Entdemokratisierung des Geldes. Das heißt, die Politik verschwindet nicht, sondern die Politik wird auf einzelne Akteure konzentriert, die von den späten 1980er, frühen 1990er Jahren dann in unabhängigen Zentralbanken vom demokratischen Prozess abgeschottet sitzen und dort Macht ausüben. Aber eben so, wie Rüdiger Dornbusch das selber ganz präzise sagt: Indem sie Geld gegen Demokratie abschirmen. Aus dieser Perspektive ist demokratisches Geld immer schlechtes Geld.
Da könnte man schon einmal fragen, ob das eine demokratisch legitime Sichtweise der Dinge ist?
Wir kommen da schnell zu fundamentalen Fragen der Demokratietheorie, nämlich ob ein repräsentativer, nicht gewählter Fürsprecher besser in der Lage ist, allgemeine Interessen zu vertreten als der demokratische Prozess? Das ist eigentlich eine ziemlich steile These. In vielen anderen Bereichen des politischen Lebens würden wir eine derartige Behauptung nicht tolerieren. Im Rahmen der Zentralbanken haben wir sie aber akzeptiert. Doch sind Zentralbanker wirklich besser in der Lage, das Allgemeinwohl zu vertreten, indem sie sich vom demokratischen Prozess abschotten? Das ist eine radikale Behauptung und ich glaube, diese Frage zu diskutieren ist viel wichtiger als darüber zu sprechen, ob Geld politisiert werden sollte und wie wir der Entpolitisierung des Geldes gegenüberstehen. Geld wurde nie entpolitisiert. Was als Entpolitisierung erscheint, ist selber eine bestimmte Form der Politik. Was die Zentralbanker also verfechten, ist eine Entdemokratisierung des Geldes und an diesem Grundsatz muss man ansetzen mit fundamentalen Fragen der Demokratietheorie. Auch sollte man sich hier nicht alleine auf die Entscheidung über Zinssätze fokussieren. Letztendlich sind das wahrscheinlich die langweiligsten Entscheidungen der Zentralbanken, die hier relevant sind. Vielmehr sollte man über Fragen diskutieren, die das Geldsystem selber betreffen. Also: Wie sollten wir Preisstabilität verstehen? Beinhaltet Preisstabilität auch Mieten oder Hauspreise? Wer hat da Zugang zu Liquidität und wer hat keinen Zugang zu Liquidität? Das sind alles Fragen der Geldpolitik, die wenig mit Zinsen selber zu tun haben, die aber zurzeit von Zentralbankern abgeschottet diskutiert werden.
Für die Diskussion stellen Sie in Ihrem Buch auch unterschiedliche Optionen der Politik vor.
Ein Großteil des Buchs ist dem Ziel verschrieben, verschiedene Optionen zu kartieren und aufzuzeigen, wie wir die Landschaft des politischen Denkens über Geld navigieren können. Da ist John Maynard Keynes sehr wichtig, weil er nicht einfach existierende Positionen adoptiert, sondern ganz explizit versucht, verschiedene Optionen — auch solche, die sich auf den ersten Blick widersprechen — miteinander zu verbinden. Keynes war ein Meister darin, anscheinend widersprüchliche Positionen miteinander zusammenzudenken. Also eine Verbindung von Geld mit sozialer Gerechtigkeit und der Vorstellung von Entpolitisierung bzw. Liberalisierung zu verknüpfen. Oder eine Vorstellung der Regulierung des Investments mit einer Vorstellung des Arbeitsmarktes zu kombinieren, der relativ frei von staatlicher Intervention ist. Oder eine Vorstellung von souveränen Staaten mit einem supranationalen Währungssystem zu verbinden, in das diese Staaten eingebettet sind. Das heißt hier wird nicht einfach im Modus ‚entweder oder‘ gedacht, sondern in der Kombination aus Positionen, die auf den ersten Blick in unterschiedliche Richtungen zeigen. Das macht einen enorm produktiven Denker aus. Jemand, der wirklich kreative Vorschläge vorbringen kann, zum Beispiel wie man das Geldwesen neu gestalten kann und gleichzeitig vor der Illusion warnt, dass eine Umstellung des Geldwesens alleine die Lösung bereithält. Das erfordert nicht nur eine reformierte Zentralbank, sondern auch eine breitere soziale Regulierung des Investments.
Das ist auch eine Art von dialektischem Denken: Verschiedenes wird zusammengedacht, anstatt nur in Opposition zueinander.
Absolut. Als ich angefangen habe Keynes zu lesen, hat mich das erstmal irritiert. Es war für mich problematisch, weil er keine Position vertrat, die anderen entgegen gesetzt war. Stattdessen verweigerte er sich dem. Eine interessante Art und Weise, darüber produktiv nachzudenken, habe ich dann bei Albert Hirschmann gefunden. Hirschmann kartiert in seinen Büchern auch oft und verweist dann auf verschiedene Optionen. In fast demselben Schritt warnt er aber auch, dass einzelne Positionen niemals im Modus von ‚entweder oder‘ gedacht werden müssen, sondern dass die wirklich interessantere Frage ist, wie man verschiedene Sachen miteinander kombinieren kann. Gerade für eine Krise kann ein solches Denken enorm produktiv sein. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, warum Keynes zu dem Krisendenker schlechthin geworden ist. In seinem Buch „In The Long Run We Are All Dead” hat Geoff Mann das Denken von Keynes und des Keynesianismus als Krisendenken dargestellt und ich glaube, dass das genau diese dialektische Qualität fasst. Gleichzeitig aber sollte dieser Fokus auf das Krisendenken nicht dazu führen, dass wir Keynes‘ langfristiges Denken und seine unrealisierten Vorstellungen, wie zum Beispiel seine Pläne für eine supranationale Währung aus den Augen verlieren. Die stammen natürlich selber aus Krisen, aber sie entfliehen diesen Krisen auch gleichzeitig. Die Vorschläge, mit denen Keynes nach Bretton Woods gereist ist und die in Bretton Woods größtenteils von den USA abgelehnt wurden, haben weiterhin eine große zeitgenössische Bedeutung für uns.
Bretton Woods wird oft als ein keynesianisches Modell aufgefasst. Dabei stand der Entwurf, der sich durchgesetzt hat, im konträren Gegensatz zu dem, was Keynes selbst auf der Konferenz vorgeschlagen hat. Glauben Sie, dass der Keynesianismus heute vor einem Comeback stehen könnte?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist es ziemlich ernüchternd, wenn man sich vorhält, dass die brillanten Ideen von Keynes selbst im Kontext eines überstandenen Weltkrieges abgelehnt wurden. Was könnte da potenziell unsere Hoffnung sein, unter heutigen Umständen eine radikale globale Geldreform umzusetzen, die selbst Keynes nicht in der Lage war durchzusetzen? Da muss man einfach anerkennen, dass es zurzeit schwer vorstellbar ist, seinen Vorschlag zu realisieren. Gleichzeitig ist es aber enorm ermunternd und inspirierend zu sehen, wie Keynes diese Probleme des Geldwesens nicht auf eine rein technische Ebene reduziert, sondern sie wirklich als verfassungstheoretische Probleme angeht. Damit verbindet er Politik und Ökonomie, Außenhandel und Binnenwirtschaft, aber auch Außenpolitik und Demokratietheorie. Da kann man politisches Denken auf dem allerhöchsten Niveau beobachten. Das ist genau die Art und Weise, wie man aus meiner Sicht über Geld nachdenken sollte. Wir sind heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert — etwa wie wir unser Geldsystem demokratischer machen — aber wir haben auch neue Möglichkeiten. Keynes kann hier als Modell dienen, wie man kreativ über Geld nachdenkt. D.h. auf eine Art und Weise, die mit traditionellen Denkmustern bricht und sie dann auf einer höheren Ebene wiederherstellt.
Vielen Dank für das Gespräch!
 Lesezeit 21 Minuten
Lesezeit 21 Minuten