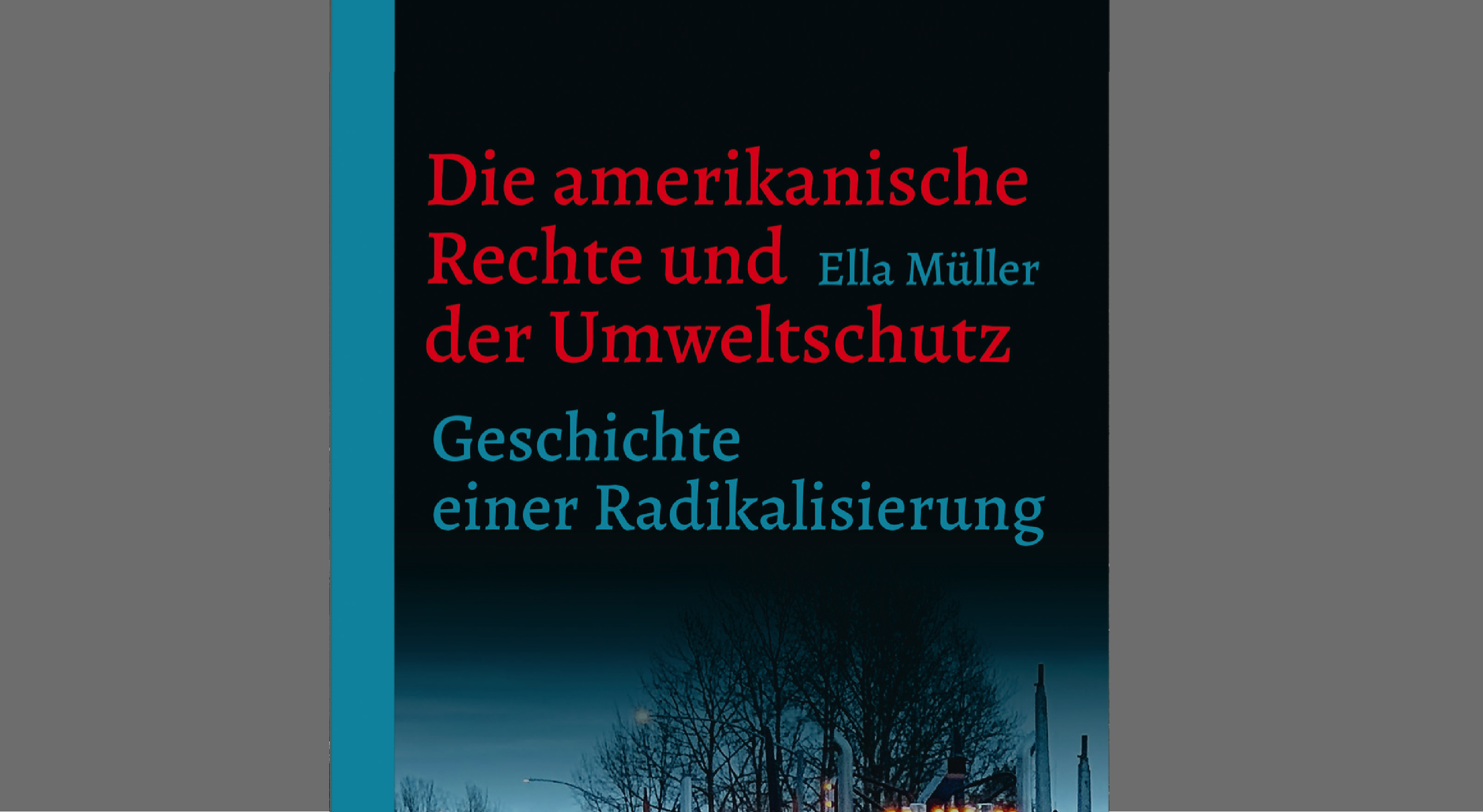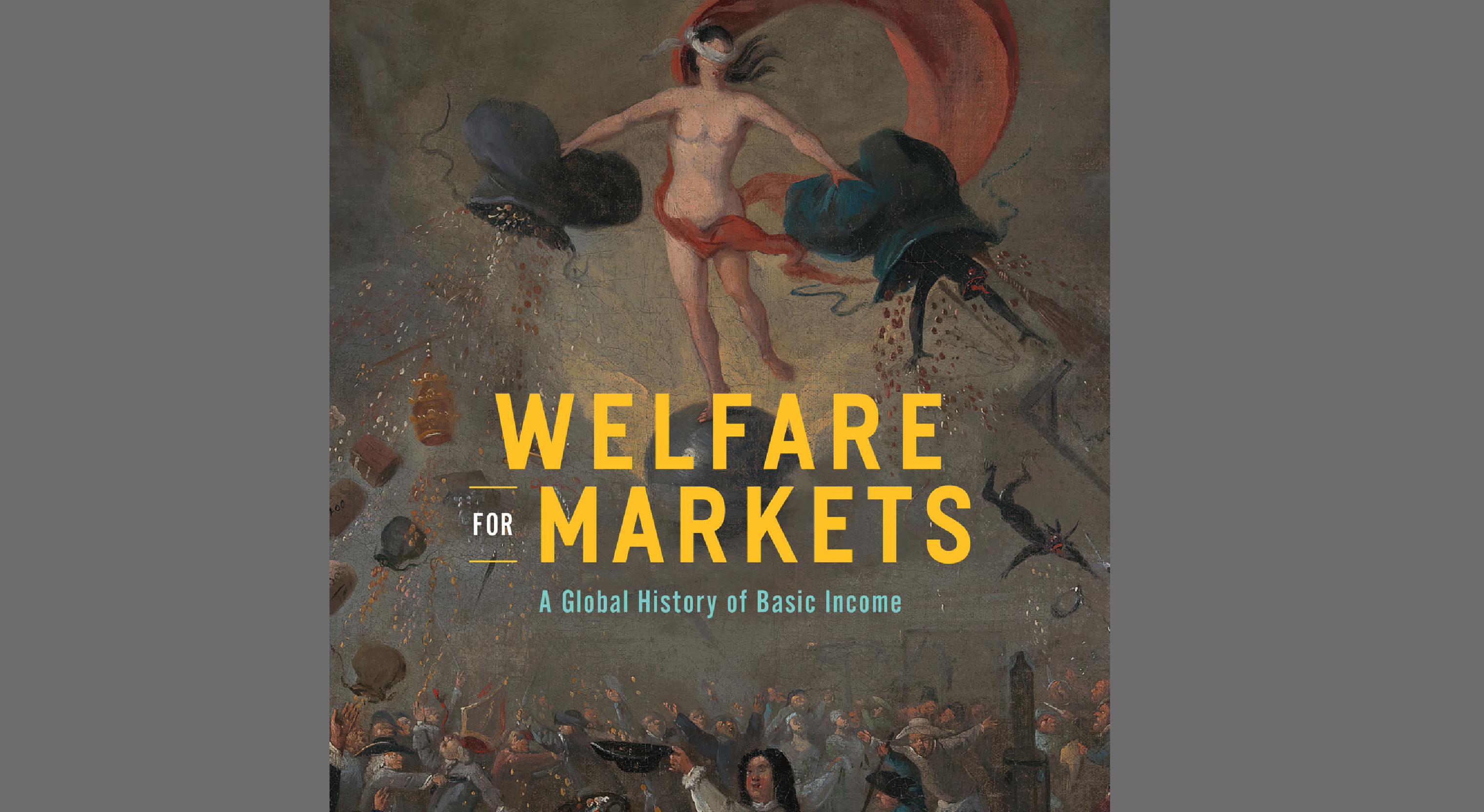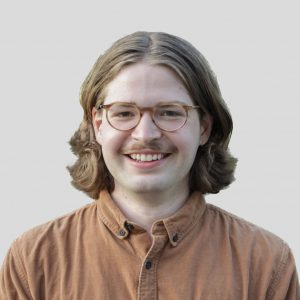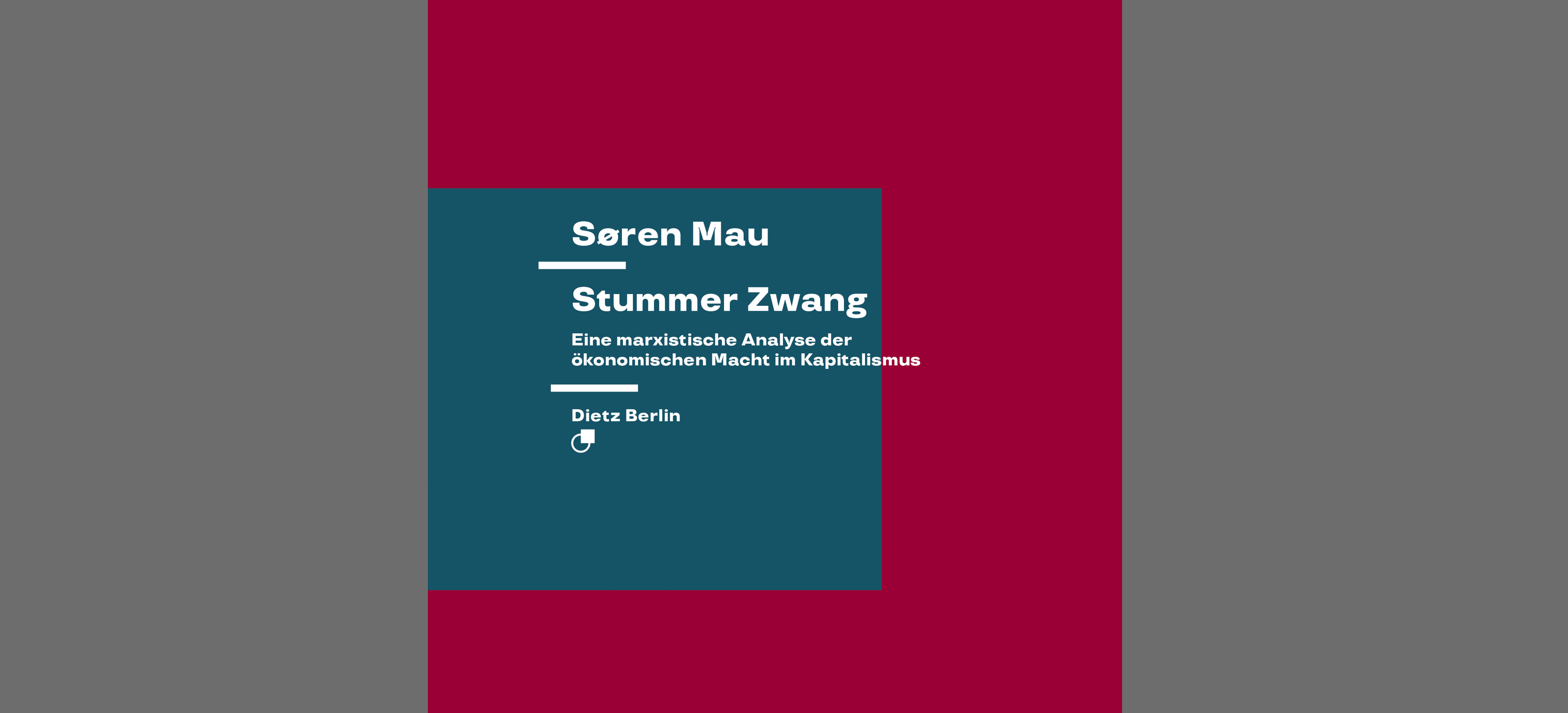Krise ohne Ende
Gibt es überhaupt eine Lösung für die gegenwärtige Krise des demokratischen Kapitalismus? Der politische Theoretiker Benjamin Studebaker begründet eindrucksvoll, wieso es sich um ein chronisches Problem handeln könnte: der Spielraum für politisches Handeln ist zu klein, um realistische Alternativen hervorzubringen.

Krise ohne Ende
Gibt es überhaupt eine Lösung für die gegenwärtige Krise des demokratischen Kapitalismus? Der politische Theoretiker Benjamin Studebaker begründet eindrucksvoll, wieso es sich um ein chronisches Problem handeln könnte: der Spielraum für politisches Handeln ist zu klein, um realistische Alternativen hervorzubringen.